LG Stuttgart: Grundsatz: Börsenwert als Untergrenze der angemessenen Abfindung
LG Stuttgart, Beschluss vom 17.9.2018 – 31 O 1/15 KfH SpruchG
Sachverhalt
A.
I.
Hintergrund des vorliegenden Spruchverfahrens ist der am 22. Mai 2014 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der A AG als beherrschter Gesellschaft und der Antragsgegnerin, B KGaA, damals noch firmierend unter C KGaA als herrschender Gesellschaft. Die Hauptversammlung der A AG hat dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, dessen Abschluss von der Antragsgegnerin am 23. Januar 2014 angekündigt wurde, am 15. Juli 2014 zugestimmt. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 02. Dezember 2014. Der Vertrag sieht eine Barabfindung von 22,99 EUR pro Aktie und eine jährliche Ausgleichszahlung von 0,83EUR pro Aktie für die außenstehenden Aktionäre der A AG vor. Die Antragsteller halten diese Beträge für zu niedrig und begehren im Rahmen des vorliegenden Spruchverfahrens die gerichtliche Festsetzung einer angemessenen Barabfindung und eines angemessenen Ausgleichs. Eine Besonderheit des vorliegenden Falles liegt darin, dass dem Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwei öffentliche Übernahmeangebote der Antragsgegnerin vorausgingen. Der BGH hat zwischenzeitlich entschieden, dass die den Aktionären beim zweiten öffentlichen Übernahmeangebot angebotene Gegenleistung von 23,50 EUR pro Aktie nicht angemessen im Sinne der einschlägigen übernahmerechtlichen Bestimmungen war und dass den Aktionären dabei mindestens 30,95 EUR pro Aktie hätten angeboten werden müssen.
Im Einzelnen:
1. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse
a. A AG
Die A AG ist eine deutsche Aktiengesellschaft mit Sitz in Stuttgart, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB … (nachfolgend: „Gesellschaft“ oder „A“). Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 260.122.792,96 EUR und ist in 203.220.932 nennwertlose Namensaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,28 EUR pro Aktie eingeteilt. Der A-Konzern mit der A AG an der Spitze war jedenfalls im hier relevanten Zeitraum (2014) in den Geschäftsbereichen Pharma- Einzelhandel („Consumer Solutions“) und Pharma-Großhandel („Pharmacy Solutions“) tätig (Bl. 503 d.A.)
Bis Juni 2014 hatte das Grundkapital von A noch 217.728.000 EUR betragen und war eingeteilt in 170.100.000 Stückaktien. Infolge der Nutzung bedingt beschlossener Kapitalerhöhungen durch Ausgabe von Bezugsaktien wurde im Juni 2014 das derzeitige Grundkapital von 260.122.792,96 EUR im Handelsregister eingetragen.
Die Ausgabe dieser Bezugsaktien steht im Zusammenhang mit der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen durch die niederländische Finanzierungsgesellschaft der A-Gruppe in den Jahren 2009 und 2011 (nachfolgend auch: „Wandelanleihen“). Diese Wandelschuldverschreibungen gewährten ihrem Inhaber ein Recht zur Wandlung in Aktien der A AG. Sie sollten zum 29. Oktober 2014 (im Folgenden: „Anleihen 2014“) bzw. zum 07. April 2018 (im Folgenden: „Anleihen 2018“) fällig werden. Im Falle eines Kontrollwechsels konnte der Inhaber die Wandlung vorzeitig zu einem angepassten Wandlungspreis verlangen (vgl. Anl. AG 30; BGH, Urteil vom 07. November 2017 – II ZR
37/16, Rn. 2). Auf die über die Ausübung von Wandelschuldverschreibungen bezogenen Aktien und den für diese Aktien bezahlten Preis wird noch zurückzukommen sein.
b. Antragsgegnerin
Die Antragsgegnerin ist eine 2013 gegründete Kommanditgesellschaft auf Aktien, die zunächst als C KGaA mit Sitz in Frankfurt unter HRB … im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main eingetragen war und die 2014 ihren Sitz nach Schönefeld verlegte. Die Firma wurde in D1 KGaA geändert. Nunmehr war die Antragsgegnerin unter HRB … im Handelsregister des Amtsgerichts Cottbus eingetragen. 2016 wurde die erneute Umfirmierung in D2 KGaA eingetragen. Im November wurde der Sitz nach Stuttgart verlegt. Die Antragsgegnerin ist seitdem beim Amtsgericht Stuttgart unter HRB … eingetragen. Die Firma wurde abermals geändert und lautet seit November 2017 B KGaA (Anlagenkonvolut AG 29).
Persönlich haftende Gesellschafterin der Antragsgegnerin ist die P GmbH mit Sitz in Stuttgart, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB … (Anlagenkonvolut AG 29). Auch die persönliche Gesellschafterin der Antragsgegnerin hat zuvor ihren Sitz verlegt und umfirmiert.
Die Antragsgegnerin gehört zu einer Unternehmensgruppe, an deren Spitze die K Corporation, eine nach dem Recht des US-Bundesstaates Delaware mit Sitz in San Francisco errichtete Gesellschaft steht. K ist ein amerikanischer Pharmagroßhändler, der Arzneimittel, medizinische Produkte und medizinische Informationstechnologie liefert (Bl.
503 d.A.) (nachfolgend: „K“).
2. Übernahmeabsicht und Übernahmeangebote von K
a. Vorbereitung der Übernahme und erstes Übernahmeangebot
K plante seit 2013 die Übernahme der A AG und strebte dabei eine Beteiligung von mindestens 75% an, um nach der Übernahme sicher einen Beherrschungsvertrag mit der A AG schließen zu können (OLG Frankfurt, Urteil vom 19. Januar 2016 – 5 U 2/15 –, Rn. 2, juris).
Rund 50,01% (vor der Aufstockung der Beteiligung) des Grundkapitals der A AG waren in den Händen des Familienkonzerns H GmbH (nachfolgend: „H“). Der Hedgefonds E (nachfolgend: „E“) hielt zum Zeitpunkt des gescheiterten ersten Übernahmeversuchs sowohl ein Aktien-Paket an der A AG als auch Wandelanleihen.
Am 24. Oktober 2013 schlossen K und die Antragsgegnerin mit der A AG eine Vereinbarung über den Zusammenschluss ihrer Unternehmen (Business Combination Agreement, BCA).
Am selben Tag schlossen K und die Antragsgegnerin mit H einen Kaufvertrag über die damals von H gehaltenen rund 50,01 % der ausgegebenen A-Aktien (85.058.505 Aktien) (Anl. AG 30; Vertragsbericht Seite 1; Bl. 503 Rs.; nachfolgend „H-Aktienkaufvertrag‘). Der Vertrag wurde später modifiziert. Der ursprüngliche H-Aktienkaufvertrag stand unter Vollzugsbedingungen, u.a. der Bedingung, dass die Antragsgegnerin eine Mindestbeteiligungsschwelle von 75% aller A-Aktien auf voll verwässerter Basis, d.h. eine vollständige Wandlung der Wandelschuldverschreibungen unterstellt, erreicht (Bl. 503Rs.).
Ebenfalls am 24. Oktober 2013 veröffentlichte die Antragsgegnerin ihre Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots an alle Aktionäre der A AG gemäß § 10 Abs. 1 WpÜG (Vertragsbericht Seite 1; Bl. 503 Rs.) (nachfolgend: „ursprüngliches Übernahmeangebot“ bzw. „erstes Übernahmeangebot“).
Am 05. Dezember 2013 veröffentlichte sie die entsprechende Angebotsunterlage zum an die Aktionäre der A AG gerichteten freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot. Gleichzeitig gab sie auch ein an die Inhaber der bereits erwähnten Wandelschuldverschreibungen (Anleihe 2014 und Anleihe 2018) gerichtetes freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot ab (nachfolgend: „Anleiheangebot“). Auch diese Übernahmeangebote standen wie der ursprüngliche H-Aktienkaufvertrag unter Vollzugsbedingungen, u.a. der Bedingung, dass die Antragsgegnerin eine Mindestbeteiligungsschwelle von 75% aller von A ausgegebenen Aktien auf vollverwässerter Basis erreicht. Als Gegenleistung war zunächst die Zahlung von 23,00 EUR pro A-Aktie angeboten. Die reguläre Annahmefrist des ersten Übernahmeangebots endete am 09. Januar 2014 (vgl. Anl. AG 30; Vertragsbericht Seite 1; Bl. 503 Rs.).
Am letzten Tag der regulären Annahmefrist des ersten Übernahmeangebots erhöhte die Antragsgegnerin im Zusammenhang mit einer Änderung des H-Aktienkaufvertrages die offerierte Gegenleistung um 0,50 EUR auf 23,50 EUR.
Am 14. Januar 2014 gab die Antragsgegnerin bekannt, dass die in Ziffer 13.1 der Angebotsunterlage vorgesehene Mindestannahmeschwelle zum Ablauf der Annahmefrist (09. Januar 2014) nicht erreicht sei. Die Vollzugsbedingung sei damit ausgefallen, folglich erlösche das Übernahmeangebot und die infolge der Annahme des Übernahmeangebots zustande gekommenen Verträge würden nicht vollzogen und entfielen. Das Übernahmeangebot sei bis zum Ablauf der Annahmefrist am 09. Januar 2014 für insgesamt 44.817.754 A-Aktien angenommen worden. Mit H habe sie den (bereits erwähnten, unter Vollzugsbedingungen stehenden) Aktienkaufvertrag über 85.058.505 A- Aktien geschlossen. Am Stichtag hätten weder sie noch die mit ihr gemeinsam handelnden Personen i.S.d. § 2 Abs. 5 WpÜG Anleihen gehalten. Sie habe Verträge über den Erwerb von Anleihen unter einer Vollzugsbedingung geschlossen und das Anleiheangebot sei außerdem bis zum Ablauf der Annahmefrist für eine mitgeteilte Stückzahl von Anleihen angenommen worden. Die Gesamtzahl der von ihr bzw. mit ihr gemeinsam handelnden Personen gehaltenen Aktien sowie der Aktien, für die das Übernahmeangebot bis zum Meldestichtag angenommen worden sei, und zuzüglich der A-Aktien, die aufgrund von Instrumenten nach §§ 25, 25a WpHG erworben werden könnten, belaufe sich auf 145.545.984 A-Aktien. Das entspreche einem (unverwässerten) Anteil von rund 85,56% des Grundkapitals. Bezogen auf die im ersten Übernahmeangebot enthaltene Annahmeschwelle sei ein Anteil von ca. 72,33% auf voll verwässerter Basis erreicht. Die Rückbuchung der auf das Ursprüngliche Übernahmeangebot eingelieferten A-Aktien und Anleihen erfolge voraussichtlich zum 17. Januar 2014. Wegen der Einzelheiten wird auf Anl. AG 31 Bezug genommen.
Die Vollzugsbedingungen des H-Aktienkaufvertrages waren damit ebensowenig erreicht wie diejenigen des Ursprünglichen Übernahmeangebots. Die Übernahme war somit zunächst erfolglos geblieben (Vertragsbericht Seite 1; Bl. 503 Rs.).
b. Geschehnisse vor dem zweiten Übernahmeangebot
Am 20. Januar 2014 bot H der Antragsgegnerin den Erwerb einer aufgestockten Beteiligung von 75,99% an (Bl. 504 d.A.). H stockt seine Beteiligung auf 75,99% auf, indem es Aktien von E erwarb. Am 23. Januar 2014 schlossen K, die Antragsgegnerin und H einen „Neugefassten Aktienkaufvertrag“ über 75,99% zu einem Kaufpreis von 23,50 EUR pro Aktie ab, der nunmehr unter keiner weiteren Vollzugsbedingung stand (Bl. 503 Rs., 504 d.A.).
Ebenfalls am 23. Januar 2014 schlossen K und die Antragsgegnerin mit E einen Kaufvertrag über Wandelschuldverschreibungen (4.840 Anleihen 2014 und 2.180 Anleihen 2018). Bezogen auf eine A-Aktie ergab sich hinsichtlich der am 23. Januar 2014 erworbenen Anleihen 2014 ein Kaufpreis von 30,943 EUR und hinsichtlich der Anleihen 2018 ein Kaufpreis von 30,951 EUR (Bl. 504; BGH, Urteil vom 07. November 2017 – II ZR 37/16 –, Rn. 2, 3; OLG Frankfurt, Urteil vom 19. Januar 2016 – 5 U 2/15 –, Rn. 3, juris LG Frankfurt, Urteil vom 02. Dezember 2014 – 3/5 O 44/14 –, Rn. 20, juris).
Die Folge des Neugefassten H-Aktienkaufvertrages und des Kaufvertrages mit E über die Wandelschuldverschreibungen war, dass der Antragsgegnerin nun bei Vollzug der Kaufverträge etwas mehr als 75% der A-Aktien auf verwässerter Basis zustehen würden (Bl. 504 d.A.). Das Ziel von K , eine qualifizierte Stimmrechtsmehrheit zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zu erlangen, war mit Vollzug der Verträge erreicht.
Durch die Aufstockung der Beteiligung der H am 22. Januar 2014 und die Veröffentlichung am 24. Januar 2014 war ein Kontrollwechsel im Sinne der Anleihebedingungen eingetreten. Dadurch waren die bereits erwähnten Anleihen spätestens am 24. Januar 2014 wandelbar (BGH, Urteil vom 07. November 2017 – II ZR 37/16 –, Rn. 2, juris; OLG Frankfurt, Urteil vom 19. Januar 2016 – 5 U 2/15 –, Rn. 3, juris).
Am 27. Januar 2014 wurde der Kaufvertrag über die „Anleihen 2018“ mit E im Hinblick auf 2.180 Anleihen dinglich vollzogen (kein Gewinnbezugsrecht der Aktien für 2013). Am Folgetag übte die Antragsgegnerin die Wandlungsrechte zum angepassten Wandlungspreis aus und erlangte am 03. Februar 2014 hieraus 11.443.569 A-Aktien (LG Frankfurt, Urteil vom 02. Dezember 2014 – 3/5 O 44/14 –, Rn. 21).
Am 06. Februar 2014 wurde der Neugefasste H-Aktienkaufvertrag dinglich vollzogen (LG Frankfurt, Urteil vom 02. Dezember 2014 – 3/5 O 44/14 –, Rn. 23, juris). Ebenfalls am 06. Februar 2014 wurde der Kaufvertrag über die „Anleihen 2014“ mit E im Hinblick auf 4.840 Anleihen dinglich vollzogen. Am 12. Februar 2014 übte die Antragsgegnerin auch diesbezüglich das Wandlungsrecht zum angepassten Wandlungspreis von 21,66 EUR aus und erlangte am 17. Februar 2014 daraus weitere 11.172.668 Aktien (LG Frankfurt, Urteil vom 02. Dezember 2014 – 3/5 O 44/14 –, Rn. 22, juris).
c. Zweites Übernahmeangebot
Die Antragsgegnerin strebte auch nach sicherer Erlangung der 75% an, die restlichen A- Aktien - nun im Wege eines zweiten öffentlichen Übernahmeangebots - zu erwerben.
Auf ihren Antrag vom 22. Januar 2014 befreite die BaFin am 23. Januar 2014 von der Einhaltung der einjährigen Sperrfrist des § 26 Abs. 1 WpÜG. Noch am selben Tag informierte die Antragsgegnerin darüber, dass sie mit der A AG über den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages verhandele, kündigte ein weiteres Übernahmeangebot an und veröffentlichte ihre Entscheidung zur Abgabe eines (weiteren) freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots (Bl. 504 d.A.; Anl. AG 32).
Der durchschnittliche gewichtete Börsenkurs im Dreimonatszeitraum vor der Bekanntgabe der Absicht zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages (also im Zeitraum vom 23. Oktober 2013 bis zum 22. Januar 2014) betrug laut Auskunft der BaFin 22,99 EUR pro Aktie (Bewertungsgutachten Seite 111).
Die Angebotsunterlage für das am 23. Januar 2014 angekündigte weitere öffentliche Übernahmeangebot (nachfolgend: „Zweites Übernahmeangebot“) sah eine Gegenleistung von 23,50 EUR pro A-Aktie vor. Die Angebotsunterlage musste zunächst der BaFin vorgelegt werden. Die Antragsteller Ziff. 36 bis 39 des vorliegenden Verfahrens wandten bei der BaFin ein, dass der Preis beim zweiten Übernahmeangebot mindestens 30,95 EUR pro A-Aktie betragen müsse, weil die Vorerwerbspreise für die Anleihen zu berücksichtigen seien, und beantragten die Untersagung des Angebots. Mit diesem Begehren hatten sie jedoch bei der BaFin keinen Erfolg. Die BaFin beanstandete nicht, dass der Vorerwerbspreis für die Anleihen für die Bemessung des Mindestangebots nicht berücksichtigt worden war, und nahm in der Sache den insbesondere auf § 4 WpÜGAngebV gestützten Rechtsstandpunkt ein, als „Vorerwerb“ im übernahmerechtlichen Sinne gelte nicht, wenn der Bieter Schuldverschreibungen erwirbt, die ihm das Recht gewähren, Aktien der Zielgesellschaft zu beziehen. Die bei der BaFin gestellten Anträge der Aktionäre wurden von ihr als unzulässig zurückgewiesen. Es stehe ihnen offen, etwaige Ansprüche im Zivilrechtswege durchzusetzen (Bl. 1124 d.A.; Anl. AG 3; LG Frankfurt, Urteil vom 02. Dezember 2014 – 3/5 O 44/14 –, Rn. 27).
Nach Prüfung und Gestattung durch die BaFin veröffentlichte die Antragsgegnerin am 28. Februar 2014 die Angebotsunterlage für ihr zweites öffentliches Übernahmeangebot (Bl. 504 d.A.; LG Frankfurt, Urteil vom 02. Dezember 2014 – 3/5 O 44/14 –, Rn. 26, juris). Wie bereits erwähnt, betrug der Angebotspreis 23,50 EUR pro A-Aktie. Es enthielt im Gegensatz zum ersten Übernahmeangebot keine weiteren Vollzugsbedingungen. Die reguläre Annahmefrist endete am 02. April 2014 (Bl. 504 d.A.), die weitere Annahmefrist am 22. April 2014 (Vertragsbericht Seite 2; Bl. 1126 d.A.). Es wurde für 1.567.026 Aktien angenommen, darunter auch für 972.040 Aktien, die ein Unternehmen der K -Gruppe über Wandelschuldverschreibungen erlangt hatte (LG Frankfurt, Urteil vom 02. Dezember 2014 – 3/5 O 44/14 –, Rn. 29). Bezogen auf dieses Zweite Übernahmeangebot entschieden das OLG Frankfurt und der BGH später, dass die von der Antragsgegnerin angebotene Gegenleistung von 23,50 EUR je Aktie nicht angemessen im Sinne von § 31 Abs. 1 WpÜG i.V.m. §§ 4,5 WpÜGAngebV gewesen sei. Im übernahmerechtlichen Sinne maßgeblich sei der höchste, für den Erwerb der Wandelschuldverschreibungen bezogen auf eine Aktie gezahlte Betrag von 30,95 EUR, den die Beklagte auch innerhalb der Frist des § 4 Satz 1 WpÜGAngebV gezahlt habe (BGH, Urteil vom 07. November 2017 – II ZR 37/16 –, Rn. 35, juris). Zu diesen Entscheidungen war es wie folgt gekommen: Die bereits genannten vier Antragsteller Ziff. 36 bis 39 hatten auf das Zweite Übernahmeangebot A-Aktien an die Antragsgegnerin geliefert (vgl. Bl. 1124 d.A.; OLG Frankfurt, Urteil vom 19. Januar 2016 – 5 U 2/15 –, Rn. 8, juris). Im Anschluss verlangten sie mit einer Klage Zahlung des Unterschiedsbetrags zwischen dem höchsten von der K -Gruppe für die Wandelschuldverschreibung je Aktie gezahlten Preis von 30,95 EUR und den pro Aktie aufgrund des Übernahmeangebots gezahlten 23,50 EUR. Ihre Klage war zunächst vor dem LG Frankfurt, dann vor dem OLG Frankfurt und schließlich beim BGH anhängig. Das OLG Frankfurt verurteilte die Antragsgegnerin zur Zahlung des Unterschiedsbetrages (OLG Frankfurt, Urteil vom 19. Januar 2016 – 5 U 2/15 –, juris; hier in anonymisierter Form vorgelegt Bl. 693-1). Die Revision hatte keinen Erfolg (BGH, Urteil vom 07. November 2017 – II ZR 37/16 –, Rn. 6, juris). Das OLG Frankfurt und der BGH waren anders als die BaFin und das LG Frankfurt der Auffassung, dass bei der Ermittlung der angemessenen Gegenleistung für das Übernahmeangebot nach § 31 Abs. 1 WpÜG grundsätzlich auch die für den Erwerb von Wandelschuldverschreibungen gezahlten Preise zu berücksichtigen seien.
3. Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
Wie bereits ausgeführt, hatte die Antragsgegnerin am 23. Januar 2014 die Absicht zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages bekanntgegeben, und zwar durch die Mitteilung, sie sei an die A AG herangetreten, um mit dieser über den Abschluss eines solchen Vertrages zu verhandeln (Bl. 504 d.A.).
Im gemeinsamen, im Februar 2014 erteilten Auftrag der A AG und der Antragsgegnerin erstattete die X Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG (nachfolgend „Bewertungsgutachter“) ein Bewertungsgutachten zur Ermittlung einer angemessenen Abfindung und eines angemessenen Ausgleichs für die außenstehenden Aktionäre. Wegen des Inhalts wird auf das von der Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 02. November 2015 vorgelegte Bewertungsgutachten vom 14. Mai 2014 Bezug genommen (Bl. 495 d.A.; Gutachten vgl. Ordner Anlagen, nachfolgend „BewGA“).
Am 04. Februar 2014 beantragten die A AG und die Antragsgegnerin beim Landgericht Stuttgart die Bestellung eines sachverständigen Prüfers als Vertragsprüfer gemäß §§ 293b ff. AktG. Mit Beschluss vom 06. Februar 2014 bestellte das Landgericht Stuttgart die Y Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft zum Vertragsprüfer (nachfolgend „Vertragsprüfer“ bzw. „sachverständiger Prüfer“) (LG Stuttgart, 31 O 2/14 KfH AktG, vgl. auch Anlage 2 zum Prüfungsbericht). Unter dem 16. Mai 2014 erstattete der sachverständige Prüfer seinen Bericht. Wegen der Einzelheiten wird auf den Prüfungsbericht verwiesen (vgl. Bl. 495 d.A., Prüfungsbericht vgl. Ordner Anlagen, nachfolgend „PB“).
Der Bewertungsgutachter ermittelte einen nach dem Ertragswertverfahren zum 15. Juli 2014 berechneten Unternehmenswert von 4.556 Mio. EUR (22,42 EUR pro Aktie) sowie einen durchschnittlichen Börsenkurs von 22,99 EUR bezogen auf den Dreimonatszeitraum vom 23. Oktober 2013 bis 22. Januar 2014 und kam zu dem Ergebnis, die angemessene Abfindung gemäß § 305 AktG betrage 22,99 EUR pro Aktie. Die angemessene Ausgleichszahlung nach § 304 AktG betrage 0,83 EUR (Bruttogewinnanteil je Stückaktie) (BewGA Seite 117).
Der sachverständige Prüfer bestätigte die Angemessenheit von Abfindung und Ausgleich (PB Seite 90).
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (nachfolgend „BGAV“) wurde am 22. Mai 2014 unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlungen der A AG und der Antragsgegnerin geschlossen. Er sah einen jährlichen Ausgleich von 0,83 EUR brutto pro Aktie für die außenstehenden Aktionäre vor sowie eine Abfindung von 22,99 EUR pro Aktie. Gemäß § 5 Abs. 6 lebt der Abfindungsanspruch der außenstehenden Aktionäre im Falle der späteren Kündigung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages wieder auf. Wegen der Einzelheiten wird auf den bei den Akten befindlichen Vertragstext und die Patronatserklärung von K (nach Bl. 495 d.A.; Ordner Anlagen, BewGA Anlage 4 Seite 207 ff.) Bezug genommen.
Die Hauptversammlung der A AG stimmte dem Vertrag am 15. Juli 2014 zu (Bl. 505 d.A.). Gegen den Beschluss wurde Anfechtungsklage erhoben (zunächst beim LG Stuttgart unter 31 O 55/14 KfH anhängig; der Antragsteller Ziff. 32 des vorliegenden Verfahrens ist diesem Rechtsstreit beigetreten, vgl. Bl. 231 d.A.). Am 02. Dezember 2014 entschied das OLG Stuttgart, dass die Anfechtungsklage der Eintragung des BGAV nicht entgegenstehe (OLG Stuttgart, Beschluss vom 02. Dezember 2014 – 20 AktG 1/14 –, juris). Am selben Tag wurde der BGAV im Handelsregister eingetragen. Ebenfalls am 02. Dezember 2014 wurde die Eintragung bekannt gemacht (Bl. 505 Rs.; Anl. AG 4).
II. Anträge, Verfahrensverbindung und Einwendungen der Antragsteller
Sämtliche Antragsteller mit Ausnahme der Antragsteller Ziff. 14 und 15 begehren in ihren Antragsschriften, die zwischen dem 05. Januar 2015 und dem 02. März 2015 eingegangen sind, entweder ausdrücklich oder sinngemäß eine gerichtliche Bestimmung der angemessenen Abfindung und des angemessenen Ausgleichs gemäß §§ 304 Abs. 3 Satz 3, 305 Abs. 5 Satz 2 AktG i.V.m. § 1 Nr. 1 SpruchG. Der gemeinsame Vertreter hat sich diesen Anträgen angeschlossen (Bl. 697 d.A.).
Die Antragsteller Ziff. 14 und 15 erwähnen die (verfahrensrechtlich denkbare) gerichtliche Festsetzung des Ausgleichs lediglich abstrakt beim Verfahrensgegenstand, rügen aber inhaltlich nur die Unangemessenheit der Barabfindung.
Die Verfahren wurden durch Beschluss vom 25. September 2015 verbunden (Bl. 486 ff. d.A.). Der zugleich bestellte gemeinsame Vertreter der Antragsberechtigten, die nicht selbst Antragsteller sind, stellte mit Schriftsatz vom 02. Mai 2016 ebenfalls den Antrag, die angemessene Abfindung und den angemessenen Ausgleich gerichtlich zu bestimmen (Bl. 762 d.A.).
Die Antragsteller und der gemeinsame Vertreter tragen zur Begründung ihrer Anträge zusammengefasst insbesondere folgendes vor:
Einige Antragsteller rügen ausdrücklich, die an E bezahlten Vorerwerbspreise von bis zu 30,95 EUR pro Aktie seien bei der Festlegung der Abfindung zu Unrecht nicht berücksichtigt worden (so etwa die Antragsteller Ziff. 1 – Bl. 654 ff. d.A.; Ziff. 6 bis 9 – Bl. 28-5 d.A.; Ziff. 30, 31 – Bl. 197, 654 ff. d.A.; Ziff. 36 bis 40 – Bl. 325, 654 ff. d.A.; Ziff. 48 und 49 – Bl. 455 d.A.; Ziff. 30 und 31, Bl. 196; Ziff. 33 – Bl. 259; Ziff. 36 bis 40 - Bl. 325 d.A.; Ziff. 48 und 49 – Bl. 455 d.A.; sinngemäß wohl auch Ziff. 29 – Bl. 191).
Manche sehen (jedenfalls) in dem beim (ersten oder zweiten) Übernahmeangebot offerierten Preis von 23,50 EUR pro Aktie ein Indiz für die Unangemessenheit der anlässlich des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages angebotenen Barabfindung (so etwa die Antragsteller Ziff. 7 bis 8 – Bl. 29-11 d.A.; vgl. auch Vortrag der Antragsteller Ziff. 18 bis 23 – Bl. 117 d.A.). Teilweise stellen sie auch auf von K bezahlte Vorerwerbspreise ab und verlangen, dass den Minderheitsaktionären „mindestens 23,50 EUR“ anzubieten seien (so etwa die Antragsteller Ziff. 18 bis 23 – Bl. 120 d.A.; Ziff. 28 – Bl. 176 d.A.; Ziff. 43 – Bl. 402 d.A.).
Viele Antragsteller bemängeln die der Unternehmensbewertung nach dem Ertragswertverfahren zugrunde liegende Planung, teils in allgemeiner Form, teils konkreter (u.a. Antragsteller Ziff. 6 bis 9 – Bl. 28-4 ff.; Ziff. 9, Bl. 30-5; Ziff. 10, Bl. 31-2; Ziff. 13 – Bl. 69 ff.; Ziff. 16 – Bl. 88; Ziff. 17 – Bl. 97 ff.; Ziff. 18 bis 23 – Bl. 117 ff.; Ziff. 25 – Bl. 147; Ziff. 26 – Bl. 154; Ziff. 28 – Bl. 174; Ziff. 44, 45 – Bl. 431 ff.; Ziff. 51 – Bl. 478).
Manche behaupten, es liege eine „anlassbezogene Negativplanung“ vor. Es sei (sinngemäß) nicht (allein) auf die am 18. November 2013 verabschiedete reguläre Unternehmensplanung abgestellt worden. Vielmehr sei diese „vertretbare“ (Ausgangs-) Planung „im Zuge der Bewertungsarbeiten revidiert“ worden, und zwar mithilfe der Bewertungsgutachter (u.a. Antragsteller Ziff. 16, Bl. 86; vgl. auch Ziff. 18 bis 23 – Bl. 118; Ziff. 30, 31 – Bl. 198; auch Antragsteller Ziff. 32, Bl. 234; Ziff. 34, Bl. 271; Ziff. 43 – Bl. 405; Ziff. 48 und 49 – Bl. 456).
Andere bemängeln, der Planung fehle die notwendige Aktualität (u.a. Antragsteller Ziff. 17 - Bl. 96; Ziff. 26 – Bl. 154).
Gerügt wird u.a. auch die (vermeintlich) fehlende oder unzureichende Berücksichtigung von Synergieeffekten aus der Übernahme durch bzw. dem Zusammenschluss mit K bei der Planung (so etwa Antragsteller Ziff. 12 - Bl. 52 d.A.; Ziff. 17 - Bl. 96; Ziff. 26 - Bl. 154; Ziff. 30 und 31 - Bl. 207 d.A.; Ziff. 36 bis 40 – Bl. 335 d.A.; Ziff. 43 – Bl. 411 d.A.).
Der gemeinsame Vertreter rügte in seiner Stellungnahme vom 15. Juli 2016 – unter Nennung zahlreicher Einzelaspekte – sinngemäß die fehlende inhaltliche Tiefe jedenfalls des Prüfungsberichts des sachverständigen Prüfers im Hinblick auf die Planungsansätze und Planungstreue. Er mahnte dessen ergänzende Befragung an (Bl. 698 ff. d.A.).
Mehrere Antragsteller machen methodische Bedenken gegen das Tax-CAPM geltend. Zahlreiche Antragsteller kritisieren den zugrunde gelegten einheitlichen Basiszinssatz (2,50% vor Steuern, 1,84% nach Steuern), die Marktrisikoprämie (konkret von 5,50 % nach persönlichen Steuern, vgl. BewGA Seite 90, 94; PB Seite 43, 51) und den Betafaktor (angewandt vom Bewertungsgutachter: unternehmenseigener unverschuldeter Betafaktor von 0,72, vgl. BewGA Seite 97; letztlich nach Peer-Group-Analyse bestätigt PB Seite 65) als zu hoch. Viele Antragsteller rügen, dass es für die vom FAUB des IDW am 19. September 2012 „heraufgesetzte“ (Empfehlung zur) Marktrisikoprämie keine nachvollziehbare Begründung gebe, und verweisen auf diverse Studien zur angemessenen Marktrisikoprämie. Manche verlangen in diesem Zusammenhang, dass ein Gutachten eines Kapitalmarktforschers eingeholt wird. Den angesetzten Wachstumsabschlag von 1,00 % (BewGA Seite 99) halten viele Antragsteller für zu gering bemessen.
Schließlich rügen einige Antragsteller, die Darstellung zum nicht betriebsnotwendigen Vermögen sei nicht ausreichend, die zugrunde gelegten Informationen lückenhaft (so etwa Antragsteller Ziff. 24, Bl. 141 d.A.). Die Marke „A“ sei nicht berücksichtigt worden (u.a. Antragsteller Ziff. 13, Bl. 73 d.A.; Ziff. 24, Bl. 144 d.A.; Ziff. 27, Bl. 167 d.A.).
Die Antragsteller Ziff. 1, 30, 31, 36 bis 40 beziehen sich auf ein von ihnen vorgelegtes Gutachten der Z Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, das zahlreiche Kritikpunkte der vorgenommenen Bewertung anspricht und das abhängig von den modifizierten Parametern zu einem Wert pro Aktie von bis zu 35,41 EUR kommt (Gutachten nachfolgend „Z-GA“, vgl. Ordner „Anlagen“). Gerügt werden auch formale Mängel des Vertragsberichts bzw. des „Übertragungsberichts“ (u.a. Antragsteller Ziff. 13, Bl. 72 d.A.; Ziff. 24, Bl. 144 d.A.; Ziff. 27, Bl. 167 d.A.; Ziff. 28 – Bl. 180).
Bezüglich der Höhe der vertraglich vorgesehenen Ausgleichszahlung („Garantiedividende“) wird u.a. beanstandet, es werde von einem unzutreffenden Unternehmenswert ausgegangen (so etwa Antragstellerin Ziff. 33, Bl. 262), es sei kein angemessener Risikozuschlag für das Ausfallrisiko angesetzt worden (u.a. Antragsteller Ziff. 16, Bl. 91 d.A.) und der Verrentungsfaktor sei fehlerhaft abgeleitet worden (u.a. Antragsteller Ziff. 30, 31, Bl. 220 d.A.; Ziff. 33, Bl. 262; Ziff. 36 bis 40, Bl. 348 ff.; Ziff. 43 – Bl. 423 d.A.).
Die Antragsgegnerin ist den Bewertungsrügen ebenso entgegengetreten wie einigen Verfahrensanträgen von Antragstellern, etwa auf Einholung eines Gutachtens eines „unabhängigen Sachverständigen“ zur Unternehmensbewertung oder speziell zur Marktrisikoprämie oder auf Vorlage von Arbeitspapieren der Wirtschaftsprüfer und weiterer Unterlagen oder auf Unterbleiben der Anhörung des sachverständigen Prüfers.
Die Antragsgegnerin meint, die BGH-Entscheidung vom 07. November 2017 zur Gegenleistung des Übernahmeangebots nach dem WpÜG habe keine Auswirkungen auf das vorliegende Spruchverfahren (Bl. 1123 d.A.). Es sei „grundlegend falsch“, den Preis, der übernahmerechtlich nach dem Ergebnis des durch die BGH-Entscheidung beendeten Rechtsstreits nach § 31 Abs. 1 WpÜG an die das Angebot annehmenden Aktionäre bezahlt werden müsse, auch als Mindestbetrag der angemessenen Abfindung nach § 305 Abs. 1 AktG zugrunde zu legen (Bl. 1124 d.A.).
Die Antragsgegnerin geht von unterschiedlichen „Angemessenheitsbegriffen“ des WpÜG und des AktG und in der Rechtsordnung generell aus (Bl. 1123 d.A.). Sie meint, es gebe strukturelle Unterschiede zwischen übernahmerechtlich angemessener Gegenleistung im Sinne des § 31 WpÜG (Ziel sei hier die „Gleichstellung“ der Wertpapierinhaber der Zielgesellschaft untereinander und ein Verbot für den Bieter, einzelne Aktionäre besser zu behandeln als andere) und der gesellschaftsrechtlich angemessenen Abfindung nach § 305 Abs. 1 AktG (Zweck sei die Entschädigung der außenstehenden Aktionäre für den Verlust der aus der Mitgliedschaft folgenden Herrschaftsrechte) (Bl. 1125 d.A.).
Weiter hebt die Antragsgegnerin hervor, dass sich (aus verfassungsrechtlicher Sicht) die angemessene Abfindung bei einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag nicht an den Preisen orientieren müsse, die im Rahmen eines Pflichtangebots anderen Aktionären gezahlt wurden oder werden. Sie verweist dazu insbesondere auf die Entscheidung des BVerfG in Sachen „DAT/Altana“ von 1999 und die BGH-Entscheidung in Sachen „Stollwerck AG“ von 2010 (Bl. 1125 d.A.).
Die Antragsteller Ziff. 36 bis 39 des vorliegenden Verfahrens hätten in dem übernahmerechtlichen „Mindestpreisverfahren“ (abgeschlossen durch BGH- Entscheidung vom 07. November 2017 – II ZR 37/16) obsiegt. Der Umstand, dass andere außenstehende Aktionäre von der Möglichkeit der Einlieferung ihrer Aktien auf das Übernahmeangebot und anschließender Leistungsklage keinen Gebrauch gemacht hätten, rechtfertige wegen der „eindeutigen“ Rechtsprechung des BVerfG und des BGH keine anderslautende „Billigkeitsrechtsprechung“ im vorliegenden Spruchverfahren (Bl. 1126 d.A.).
Immerhin habe H 129.258.505 A-Aktien, also rund 75,99% des damaligen Grundkapitals zum Preis von 23,50 EUR je Aktie an die Antragsgegnerin veräußert. Die Aktien, die aus der Wandlung der von E erworbenen Wandelschuldverschreibungen erworben wurden, entsprächen nur ca. 11,12% des Grundkapitals (Bl. 1126 d.A.). Nach Ablauf des Zweiten Übernahmeangebots habe es noch 48.943.046 außenstehende A-Aktien gegeben. Der theoretische Erhöhungsbetrag entspreche damit ca. 364,6 Mio. EUR (Bl. 1126 d.A.; = 48.943.046 x 7,45 EUR).
Die Antragsgegnerin meint, die Antragsteller verlangten letztlich die Berücksichtigung eines hypothetischen Börsenkursverlaufs. Sie habe jedoch den Börsenkurs nicht in gezielter Umgehung übernahmerechtlicher Regelungen manipuliert und auch nicht gezielt Lücken des Übernahmerechts ausgenutzt (Bl. 1127 d.A.).
Es sei nicht nur ein einziger hypothetischer Börsenkursverlauf denkbar. Denn es sei „völlig unbekannt“, ob die Übernahmetransaktion, eine andere Einschätzung der BaFin im Vorfeld der Bekanntmachung des Zweiten Übernahmeangebots unterstellt, in dieser Weise durchgeführt worden wäre. Es sei denkbar, dass sie – die Antragsgegnerin - von der Übernahmetransaktion gänzlich Abstand genommen hätte (Bl. 1128 d.A.). Die Schwierigkeiten der Ermittlung eines hypothetischen Börsenkursverlaufs habe auch das LG Köln im Fall „Postbank“ erkannt (Bl. 1128 d.A.).
Das Ansinnen der Antragsteller, den hypothetischen Börsenkursverlauf berücksichtigen zu wollen, verstoße „evident“ gegen die Wertungen des BGH in der „Stollwerck“- Entscheidung (Bl. 1128 d.A.). Danach seien die Börsenkurse im Dreimonatszeitraum maßgeblich, der die von Abfindungsspekulationen unbeeinflusste Markterwartung hinsichtlich der Entwicklung des Unternehmenswerts widerspiegele (mit anderen Worten: der Dreimonatskurs vor Bekanntgabe der Absicht zum Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages). Auf den Umstand, dass die Antragsgegnerin zum damaligen Zeitpunkt (23. Januar 2014) noch nicht Hauptaktionärin der A AG gewesen sei, komme es nach der Rechtsprechung des BGH zum Referenzzeitraum nicht an (Bl. 1129 d.A.).
Auch eine Korrektur des Dreimonatsdurchschnittskurses wegen des Zeitablaufs zwischen Bekanntgabe (am 23. Januar 2014) und Bewertungsstichtag (15. Juli 2014) sei nach den von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien („besonders langer Zeitraum“ und Gebotensein der Anpassung „angesichts der Entwicklung der Branchen-Börsenkurse bzw. der Börsenkurse vergleichbarer Unternehmen“) nicht angezeigt. Ein Zeitraum von bis zu sechs Monaten werde noch „als normal angesehen“, erst bei 7,5 bis 8 Monaten habe die Rechtsprechung eine Korrektur in Erwägung gezogen (Bl. 1130 d.A.).
Die Antragsgegnerin wirft den Antragstellern vor, sich über ihre aktienrechtlich zugesicherten Rechte hinaus bereichern zu wollen (Bl. 1129 d.A.).
Wegen des weiteren Vortrags der Beteiligten zu Kritikpunkten in Bezug auf die Bewertung, Verfahrensanträge und Einzelheiten des Parteivortrags wird ergänzend auf den gesamten Akteninhalt Bezug genommen.
III. Verfahrensgang
Der sachverständige Prüfer wurde am 22. November 2016 angehört (Bl. 791 ff. d.A.). Die Ablehnungsgesuche, die im Anschluss gegen den damaligen Kammervorsitzenden und den sachverständigen Prüfer eingegangen waren (Bl. 812, 816, 840 d.A.), lagen zunächst der Kammer selbst (Bl. 905 d.A.) und sodann auf sofortige Beschwerde (Bl. 915 d.A.) dem OLG Stuttgart zur Entscheidung vor. Auf den Nichtabhilfebeschluss der Kammer vom 25. Juli 2017 (Bl. 964 d.A.) und die Zurückweisung der sofortigen Beschwerde durch das OLG Stuttgart bezüglich der Ablehnung des sachverständigen Prüfers (Bl. 984 ff. d.A.) wird verwiesen. Nach dem Ausscheiden des früheren Kammervorsitzenden nahmen die Beschwerdeführer die sofortige Beschwerde bezüglich des gegen ihn gerichteten Ablehnungsgesuchs zurück (Bl. 1001 d.A.).
Anträge verschiedener Antragsteller auf Aussetzung des Verfahrens bis zur Entscheidung des BGH über die Angemessenheit oder Unangemessenheit der im Rahmen des Zweiten Übernahmeangebots angebotenen Gegenleistung (Bl. 1003 ff. d.A.) haben sich mit der bereits erwähnten Entscheidung des BGH vom 07. November 2017 erledigt.
Aus den Gründen
B.
Zuständigkeit, Zulässigkeit der Anträge
I. Anwendbarkeit des SpruchG und Zuständigkeit
Auf die Anträge der Antragsteller ist das Spruchverfahrensgesetz anzuwenden (§ 1 Nr. 1 SpruchG). Die Kammer für Handelssachen des Landgerichts Stuttgart ist für die Entscheidung über die Anträge zuständig (§ 2 Abs. 1 Satz 1 SpruchG; §§ 95 Abs. 2 Nr. 2, 71 Abs. 2 Nr. 4 lit. e GVG; §§ 13 Abs. 2 Nr. 8, Abs. 1 Nr. 2 ZuVOJu).
II. Antragsberechtigung
Antragsberechtigt sind gemäß § 3 Satz 1 Nr. 1, Satz 2 SpruchG nur außenstehende Aktionäre, die auch zum Zeitpunkt der Antragstellung Aktionär waren. Die Aktionärsstellung kann gemäß § 3 Satz 3 SpruchG (ausschließlich) durch Urkunden nachgewiesen werden. Die Umstände, aus denen sich die Antragsberechtigung ergibt, muss der jeweilige Antragsteller gemäß § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 SpruchG innerhalb der Antragsfrist nach § 4 Abs. 1 SpruchG darlegen.
1. Fehlende ausreichende Darlegung der Aktionärsstellung zum maßgeblichen Zeitpunkt
Ein nach dem SpruchG gestellter Antrag auf gerichtliche Festsetzung der Abfindung oder des Ausgleichs ist und bleibt unzulässig, wenn es der Antragsteller versäumt, innerhalb der Antragsfrist (§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SpruchG) die Antragsberechtigung wenigstens darzutun. Nur diese Interpretation ermöglicht eine zügige Prüfung zu Beginn des Verfahrens, ob der Antragsteller überhaupt zum Kreis der Antragsberechtigten gehört, die ein Spruchverfahren in Gang setzen können (OLG Stuttgart, Beschluss vom 14. Februar 2008 – 20 W 9/06 - , Rn. 21 juris; vgl. auch BGH, Beschluss vom 25. Juni 2008 – II ZB 39/07 –, BGHZ 177, 131-141, Rn. 19).
Die Antragsgegnerin meint, einige Antragsteller hätten ihre Antragsberechtigung nicht fristgerecht dargetan. Dazu gehöre bei den hier ausgegebenen Namensaktien wegen § 67 Abs. 1 AktG eine substantiierte Darlegung, bei Antragstellung im Aktienregister eingetragen gewesen zu sein (Bl. 507 Rs. d.A.).
In der Tat soll nach einer in der Literatur vertretenen Auffassung die bloße Behauptung, Aktionär zu sein, für die Darlegung der Antragsberechtigung nach § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 SpruchG nicht genügen. Vielmehr müsse der Antragsteller seine (ggf. ehemalige) Mitgliedschaft substantiiert darlegen (Kubis, in Müko AktG 4. Aufl. 2015 § 4 SpruchG Rn. 14 m.w.N. unter Berufung auf Entscheidungen des OLG Frankfurt und des OLG Düsseldorf, denen sich dies allerdings so nicht entnehmen lässt). Hierzu gehöre im Falle von Namensaktien bei Inanspruchnahme der Vermutung des § 67 Abs. 2 AktG auch der Vortrag, zum maßgeblichen Zeitpunkt in das Aktienregister eingetragen gewesen zu sein (Kubis, in Müko AktG 4. Aufl. 2015 § 4 SpruchG Rn. 14 m.w.N.).
Die Kammer hält letzteres für zu streng und nicht mit dem Gesetzeswortlaut vereinbar. Für die von § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SpruchG geforderte Darlegung der Antragsberechtigung innerhalb der Antragsfrist des § 4 Abs. 1 SpruchG genügt nach Auffassung der Kammer, wenn sich aus dem Vortrag des Antragstellers ergibt, dass er zum jeweils maßgeblichen Zeitpunkt Aktionär der Gesellschaft gewesen ist. Im Falle von Namensaktien hängt die Antragsberechtigung nicht zusätzlich davon ab, ob der Aktionär innerhalb der Antragsfrist auch explizit oder konkludent durch Vorlage eines Auszugs aus dem Aktienregister darlegt, dass er dort zum maßgeblichen Zeitpunkt eingetragen gewesen sei. Eine strengere Handhabung würde die Inhaber von Namensaktien gegenüber anderen Aktionären benachteiligen, wofür kein sachlicher verfahrensrechtlicher Grund ersichtlich ist. Relevant ist die aufgeworfene Frage ohnehin nur bei Auseinanderfallen von materiell-rechtlicher Aktionärsstellung und dem Inhalt des Aktienregisters. Der in § 67 Abs. 2 AktG geregelte Fall des Auseinanderfallens von materieller Rechtsstellung und Aktienregistereintragung stellt die Ausnahme dar, zu der es entweder wegen der nachfolgenden Eintragung im Aktienregister nur während einer kurzen Zeitspanne oder in den seltenen Fällen eines unwirksamen Aktienerwerbes kommen kann. Für das Verfahren vom Regelfall ausgehend, genügt der Antragsteller im Spruchverfahren seiner Darlegungslast in Bezug auf die Antragsberechtigung mit der Darlegung der Aktionärseigenschaft zum maßgeblichen Zeitpunkt, denn die Darlegung, Aktionär zu sein, impliziert dann auch die Behauptung der Eintragung im Aktienregister. Dass kein Sonderfall des Auseinanderfallens von materiell-rechtlicher Berechtigung und dem Inhalt des Aktienregisters vorliege, muss der Antragsteller im Spruchverfahren nicht vortragen (Drescher, in Spindler/Stilz AktG 3. Aufl. 2015 § 4 SpruchG § 4 Rn. 18; im Ergebnis wie hier OLG Frankfurt, Beschluss vom 09. Januar 2006 – 20 W 166/05 –, Rn. 19, 20, juris: „zusätzliche Angabe, im Aktienregister eingetragen zu sein, nicht zwingend“; wohl auch OLG Frankfurt, Beschluss vom 10. Oktober 2005 – 20 W 119/05 –, Rn. 12, juris: „Darstellung der Aktionärseigenschaft in dem für die Antragsberechtigung nach § 3 Satz 1 SpruchG im Einzelnen maßgebenden Zeitpunkt“; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 09. Februar 2005 – I-19 W 12/04 AktE –, Rn. 16, juris; Ederle/Theusinger in: Bürgers/Körber, Aktiengesetz, 4. Aufl. 2017, § 4 SpruchG Rn. 8: „der Eintrag ins Aktienregister muss nicht angegeben werden“; wohl auch Wälzholz in: Widmann/Mayer, Umwandlungsrecht, 1. Aufl. 2002, 172. Lieferung, § 4, Rn. 39; Klöcker in: Schmidt, K./Lutter, AktG, 3. Aufl. 2015, § 4 SpruchG, Rn. 17; Emmerich, in Emmerich/Habersack Aktien-/GmbH-KonzernR/SpruchG § 4 SpruchG Rn. 7a: „keine unnötig strengen Anforderungen“).
Das SpruchG unterscheidet zwischen der Darlegung der Antragsberechtigung und deren Nachweis. Wird die Antragsberechtigung bestritten, kommt es auf die Vorlage geeigneter urkundlicher Nachweise nach § 3 Satz 3 SpruchG an, die aber nicht zwingend innerhalb der Antragsfrist einzureichen sind, sondern im Falle einer richterlich gesetzten Frist bis zu deren Ablauf, sonst bis zur tatrichterlichen Entscheidung nachgereicht werden können (vgl. sogleich 2.).
Nach den von der Kammer angelegten Maßstäben haben sämtliche Antragsteller innerhalb der Antragsfrist ihre Aktionärsstellung zum Zeitpunkt der Antragstellung hinreichend dargetan (Bl. 2, 28-2, 30-3, 31-2, 37, 51, 60, 81, 85, 95, 110, 139, 146, 153, 162, 171, 185, 196, 230, 259, 265-1, 295, 324, 389, 399, 429, 445, 454, 475, 478 d.A.).
Selbst wenn man der strengeren, von der Antragsgegnerin zitierten Literaturauffassung folgte, würde es bei einigen von ihr insoweit bemängelten Anträge nicht an der fristgerechten Darlegung der Antragsberechtigung fehlen, denn diese Darlegung ergäbe sich dann zumindest konkludent durch innerhalb der Antragsfrist nachgereichte entsprechende Bescheinigungen nach § 67 Abs. 6 AktG oder Auszüge aus dem Aktienregister (exemplarisch: Antragsteller Ziff. 10 durch am 27. Februar 2015 nachgereichte Belege, Bl. 36c, 36d; Ziff. 11: 26. Februar 2015, Bl. 49g, 49h; Ziff. 16: 25./26. Februar 2015, Bl. 93-1; Ziff. 16: 25./26. Februar 2015, Bl. 93 f.).
2. Fehlende urkundliche Nachweise
Die Antragsgegnerin verweist in der Antragserwiderung auch darauf, dass einige Antragsteller entweder keine (ausreichenden) urkundlichen Nachweise zur Aktionärsstellung zum maßgeblichen Zeitpunkt (Antragstellung) vorgelegt hätten oder dass vorgelegte Nachweise sich nicht auf den richtigen Zeitpunkt bezögen (Bl. 507 d.A.). Im Schriftsatz vom 07. November 2016 hat sie ergänzend zur Frage der Unzulässigkeit einiger Anträge wegen fehlender Nachweise der Antragsberechtigung Stellung genommen (Bl. 721 ff. d.A.).
Der urkundliche Nachweis der Aktionärsstellung zum maßgeblichen Zeitpunkt kann auch nach Ablauf der Antragsfrist noch bis zum Ablauf einer tatrichterlich gesetzten Frist nachgeholt werden kann (BGH, Beschluss vom 25. Juni 2008 – II ZB 39/07 –, BGHZ 177, 131-141, Rn. 13 ff., 24). Legt ein Antragsteller jedoch auch innerhalb der richterlichen Frist oder mangels Fristsetzung bis zur tatrichterlichen Entscheidung keinen oder keinen ausreichenden Urkundsnachweis vor, ist sein Antrag jedoch mangels Antragsbefugnis unzulässig (OLG München, Beschluss vom 26. Juli 2012 – 31 Wx 250/11 –, Rn. 10, juris).
Nach Auffassung der Kammer genügt auch im Falle von Namensaktien als Nachweis der Aktionärsstellung eine entsprechende Bankbescheinigung. Die Nachweismöglichkeiten sind auch hier nicht auf die Vorlage eines Auszugs aus dem Aktienregister oder eine Bestätigung der Gesellschaft beschränkt. Maßgeblich ist zwar im Verhältnis zur Gesellschaft letztlich die Eintragung im Aktienregister. Solange das Aktienregister und eine etwa vorgelegte Bankbescheinigung aber inhaltlich nicht voneinander abweichen, genügt auch letztere zum Nachweis der Antragsberechtigung.
Bezüglich der Antragsteller Ziff. 18-23, 44 und 50 behauptet die Antragsgegnerin, die vorgelegten Nachweise bezögen sich auf einen falschen Zeitpunkt.
Die Antragsschrift der Antragsteller Ziff. 18-23 ist per Telefax am 19. Februar 2015 eingegangen, wie der Eingangsstempel belegt (Bl. 102 d.A.). Die vorgelegten Bankunterlagen (Anl. A 4, A 5, A 7, A 8, A 9, A 10 nach Bl. 136 d.A.) beziehen sich ebenfalls auf dieses Datum. Der Einwand der Antragsgegnerin erweist sich insoweit als unbegründet.
Der Antrag des Antragstellers Ziff. 31 ist am 26. Februar 2015 unter Darlegung seiner Eintragung im Aktienregister eingegangen (Bl. 196 d.A.). Die Bestätigung der A AG vom 09. März 2015 für den 26. Februar 2015 sowie der entsprechende Auszug vom 09. März 2015 aus dem Aktienregister über den seit 29. Januar 2014 unverändert gehaltenen Bestand liegt als Anlage zum Schriftsatz vom 16. März 2015 vor (Bl. 223-6, 223-8 d.A.). Die bezüglich des Antragstellers Ziff. 31 im Schriftsatz vom 07. November 2016 von der Antragsgegnerin aufrechterhaltene Zulässigkeitsrüge (Bl. 721 d.A.) ist nicht berechtigt.
Beim Antragsteller Ziff. 44 genügten die als Anlage ASt. 1 (nach Bl. 442 d.A.) der Antragsschrift beigefügten Unterlagen (u.a. Mitteilung über das Abfindungsangebot datiert auf den 08. Dezember 2014 und nicht unterzeichnetes Formular zur Annahme des dem BGAV vorausgegangenen Übernahmeangebots) in der Tat nicht als Nachweis der Antragsberechtigung zum Zeitpunkt des Antragseingangs bei Gericht am 02. März 2015. Der mit Schriftsatz vom 08. November 2016 nachgereichte, auf den 08. Juli 2016 datierte Auszug aus dem Aktienregister zeigt einen seit 06. Januar 2014 unverändert gehaltenen Aktienbestand (Bl. 746-1 d.A.) und genügt somit als Nachweis der Antragsberechtigung. Die Antragsteller Ziff. 14 und 15 haben durch den mit Schriftsatz vom 17. November 2016 nachgereichten Auszug aus dem Aktienregister vom 16. November 2016 ihren seit August 2011 unverändert gehaltenen gemeinsamen Aktienbestand belegt (Bl. 754 d.A.).
Der Antragsteller Ziff. 50, dessen Antrag am 02. März 2015 eingegangen ist, hat seiner Antragsschrift lediglich ein auf den 29. Januar 2015 datiertes Informationsschreiben einer Bank beigefügt (nach Bl. 475 d.A.). Die vom Antragsteller Ziff. 50 mit Schriftsatz vom 30. Mai 2016 angekündigte Bestätigung (Bl. 605 d.A.) wurde jedoch mit Schriftsatz vom 08. Juni 2016 nachgereicht (Bescheinigung der A AG vom 30. Mai 2015) und weist die Antragsberechtigung am Tag des Antragseingangs nach (Bl. 638, 638-1).
Die Antragstellerin Ziff. 26 hat eine Bescheinigung der A AG nachgereicht, wonach sie am 27. Februar 2015 im Aktienregister eingetragen gewesen sei (nach Bl. 598 d.A.). Ihr Antrag ist jedoch am 24. Februar 2015 eingegangen (Bl. 153 d.A.). Dennoch ist ihre Antragsberechtigung nachgewiesen, denn sie hat bereits mit am 07. April 2015 eingegangenem Schriftsatz eine unterzeichnete Bankbescheinigung bezogen auf den 24. Februar 2015 vorgelegt (Bl. 159-1 d.A.).
3. Hinreichend konkrete Angaben nach § 4 Abs. 2 Nr. 3, 4 SpruchG
Sämtliche Antragsschriften enthalten hinreichend konkrete Angaben zur Art der Strukturmaßnahme i.S.v. § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 SpruchG und hinreichend konkrete Bewertungsrügen i.S.v. § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 SpruchG.
4. Zum Zeitpunkt der Antragstellung minderjährige Antragsteller
Zum Zeitpunkt der Antragstellung waren die Antragsteller Ziff. 3, 21 und 23 minderjährig (vgl. die Angaben in den jeweiligen Antragsschriften, Bl. 1 d.A. und 102 d.A.). Ihre Anträge sind im Ergebnis mangels Bestellung eines Ergänzungspflegers unzulässig.
a. Antragsteller Ziff. 21 und 23
Die Antragsteller Ziff. 21 und 23 wurden bei Antragstellung und im weiteren Verfahren durch ihren Vater, den Antragsteller Ziff. 22, von Beruf Rechtsanwalt, vertreten.
Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, die Anträge der Antragsteller Ziff. 21 und 23 seien unzulässig, weil sie bei Antragstellung minderjährig gewesen seien und es wegen §§ 1629 Abs. 2 Satz 1, 1795 Abs. 1 Nr. 1 BGB an einer wirksamen Verfahrensvollmacht fehle. Die genannten Antragsteller hätten nach Auffassung der Antragsgegnerin nicht, wie geschehen, ohne Bestellung eines Ergänzungspflegers von ihrem Vater (dem Antragsteller Ziff. 22) anwaltlich hätten vertreten werden dürfen (Bl. 508 d.A.). Das gemeinschaftliche Vertretungsrecht der Eltern (§ 1629 Absatz 1 Satz 2 BGB) erlaubt den Eltern zwar auch die Erteilung einer Prozessvollmacht zugunsten eines Dritten. Im vorliegenden Fall konnten der Vater und die Mutter bei Antragstellung für ihre noch minderjährigen Kinder das gemeinschaftliche Vertretungsrecht jedoch nicht ohne Bestellung eines Ergänzungspflegers dahingehend ausüben, dass dem Vater als Rechtsanwalt Prozessvollmacht erteilt wurde.
Minderjährige Antragsteller können insoweit nicht von Vater und Mutter vertreten werden, als nach § 1795 BGB ein Vormund von der Vertretung des Kindes ausgeschlossen ist. Das Vertretungsverbot des § 1795 Abs. 1 Nr. 1 BGB ist nur dann unanwendbar, wenn das getätigte Rechtsgeschäft dem Mündel bzw. Kind lediglich einen rechtlichen Vorteil bringt (zu dieser Ausnahme vgl. BGH FamRZ 1975, 480 f.; Götz, in Palandt BGB 77. Aufl. 2018 § 1795 Rdn. 4). Bei der Einordnung als rechtlich vorteilhaft oder nachteilhaft kommt es nicht auf die wirtschaftlichen Folgen des Geschäfts, sondern dessen rechtliche Wirkungen an. Einseitige Rechtsgeschäfte können zwar im Einzelfall rechtlich vorteilhaft sein (Müller in: Erman, BGB, 15. Aufl. 2017, § 107 BGB, Rn. 4 und J. Lange in: Herberger/Martinek/Rüßmann/Weth/Würdinger, jurisPK-BGB, 8. Aufl. 2017, § 107 BGB, Rn. 17 mit Beispielen, etwa der Kündigung eines zinslosen Darlehens, oder der Mahnung). Die Erteilung einer Vollmacht ist aber regelmäßig nicht als lediglich rechtlich vorteilhaft und deshalb nach § 107 BGB zustimmungsbedürftig anzusehen, weil sie dem Bevollmächtigten die Rechtsmacht verleiht, Verpflichtungen zu Lasten des Minderjährigen zu begründen (J. Lange in: jurisPK-BGB a.a.O., § 111 BGB, Rn. 9). Der Ausnahmefall einer Spezialvollmacht zur Vornahme eines lediglich rechtlich vorteilhaften Rechtsgeschäfts (dazu J. Lange in jurisPK-BGB a.a.O. § 107 BGB, Rn. 18) liegt hier nicht vor.
Sieht man in der Erteilung der Prozessvollmacht namens des Minderjährigen ein für den Minderjährigen nicht lediglich rechtlich vorteilhaftes Geschäft (zur Beurteilung als nachteilig LG München I, Beschluss vom 31. Juli 2015 – 5 HKO 16371/13 –, Rn. 101, juris; ebenso KG Berlin, Beschluss vom 12. März 2012 – 4 Ws 17/12 –, Rn. 3, für eine Vollmacht im Strafprozess), dann ergibt sich aus § 1629 Abs. 2 BGB, dass weder die Ehefrau des Antragstellers Ziff. 22 und Mutter der minderjährigen Antragsteller (wegen §§ 1629 Abs. 2, 1795 Abs. 1 Nr. 1 BGB) ihrem Ehemann noch der Antragsteller Ziff. 22 als Vater sich selbst (wegen §§ 1629 Abs. 2, 1795 Abs. 2, 181 BGB) namens der Kinder Prozessvollmacht erteilen konnte (a.A. LG München a.a.O.). Beide Eltern waren daher auch gemeinschaftlich ohne Bestellung eines Ergänzungspflegers an der Erteilung einer Prozessvollmacht namens der minderjährigen Kinder gehindert. Dies führt gem. § 180 Satz 1 BGB zur (unheilbaren) Unwirksamkeit der Prozessvollmacht.Für eine Genehmigung der Verfahrenshandlungen durch einen im Nachgang bestellten Pfleger (dazu Götz, in Palandt a.a.O. § 1795 Rn. 14) ist nichts ersichtlich. Eine nachträgliche Genehmigung durch die betroffenen Antragsteller selbst nach Eintritt der Volljährigkeit kommt in Bezug auf die Prozesserklärungen, die gestützt auf die unwirksame Prozessvollmacht erklärt wurden (insbesondere: Antragstellung innerhalb der Antragsfrist), schon wegen § 180 Satz 1 BGB nicht in Betracht (vgl. Schulte-Bunert in: Erman, BGB, 15. Aufl. 2017, § 1795 BGB, Rn. 14). Die Antragsgegnerin hat bereits in der Antragserwiderung die Unwirksamkeit der Vollmachtserteilung gerügt und aus diesem Grunde die Zurückweisung der Anträge beantragt. Der Mangel der Prozessvollmachten der hier betroffenen Antragsteller Ziff. 21 und 23 ist nicht heilbar (wie hier schon LG Stuttgart, Beschluss vom 22. Mai 2017 – 31 O 26/14 KfH SpruchG zu einem anderen minderjährigen Mitglied der Familie der Antragsteller). Der Annahme einer konkludenten Neuvornahme der Antragstellung steht die inzwischen abgelaufene Antragsfrist (§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SpruchG) entgegen.
b. Antragstellerin Ziff. 3
Auch die Antragstellerin Ziff. 3 war zum Zeitpunkt der Antragstellung minderjährig. Aus der Antragsschrift geht hervor, dass sie durch ihre Eltern (gesetzlich) vertreten werde. Dabei handelt es sich um die Antragsteller Ziff. 2 und 4 (Bl. 1 d.A.). Insoweit gelten dieselben Bedenken wie bei den Antragstellern Ziff. 21 und 23: Vor Antragstellung namens der Antragstellerin Ziff. 3 hätte gemäß §§ 1629 Abs. 2, 1795 Abs. 2, 181 BGB ein Ergänzungspfleger bestellt werden müssen, was nicht geschehen ist. Der Mangel ist nicht heilbar, der Antrag unzulässig.
III. Antragsfrist
Sämtliche verfahrenseinleitende Anträge der Antragsteller sind bis zum Ablauf der Antragsfrist am 02. März 2015 beim Landgericht Stuttgart eingegangen.
IV. Zwischenergebnis
Die Anträge der Antragsteller Ziff. 3, 21 und 23 sind unzulässig. Die Anträge der übrigen Antragsteller sind zulässig.
C.
Teilweise Begründetheit der zulässigen Anträge
I. Allgemeines
1. Unbeachtlichkeit des Einwands angeblicher formaler Berichtsmängel
Soweit einzelne Antragsteller (nicht näher konkretisierte und auch nicht ersichtliche) formale Mängel des gemäß § 293a AktG zu erstattenden Berichts behaupten, sind diese Rügen für das vorliegende Verfahren nicht entscheidungserheblich. Gegenstand des gerichtlichen Verfahrens nach §§ 304, 305 AktG i.V.m. § 1 Nr. 1 SpruchG wie auch des Berichts des sachverständigen Prüfers nach § 293b Abs. 1 AktG ist die Prüfung der Angemessenheit der Abfindung und des Ausgleichs, die der geschlossene und eingetragene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vorsieht (§ 293e Abs. 1 Satz 1 AktG).
Manche Antragsteller (etwa die Antragsteller Ziff. 28, 29, die auch in anderen Spruchverfahren als Antragstellerin auftreten, Bl. 180, 188 d.A.) sprechen bei ihrer auf formale Mängel bezogenen Rüge sogar vom „Übertragungsbericht“, obwohl es vorliegend nicht um einen „Squeeze Out“ geht. Diesbezüglich handelt es sich offenkundig um eine von diesen Antragstellern standardmäßig und pauschal in Spruchverfahren erhobene Rüge.
2. Verfahrensvoraussetzungen für die Bestimmung der angemessenen Abfindung erfüllt
Der gemäß § 293e Abs. 1 AktG zu erstattende Prüfungsbericht des vom Gericht bestellten sachverständigen Prüfers liegt vor, wie bereits ausgeführt. Die Parallelprüfung durch den von der Antragsgegnerin beauftragten Bewertungsgutachter und durch den vom Gericht bestellten sachverständigen Prüfer ist zulässig (OLG Stuttgart, Beschluss vom 03. Dezember 2008 – 20 W 12/08 –, Rn. 136, juris) und kein Indiz für mangelnde Sorgfalt bei der Prüfung. Der im vorliegenden Fall vorgelegte Prüfungsbericht und die ergänzende Erörterung in der mündlichen Verhandlung lassen erkennen, dass der sachverständige Prüfer eigenständige Analysen, Bewertungen und Berechnungen zur Plausibilisierung des Bewertungsgutachtens durchgeführt hat. Damit hat er seine Aufgabe erfüllt.
3. Grundsätze der Angemessenheitsprüfung
Ein Gewinnabführungsvertrag muss gemäß § 304 Abs. 1 Satz 1 AktG einen angemessenen Ausgleich für die außenstehenden Aktionäre durch eine auf die Anteile am Grundkapital bezogene wiederkehrende Geldleistung (Ausgleichszahlung) vorsehen. Außerdem muss der Vertrag die Verpflichtung des anderen Vertragsteils (also des beherrschenden Unternehmens) enthalten, auf Verlangen eines außenstehenden Aktionärs dessen Aktien gegen eine im Vertrag bestimmte angemessene Abfindung zu erwerben (§ 305 Abs. 1 Satz 1 AktG).
Ziel des Verfahrens ist nach §§ 304, 305 AktG die Feststellung, ob die im abgeschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vorgesehene Abfindung und der vorgesehene Ausgleich angemessen sind. Sollte dies nicht der Fall sein, muss das Gericht gemäß §§ 304 Abs. 3 Satz 3, 305 Abs. 5 Satz 2 AktG selbst auf Antrag den angemessenen Ausgleich bzw. die angemessene Abfindung bestimmen. Die Abfindung muss gemäß § 305 Abs. 3 Satz 2 AktG die Verhältnisse der Gesellschaft im Zeitpunkt des Hauptversammlungsbeschlusses über den Unternehmensvertrag berücksichtigen. Als Ausgleichszahlung ist gemäß § 304 Abs. 2 Satz 1 AktG mindestens die jährliche Zahlung des Betrags zuzusichern, der nach der bisherigen Ertragslage der Gesellschaft und ihren künftigen Ertragsaussichten unter Berücksichtigung angemessener Abschreibungen und Wertberichtigungen, jedoch ohne Bildung anderer Gewinnrücklagen, voraussichtlich als durchschnittlicher Gewinnanteil auf die einzelne Aktie verteilt werden könnte. Unabhängig davon, ob ein fester oder variabler Ausgleich gewählt wird, ist dabei der Tag der Hauptversammlung als Bewertungsstichtag maßgeblich, die über die Zustimmung zum Unternehmensvertrag entscheidet (Veil, in Spindler/Stilz AktG Kommentar 3. Aufl. 2015, § 304 Rn. 51).
a. Bewertung als Tatsachenfrage
Es gibt allerdings nicht „den einen exakten oder wahren Unternehmenswert“ und auch keine als „einzig richtig“ anerkannte Methode zur Ermittlung des Verkehrswerts einer Aktie, und es kann heute auch nicht festgestellt werden, dass eine der gebräuchlichen Methoden in der Wirtschaftswissenschaft unumstritten wäre (OLG Stuttgart, Beschluss vom 05. Juni 2013 – 20 W 6/10 –, juris Rn. 138). Die Wertermittlung nach den einzelnen Methoden ist mit zahlreichen prognostischen Schätzungen und methodischen Einzelentscheidungen verbunden, die aus juristischer Sicht jeweils nicht einem Richtigkeits-, sondern nur einem Vertretbarkeitsurteil zugänglich sind (OLG Stuttgart, Beschluss vom 04. Mai 2011 – 20 W 11/08 –, juris Rn. 67). Die Wertzumessung ist stets personen- und situationsbezogen (vgl. OLG Frankfurt, Beschluss vom 03. September 2010 – 5 W 57/09 –, juris Rn. 55).
Wie der BGH ausgeführt hat, enthalten weder das Grundgesetz noch das einfache Gesetz Bestimmungen, nach welcher Methode der Unternehmenswert zu ermitteln ist. „Die Frage nach der geeigneten Bewertungsmethode ist keine Rechtsfrage, sondern Teil der Tatsachenfeststellung und beurteilt sich nach der wirtschaftswissenschaftlichen oder betriebswirtschaftlichen Bewertungstheorie und –praxis“ (BGH, Beschluss vom 29. September 2015 – II ZB 23/14 –, Juris Rn. 12). Letztere eröffnet Bewertungsspielräume. Der Wert des Unternehmens ist nach §§ 287 Abs. 2 ZPO, 738 Abs. 2 BGB vom Gericht zu schätzen (BGH, Beschluss vom 12. März 2001 – II ZB 15/00 –, juris Rn. 20, 21; BGH, Beschluss vom 29. September 2015 – II ZB 23/14 –, Juris Rn. 12).
b. Methodik zur Ermittlung des Verkehrswerts
Das BVerfG hat in der bereits erwähnten Entscheidung von 1999 als Besonderheit des Aktieneigentums die Verkehrsfähigkeit der Aktie betont und ausgeführt: „Darin unterscheidet sich die Beteiligung an einer Aktiengesellschaft von anderen Unternehmensbeteiligungen. Vor allem trifft das auf Beteiligungen an börsennotierten Aktiengesellschaften zu, die es dem Gesellschafter, jedenfalls in Zeiten eines funktionierenden Kapitalmarktes, praktisch jederzeit erlauben, sein Kapital nach freiem Belieben zu investieren oder zu deinvestieren. Die Aktie ist aus der Sicht des Kleinaktionärs gerade deshalb so attraktiv, weil er sein Kapital nicht auf längere Sicht bindet, sondern sie fast ständig wieder veräußern kann“ (BVerfG, Beschluss vom 27. April 1999 – 1 BvR 1613/94 –, juris Rn. 55).
Anerkannt ist, dass bei einer börsennotierten Aktiengesellschaft neben der herkömmlichen, betriebswirtschaftlich anerkannten Ertragswertmethode auch die Heranziehung des Börsenkurses als alternative Bemessung in Betracht kommt. Ist nur ein Teil der Aktien börsennotiert, gilt das zumindest für börsennotierte Papiere (Koch, in Hüffer/Koch a.a.O. § 305 Rn. 36). Mit Blick auf die Verkehrsfähigkeit der Aktie darf ein existierender Börsenkurs bei der Ermittlung des Werts der Unternehmensbeteiligung nicht unberücksichtigt bleiben. Denn der Vermögensverlust, den der Minderheitsaktionär durch die Strukturmaßnahme erleidet, stellt sich für ihn als Verlust des Verkehrswerts der Aktie dar, und dieser Verkehrswert ist „regelmäßig mit dem Börsenkurs der Aktie identisch“ (BVerfG, Beschluss vom 27. April 1999 – 1 BvR 1613/94 –, juris Rn. 56, 60, 63). Das BVerfG hat in der Entscheidung von 1999 weiter ausgeführt, der Verkehrswert bilde die Untergrenze der „wirtschaftlich vollen Entschädigung“ (a.a.O. Rn. 63).
Der BGH hat daraus zunächst abgeleitet, dem außenstehenden Aktionär müsse „grundsätzlich mindestens der Börsenwert als Barabfindung“ gezahlt werden. Börsenwert der Aktie und daraus gebildeter „Börsenunternehmenswert“ könnten zwar „mit dem nach § 287 Abs. 2 ZPO ermittelten Unternehmenswert sowie der quotal darauf bezogenen Aktie“ übereinstimmen (Anmerkung: mit dem „nach § 287 Abs. 2 ZPO ermittelten Unternehmenswert sowie der quotal darauf bezogenen Aktie“ dürfte hier der anteilige Ertragswert gemeint sein). Mit Rücksicht auf „unterschiedliche Ansätze“ der Bewertung durch den Markt und der Wertermittlung durch sachverständige Begutachtung könnten diese Werte aber auch differieren. Nach dem Beschluss des BVerfG von 1999 sei der Minderheitsaktionär zum Verkehrswert der Aktie abzufinden, wenn dieser Wert höher sei als der Schätzwert. Wenn jedoch der Schätzwert höher sei als der Börsenwert, stehe dem Aktionär der „höhere Betrag des quotal auf die Aktie bezogenen Schätzwertes zu“ (BGH, Beschluss vom 12. März 2001 – II ZB 15/00 –, juris Rn. 17, 21 „DAT/Altana“). Das war so zu verstehen und wurde auch so verstanden, dass neben dem Börsenkurs als Untergrenze der Abfindung (vgl. OLG Frankfurt, Beschluss vom 05. Dezember 2013 – 21 W 36/12 –, juris Rn. 19) stets noch ein Wert „im Wege der Schätzung“ nach der Ertragswertmethode zu ermitteln sei.
Das BVerfG hat jedoch in zwei Entscheidungen von 2011 und 2012 noch einmal betont, dass es um den Betrag geht, den die Minderheitsaktionäre „bei einer freien Deinvestitionsentscheidung“ erhalten hätten, und klargestellt: Erstens ist die Anwendung der Ertragswertmethode verfassungsrechtlich nicht geboten. Zweitens kann „bei Einhaltung bestimmter Mindeststandards“ (das Gericht verweist insoweit auf die Rechtsprechung des OLG) auch eine Bewertung allein anhand des Börsenkurses genügen. Drittens haben die Minderheitsaktionäre keinen Anspruch darauf, dass der anteilige Wert ihres Aktieneigentums nach allen erdenklichen Methoden ermittelt und die angemessene Abfindung nach dem „Meistbegünstigungsprinzip“ festgestellt wird (BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 26. April 2011 – 1 BvR 2658/10 –, juris Rn. 23, 24; BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 16. Mai 2012 – 1 BvR 96/09, 1 BvR 117/09, 1 BvR 118/09, 1 BvR 128/09 –, juris Rn. 18; zur Ablehnung des „Meistbegünstigungsprinzips“ schon OLG Stuttgart, Beschluss v. 17. Oktober 2011 – 20 W 7/11 Seite 52 zur Abfindung und Ausgleichszahlung nach BGAV). c. Prüfungsschritte der Angemessenheitsprüfung Im Falle einer richterlichen Angemessenheitsprüfung obliegt es nach Auffassung der Kammer im ersten Schritt dem Tatrichter zu prüfen, ob die Unternehmensbewertung nach dem Bewertungsgutachten und dem Bericht des sachverständigen Prüfers „auf in der Wirtschaftswissenschaft anerkannten und in der Bewertungspraxis gebräuchlichen Methoden beruht“ (OLG Stuttgart, Beschluss vom 05. Juni 2013 – 20 W 6/10, Rn. 148). Dazu gehört auch, ob die von diesem vorgenommene Bewertung methodisch konsistent ist, ob die inhaltlichen Prämissen der Bewertung zugrunde gelegt werden können, ob der Börsenkurs berücksichtigt wurde, und ob die zugrunde liegenden Daten und Zukunftseinschätzungen fachgerecht abgeleitet wurden (vgl. Steinle/Liebert/Katzenstein, MünchHdb GesR 5. Aufl. Bd. 7 § 34 Rn. 89 ff.; Singhof, in Spindler/Stilz, a.a.O. § 327c Rn. 10 zum „Squeeze Out“). Ist das der Fall, so bilden das Gutachten und der Bericht eine hinreichende Schätzgrundlage, so dass die Angemessenheit der vom Hauptaktionär angebotenen Abfindung bejaht werden kann (OLG Stuttgart, a.a.O. Rn. 148). Das gilt selbst dann, wenn die vom Bewertungsgutachter und dem sachverständigen Prüfer herangezogene Methode aus Sicht des Gerichts „nicht optimal“, aber „angemessen, geeignet und vertretbar“ ist (vgl. OLG Frankfurt, Beschluss vom 03. September 2010 – 5 W 57/09 –, juris Rn. 35).
Das OLG Stuttgart hat ausgeführt (OLG Stuttgart, Beschluss vom 05. Juni 2013 – 20 W 6/10 –, juris Rn. 141): „Das Gericht ist im Rahmen seiner Schätzung des Verkehrswertes des Aktieneigentums nicht gehalten, darüber zu entscheiden, welche Methode der Unternehmensbewertung und welche methodische Einzelentscheidung innerhalb einer Bewertungsmethode richtig sind. Vielmehr können Grundlage der Schätzung des Anteilswerts durch das Gericht alle Wertermittlungen sein, die auf in der Wirtschaftswissenschaft anerkannten und in der Bewertungspraxis gebräuchlichen Bewertungsmethoden sowie methodischen Einzelfallentscheidungen beruhen, auch wenn diese in der wissenschaftlichen Diskussion nicht einhellig vertreten werden.“ Es ist nicht Aufgabe des Spruchverfahrens, einen Beitrag zur Klärung von in der Betriebswirtschaftslehre umstrittener Fragen zu leisten oder zu entscheiden, welcher der in den Wirtschaftswissenschaften zu einzelnen Aspekten des Ertragswertverfahrens vertretenen Auffassungen der Vorzug gebührt (OLG Stuttgart, Beschluss vom 17. Juli 2014 – 20 W 3/12 –, juris Leitsatz und Rn. 81; vgl. auch KG Berlin, Beschluss vom 14. Januar 2009 – 2 W 68/07 –, Rn. 36, juris). Daran ist auch nach der BGH-Entscheidung vom 29. September 2015 - II ZB 23/14 festzuhalten.
Ergibt sich hingegen im ersten Prüfungsschritt die fehlende Plausibilität der Bewertung und hieraus resultierend die Unangemessenheit der angebotenen Abfindung bzw. des Ausgleichs, so muss das Gericht im zweiten Prüfungsschritt selbst die angemessene Abfindung bzw. den angemessenen Ausgleich bestimmen. In diesem zweiten Prüfungsschritt muss der Tatrichter im Spruchverfahren selbst eine geeignete und aussagekräftige Bewertungsmethode wählen, die gewährleistet, dass die Abfindung „nicht unter dem Verkehrswert“ der Aktie liegt (BGH, Beschluss v. 29. September 2015 - II ZB 23/14, Rn. 34).
d. Marktorientierte Bewertung versus Ertragswertmethode
Manche Gerichte sind der Auffassung, dass die marktorientierte Bewertung eines börsennotierten Unternehmens anhand von Börsenkursen nicht ausreicht, weil der Börsenkurs „stets nur als Mindestwert einer angemessenen Barabfindung anzusehen“ sei und gegebenenfalls ein höherer, nach dem Ertragswertverfahren berechneter Wert als Abfindung zugesprochen werden müsse (LG München I, Beschluss vom 28. April 2017 – 5 HK O 26513/11 –, juris Rn. 189 – in einem Fall, in dem das Gericht den Börsenkurs offenbar für aussagekräftig hielt, vgl. Rn. 183 ff.).
Die Kammer hat bereits in einem anderen Verfahren (31 O 136/15 KfH SpruchG, Beschluss vom 03. April 2018 – in juris veröffentlicht) ausführlich begründet, dass zur Prüfung und Wahl der Bewertungsmethodik auch die tatrichterliche Beurteilung gehört, ob eine allein am Börsenkurs orientierte Abfindung im zu entscheidenden Einzelfall angemessen ist (vgl. dazu BGH Beschluss vom 29. September 2015, II ZB 23/14 Rn. 33), und dass das auszuübende Schätzungsermessens nach § 287 Abs. 2 ZPO auch die Freiheit umfasst, anstelle der Ertragswertmethode im geeigneten Einzelfall eine kapitalmarktorientierte Bewertung zum Börsenkurs vorzunehmen (OLG Stuttgart, Beschluss vom 05. Juni 2013 – 20 W 6/10 –, juris Rn. 138 ff., 143; OLG Stuttgart, Beschluss vom 04. Mai 2011 – 20 W 11/08 –, juris Rn. 67; OLG Frankfurt, Beschluss vom 03. September 2010 – 5 W 57/09 –, juris Rn. 35 ff., 52 ff.; im Grundsatz auch OLG Frankfurt, Beschluss vom 05. Dezember 2013 – 21 W 36/12 –, juris Rn. 24, einschränkend jedoch bei nicht aussagekräftigem, weil im entschiedenen Fall durch öffentliche Angebote verzerrtem Börsenkurs).
Die Kammer ist sich bewusst, dass die Bewertung nach der Ertragswertmethode mit Plausibilisierungen und Schätzungen arbeiten muss. Die Methode ist mit zahlreichen Unschärfen behaftet (so schon OLG Frankfurt, Beschluss vom 09. Dezember 2008 – WpÜG 2/08 –, juris Rn. 57). Kern des Ertragswertverfahrens ist die Diskontierung prognostizierter künftiger Erträge, deren Höhe aber nicht bekannt ist, die also nur aufgrund der bisherigen Erträge, der Unternehmensplanungen und allgemeinen Einschätzungen der Zukunft geschätzt werden können. Der Ertragswertmethode, ob nun in Gestalt des CAPM oder des Tax-CAPM, wird in der Literatur vorgeworfen, dass die gebräuchlichen Berechnungsmodelle aufgrund ihrer Bedingungen, die nur in einer idealen Modellwelt Gültigkeit hätten, eine „pseudo-mathematische Exaktheit“ vortäuschten. Die Konsequenz könne zum Schutz der außenstehenden Aktionäre nur darin liegen, „sich wo immer möglich an Marktpreisen zu orientieren“ (Emmerich, in Emmerich/Habersack, Aktien- und GmbH-Konzernrecht 8. Aufl. 2016, § 305 AktG Rn. 41a, 41b, 69b).
Bei einer Ertragswertberechnung etwa nach Tax-CAPM ist bei vielen Parametern eine ganze Bandbreite von Werten (insbesondere bei der Marktrisikoprämie) vertretbar und angemessen, ohne dass ein in die Formel eingesetzter Wert als allein „richtig“ und zu einem einzig zutreffenden „wahren Unternehmenswert“ führen würde. Bereits marginale Änderungen etwa beim Basiszins oder der Marktrisikoprämie können erhebliche Auswirkungen auf das Ergebnis der Ertragswertberechnung haben (vgl. auch dazu OLG Stuttgart, Beschluss vom 17. Juli 2014 – 20 W 3/12 –, Rn. 79, juris). In der Literatur wird deshalb vertreten, dass die Bewertung anhand „realistischer“, also aussagekräftiger Börsenkurse anstelle der Ertragswertmethode trotz verbreiteter Einwände der Betriebswirtschaftslehre vorzugswürdig erscheine (Emmerich, in Emmerich/Habersack, Aktien- und GmbH-Konzernrecht 8. Aufl. 2016, § 305 Rn. 41c).
Dennoch bleibt die Ertragswertmethode nach IDW S 1 i.d.F. 2008 eine in der Wirtschaftswissenschaft anerkannte und in der Bewertungspraxis gebräuchliche, deshalb auch anerkannte und zulässige Bewertungsmethode (OLG Stuttgart, Beschluss vom 17. Juli 2014 – 20 W 3/12 –, juris Rn. 85; OLG Stuttgart, Beschluss vom 02. Dezember 2014 – 20 AktG 1/14 –, Rn. 78, juris; vgl. auch BGH, Beschluss vom 21. Juli 2003 – II ZB 17/01 – , Rn. 7, juris).
4. Maßgeblicher Bewertungsstichtag
Maßgeblicher Bewertungsstichtag ist der Tag des dem Vertrag zustimmenden Hauptversammlungsbeschlusses, also der 15. Juli 2014. II. Angemessenheitsprüfung unter Berücksichtigung der Entscheidung des BGH vom 07. November 2017. Nach Auffassung der Kammer ist der Umstand, dass beim Zweiten Übernahmeangebot eine Gegenleistung von 23,50 EUR pro Aktie angeboten wurde, bei der Angemessenheitsprüfung der Abfindung nach § 305 Abs. 1 AktG von Bedeutung. Die Kammer hat darüber hinaus geprüft, ob auch die BGH-Entscheidung vom 07. November 2017 die im vorliegenden Verfahren vorzunehmende Beurteilung der Angemessenheit der Abfindung nach § 305 Abs. 1 AktG beeinflusst. Nach dieser bereits erwähnten Entscheidung (vgl. oben A. I. 2.) stehen denjenigen Aktionäre, die das Zweite Übernahmeangebot angenommen haben, „Nachzahlungsansprüche“ in Höhe des Differenzbetrages zu 30,95 EUR pro Aktie zu.
Nach Auffassung der Kammer steht den außenstehenden Aktionären im vorliegenden Fall aufgrund der Besonderheiten des vorliegenden Falles gemäß § 305 Abs. 1 AktG eine Abfindung in Höhe von mindestens 23,50 EUR pro A-Aktie zu. Mit der BGH-Entscheidung lässt sich hingegen nicht begründen, dass den außenstehenden Aktionären, die ihre Aktien nicht angedient haben, wegen des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages eine Abfindung in Höhe von mindestens 30,95 EUR pro A- Aktie zustünde.
1. Überblick
Zu unterscheiden sind zwei Fragenkomplexe: Zum einen geht es um die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen eine im Rahmen eines Übernahmeangebots tatsächlich angebotene Gegenleistung (§ 31 Abs. 1 WpÜG) für die Prüfung der Angemessenheit einer Barabfindung anlässlich einer zeitlich nachfolgenden aktienrechtlichen Strukturmaßnahme wie etwa dem Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages von Bedeutung ist (dazu unten 2. bis 5.). Zum andern geht es um die Frage, wie im vorliegenden Fall zu bewerten ist, dass die tatsächlich im Rahmen des Zweiten Übernahmeangebots angebotene Gegenleistung unangemessen im Sinne der übernahmerechtlichen Bestimmungen war (dazu unten 6.).
Hervorzuheben ist zunächst, dass es zahlreiche vom Gesetzgeber und von der Rechtsprechung entwickelte Parallelen der Bestimmung der angemessenen Gegenleistung eines öffentlichen Übernahmeangebots und der angemessenen Abfindung wegen des Abschlusses eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages gibt (dazu unten 2.), aber auch Unterschiede in Bezug auf die Frage, ob und wie „Vorerwerbe“ bzw. außerbörsliche Erwerbe berücksichtigt werden. Im Unterschied zu den klareren Vorgaben im Übernahmerecht ist bei aktienrechtlichen Strukturmaßnahmen umstritten, ob und in welchen Fällen bezahlte Vorerwerbspreise bei der Bewertung des Unternehmens bzw. der Aktien und bei der Bestimmung der angemessenen Abfindung zu berücksichtigen sind. Im vorliegenden Fall kann die Kammer offen lassen, ob mit der wohl überwiegenden Meinung in Rechtsprechung und Literatur generell daran festzuhalten ist, dass es bei der Ermittlung der angemessenen Abfindung nach aktienrechtlichen Strukturmaßnahmen auf außerbörslich (vom Mehrheitsaktionär) bezahlte Vorerwerbspreise regelmäßig nicht ankomme (dazu unten 3.).
Einer Berücksichtigung der Höhe der tatsächlich im Rahmen des Zweiten Übernahmeangebots offerierten Gegenleistung bei der Angemessenheitsprüfung gemäß § 305 Abs. 1 AktG steht die mehrheitlich angenommene Irrelevanz von Vorerwerbspreisen jedenfalls im vorliegenden Sonderfall nicht entgegen. Geht dem Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages im zeitlichen Abstand von nur wenigen Wochen ein an alle außenstehenden Aktionäre gerichtetes, nicht unter weiteren Vollzugsbedingungen stehendes freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot des Mehrheitsaktionärs voraus, und hat der Mehrheitsaktionär bereits vor der Veröffentlichung des Übernahmeangebots Zugriff auf mindestens 75% der Stimmrechte und kann deshalb mit seiner qualifizierten Hauptversammlungsmehrheit den Abschluss des schon zu diesem Zeitpunkt angestrebten Unternehmensvertrages – wenn auch unter Einhaltung entsprechender Einladungsfristen – jederzeit herbeiführen, dann indiziert die Höhe der gemäß § 31 Abs. 1 WpÜG anzubietenden angemessenen Gegenleistung beim Übernahmeangebot auch den Mindestbetrag pro Aktie, den der Mehrheitsaktionär den außenstehenden Minderheitsaktionären anlässlich des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages als Abfindung nach § 305 Abs. 1 AktG anbieten muss (dazu unten 4.). Die Gewährung einer noch höheren Abfindung nach § 305 Abs. 1 AktG schließt das nicht aus, wenn der unter Ertragswertgesichtspunkten ermittelte „wahre“ Wert am für den Unternehmensvertrag maßgeblichen Bewertungsstichtag den Wert der angemessenen „übernahmerechtlichen“ Gegenleistung übersteigt, der sich nach den Maßstäben des § 31 Abs. 1, 4 und 5 WpÜG i.V.m. WpÜGAngebV ergibt, oder wenn der durchschnittliche Börsenkurs im Referenzzeitraum bis zur Bekanntgabe der Maßnahme noch höher ist als die im Rahmen des Übernahmeangebots angebotene Gegenleistung.
Stellt man im vorliegenden Fall auf die den Minderheitsaktionären beim Zweiten Übernahmeangebot tatsächlich angebotene Gegenleistung ab, und ignoriert man zunächst die im vorliegenden Fall festgestellte übernahmerechtliche Unangemessenheit der Gegenleistung i.S.d. § 31 Abs. 1 WpÜG, so ergibt sich aus dem oben Gesagten, dass den Minderheitsaktionären anlässlich des Abschlusses des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mindestens 23,50 EUR als Abfindung gemäß § 305 Abs. 1 AktG – und nicht die tatsächlich angebotenen 22,99 EUR pro Aktie – hätten angeboten werden müssen (vorbehaltlich eines höheren Ertragswerts) (dazu unten 5.).
Obwohl feststeht, dass die im Rahmen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots angebotene Gegenleistung nicht angemessen im Sinne des § 31 WpÜG war (vgl. BGH, Urteil vom 07. November 2017 – II ZR 37/16), sieht die Kammer aber keine tragfähige Begründung dafür anzunehmen, dass sich der Mehrheitsaktionär im Hinblick auf den Abfindungsanspruch nach § 305 Abs. 1 AktG auch von den außenstehenden Aktionären, die das Übernahmeangebot nicht angenommen haben, so behandeln lassen müsste, als hätte er ein gesetzeskonformes Übernahmeangebot unterbreitet, also eine Gegenleistung von 30,95 EUR pro Aktie offeriert (dazu unten 6.).
Die Kammer lässt ausdrücklich offen, ob die für Vor-, Nach- und Parallelerwerbe geltenden übernahmerechtlichen Maßstäbe des § 31 WpÜG i.V.m. §§ 4, 5 WpÜGAngebV auch in Fällen aktienrechtlicher Strukturmaßnahmen zur Prüfung der Angemessenheit einer Abfindung herangezogen werden können, in denen der Strukturmaßnahme kein Übernahmeangebot vorausgeht.
Im Einzelnen:
2. Parallelen der „Angemessenheit“ der Gegenleistung / Abfindung nach WpÜG und AktG
Es gibt zahlreiche vom Gesetzgeber und von der Rechtsprechung entwickelte Parallelen der Bestimmung der angemessenen Gegenleistung eines öffentlichen Übernahmeangebots und der angemessenen Abfindung wegen des Abschlusses eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages.
a. Angemessenheit
§ 31 Abs. 1 Satz 1 WpÜG verlangt für ein öffentliches Übernahmeangebot eine angemessene“ Gegenleistung. Der im vorliegenden Fall einschlägige § 304 Abs. 1 AktG verlangt beim Abschluss eines BGAV einen „angemessenen Ausgleich“. Beide Regelungen stellen damit auf die „Angemessenheit“ ab.
b. Relevanz von Börsenkursen
Sowohl bei der Bestimmung der angemessenen Gegenleistung nach § 31 Abs. 1 WpÜG als auch bei der Angemessenheitsprüfung einer Abfindung wegen des Abschlusses eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages sind Börsenkurse grundsätzlich von Bedeutung. Im Übernahmerecht ergibt sich das bereits aus dem Gesetz und der gesetzeskonkretisierenden WpÜGAngebV (unten aa). Für die Angemessenheit der Abfindung wegen des Abschlusses eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages fehlt zwar eine gesetzliche Regelung, die die Berücksichtigung von Börsenkursen vorschreiben und näher konkretisieren würde. Der in Börsenkursen regelmäßig zum Ausdruck kommende Verkehrswert ist jedoch aus verfassungsrechtlichen Gründen bei der Angemessenheitsprüfung zu berücksichtigen (unten bb).
aa.
§ 31 Abs. 1 WpÜG gilt nur für die Bestimmung der Gegenleistung bei einem öffentlichen Übernahmeangebot. Der durchschnittliche Börsenkurs ist bei der Bestimmung der angemessenen Gegenleistung gemäß § 31 Abs. 1 Satz 2 WpÜG zu berücksichtigen (ausdrückliche gesetzliche Regelung, konkretisiert durch § 5 WpÜGAngebV, insbesondere § 5 Abs. 1 WpÜGAngebV – Mindesthöhe des Angebots bei inländischer Börsenzulassung: gewichteter Durchschnittskurs der letzten drei Monate vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen Übernahmeangebots, §§ 10 Abs. 1, 35 WpÜG).
bb.
Bei Abfindungen, die wegen des Abschlusses eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zu bezahlen sind (§ 305 Abs. 1 AktG), gilt: Der von der Strukturmaßnahme betroffene Minderheitsaktionär muss zum Verkehrswert der Aktie entschädigt werden, und dieser Verkehrswert ist „regelmäßig mit dem Börsenkurs der Aktie identisch“ (BVerfG, Beschluss vom 27. April 1999 – 1 BvR 1613/94 –, juris Rn. 56, 60, 63; zum Ganzen LG Stuttgart, Beschluss vom 03. April 2018 – 31 O 138/15 KfHSpruchG –, Rn. 72 ff., juris). Von der reinen Stichtagsbetrachtung hat der BGH dabei Abstand genommen und nach entsprechender Kritik des OLG Stuttgart (OLG Stuttgart, Beschluss vom 18. Dezember 2009 – 20 W 2/08 –, juris Rn. 97 ff.; vgl. schon Stilz, ZGR 2001, 875 ff., 888) und des OLG Düsseldorf (auf dessen Vorlage hin entschieden wurde) im Jahr 2010 seine ursprüngliche Auffassung zur Bestimmung des Referenzzeitraums aufgegeben und entschieden, dass es auf den nach Umsatz gewichteten Durchschnittskurs im Dreimonatszeitraum „vor der Bekanntmachung der Strukturmaßnahme“ ankomme (BGH, Beschluss vom 19. Juli 2010 – II ZB 18/09 –, BGHZ 186, 229 ff., „Stollwerck“, Rn. 21, 22; vgl. LG Stuttgart, Beschluss vom 03. April 2018 – 31 O 138/15 KfHSpruchG –, Rn. 168, juris).
Zur Begründung hat der BGH ausgeführt, der Tag der Hauptversammlung sei als Stichtag für das Ende des Referenzzeitraums nicht geeignet, weil der Börsenkurs im Zeitraum davor regelmäßig von den erwarteten Abfindungswerten wesentlich mitbestimmt werde und bei einer Bemessung der Abfindung aufgrund dieser Referenzperiode nicht mehr der Verkehrswert der Aktie entgolten werde. „Von der Mitteilung der angebotenen Abfindung“ an, also spätestens mit der Einberufung der Hauptversammlung, die in aller Regel innerhalb des Dreimonatszeitraums liegt, nähere sich der Börsenwert dem angekündigten Abfindungswert. Dabei werde der Kurs in der Erwartung eines Aufschlags im Spruchverfahren oder - als Lästigkeitswert - im Anfechtungsprozess häufig leicht überschritten. Der angebotene Preis für die Aktie werde sicher erreicht. Aber auch schon vor der Bekanntgabe des Abfindungsangebots ändere sich „mit der Bekanntgabe der Maßnahme“ die Börsenbewertung, weg von der Orientierung am möglichen künftigen Unternehmenswert hin zur Erwartung an die künftige Abfindung. Das führe nicht selten zu „heftigen Kursausschlägen“, weil „der Phantasie in beide Richtungen keine Grenzen gesetzt seien“. Mit der Bekanntgabe der Abfindungshöhe beginne „die Spekulation auf den Lästigkeitswert“. Nach Bekanntgabe der Strukturmaßnahme bilde sich der Börsenkurs nicht mehr „aus Angebot und Nachfrage unter dem Gesichtspunkt des vom Markt erwarteten Unternehmenswertes“. Er widerspiegele dann vielmehr den Preis, „der gerade wegen der Strukturmaßnahme erzielt werden kann“, und die „durch die Strukturmaßnahme geweckte besondere Nachfrage“. Diese Nachfrage habe aber „mit dem Verkehrswert der Aktie, mit dem der Aktionär für den Verlust der Aktionärsstellung so entschädigt werden soll, als ob es nicht zur Strukturmaßnahme gekommen wäre, ... nichts zu tun“ (BGH, a.a.O., Rn. 23).
Solange die Kapitalmarktforschung keine noch besser geeigneten Anhaltspunkte entwickle, sei also der nach dem gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs während der letzten drei Monate vor der Bekanntmachung, die nicht notwendig eine Bekanntmachung im Sinne des § 15 WpHG sein müsse, für die Bestimmung des Börsenwertes maßgeblich (BGH, Beschluss vom 19. Juli 2010 – II ZB 18/09 –, BGHZ 186, 229 ff., „Stollwerck“, Rn. 10 ff., 23).
In einer Entscheidung, die in einem Spruchverfahren nach Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages ergangen ist, hat der BGH die Festlegung des Dreimonatszeitraums auf den Zeitraum vor der Bekanntgabe der Strukturmaßnahme noch einmal bekräftigt (BGH, Beschluss vom 28. Juni 2011 – II ZB 2/10 –, juris Rn. 8). cc. Fazit: Der gewichtete durchschnittliche Börsenkurs wird sowohl im Übernahmerecht als auch bei der Bestimmung der angemessenen Abfindung wegen eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages regelmäßig auf einen Dreimonatszeitraum bezogen. Dieser Dreimonatszeitraum endet regelmäßig zum Zeitpunkt der Information des Kapitalmarkts über die Absicht, ein öffentliches Übernahmeangebot abzugeben, bzw. über die Absicht, mit der betroffenen Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abzuschließen.
c. Bedeutung der Unternehmensbewertung nach Ertragswertgesichtspunkten
Bei der Ermittlung der angemessenen Abfindung wegen des Abschlusses eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages nach § 305 Abs. 1 AktG wird regelmäßig eine Unternehmensbewertung durchgeführt, die in fast allen Fällen insbesondere eine Begutachtung des Ertragswerts umfasst, aber auch den Börsenkurs einbezieht.
Das Übernahmerecht geht, wie aus § 31 Abs. 1 Satz 1 WpÜG und § 5 Abs. 1 bis 3 WpÜGAngebV hervorgeht, vom durchschnittlichen gewichteten Börsenkurs als Mindestwert aus. Für den Sonderfall, dass innerhalb des bereits erwähnten Dreimonatszeitraums kein ausreichend liquider Aktienhandel bestand, regelt § 5 Abs. 4 WpÜGAngebV: „Sind für die Aktien der Zielgesellschaft während der letzten drei Monate vor der Veröffentlichung nach § 10 Abs. 1 Satz 1 oder § 35 Abs. 1 Satz 1 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes an weniger als einem Drittel der Börsentage Börsenkurse festgestellt worden und weichen mehrere nacheinander festgestellte Börsenkurse um mehr als 5 Prozent voneinander ab, so hat die Höhe der Gegenleistung dem anhand einer Bewertung der Zielgesellschaft ermittelten Wert des Unternehmens zu entsprechen.“ Damit verweist die WpÜGAngebV bei Vorliegen dieser Besonderheiten auf die erforderliche Durchführung einer Unternehmensbewertung. Eine solche Unternehmensbewertung unter Ertragswertgesichtspunkten stellt bei Strukturmaßnahmen wie etwa dem Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages den Regelfall dar.
3. Übernahmerechtliche und aktienrechtliche Behandlung von „Vorerwerbspreisen“
Es stellt sich die Frage, ob vom Bieter bzw. Mehrheitsaktionär bezahlte Vorerwerbspreise Auswirkungen auf die den übrigen Aktionären anzubietende „angemessene“ Kompensation haben, ob die Höhe derartiger Vorerwerbspreise also das „Angemessenheitsurteil“ beeinflussen. Bei der Beantwortung dieser Frage sind in Rechtsprechung und Literatur beträchtliche Unterschiede zwischen Übernahmerecht einerseits (dazu a.) und aktienrechtlichen Strukturmaßnahmen wie etwa dem Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags andererseits (dazu b.) festzustellen.
a. Übernahmerechtliche Situation
Übernahmerechtlich sind gemäß § 31 Abs. 1 Satz 2 WpÜG bei der Bestimmung der angemessenen Gegenleistung nicht nur die Börsenkurse während des bereits erwähnten Dreimonatszeitraums vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des (freiwilligen) Übernahmeangebots, sondern auch Vorerwerbe des Bieters und der mit ihm gemeinsam handelnden Personen zu berücksichtigen. § 4 WpÜGAngebV konkretisiert das wie folgt: „Die Gegenleistung für die Aktien der Zielgesellschaft muss mindestens dem Wert der höchsten vom Bieter, einer mit ihm gemeinsam handelnden Person oder deren Tochterunternehmen gewährten oder vereinbarten Gegenleistung für den Erwerb von Aktien der Zielgesellschaft innerhalb der letzten sechs Monate vor der Veröffentlichung der Angebotsunterlage nach Gestattung durch die BAFin (§ 14 Abs. 2 Satz 1 WpÜG) oder § 35 Abs. 2 Satz 1 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes entsprechen.“
Im Übernahmerecht sind aber nicht nur Börsenkurse und (auch außerbörslich bezahlte) Vorerwerbspreise relevant, sondern auch sogenannte Parallel- und Nacherwerbe. Diejenigen Aktionäre, die das Übernahmeangebot annehmen, werden durch § 31 Abs. 4 und Abs. 5 WpÜG geschützt, wonach der Bieter bei Parallel- oder Nacherwerben die Differenz zwischen dem Angebotspreis und dem bei dem Parallel- oder Nacherwerb erzielten Preis an diese Aktionäre zahlen muss (Anspruch auf den „Unterschiedsbetrag“).
§ 31 Abs. 4 WpÜG regelt den Fall von „Parallelerwerben des Bieters“ und mit ihm gemeinsam handelnder Personen oder deren Tochterunternehmen nach der Veröffentlichung der Angebotsunterlage (Wackerbarth, in MüKo AktG 4. Aufl. 2017 § 31 Rn. 2) bis zur Veröffentlichung nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpÜG, die der Bieter unverzüglich nach Ablauf der Annahmefrist vornehmen muss. Rechtstechnisch werden bereits geschlossene Verträge (zwischen dem Bieter und den das öffentliche Übernahmeangebot annehmenden Aktionären) automatisch kraft Gesetzes zugunsten der Aktionäre geändert, indem an die Stelle des öffentlich angebotenen Preises die erhöhte Gegenleistung tritt, die der Bieter auch bei dem anderweitigen Parallelerwerb bezahlt hat (Wackerbarth, a.a.O. § 31 WpÜG Rn. 75). Der Adressat des öffentlichen Übernahmeangebots, der dieses zum niedrigeren öffentlich angebotenen Preis angenommen hat, muss also nicht vom Vertrag zurücktreten, sondern erhält „automatisch“ die höhere Gegenleistung.
Für den Fall eines außerbörslichen „Nacherwerbs“, also des Erwerbs innerhalb eines Jahres nach Ende der Angebotsfrist (Wackerbarth, a.a.O. § 31 WpÜG Rn. 3) zu höheren Preisen als der in der Angebotsunterlage angebotenen Gegenleistung, verschafft § 31 Abs. 5 WpÜG den ehemaligen Aktionären, die ihre Aktien auf das Übernahmeangebot eingeliefert haben, einen einklagbaren Anspruch auf Geldzahlung in Höhe des Differenzbetrages zwischen der ihnen gewährten Gegenleistung und späteren Gegenleistungen des Bieters für den Erwerb von Wertpapieren an der Zielgesellschaft (Wackerbarth, in MüKo a.a.O. § 31 Rn. 78).
§ 31 WpÜG und §§ 4, 5 WpÜGAngebV konkretisieren den in § 3 Abs. 1 WpÜG allgemein formulierten Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre der Zielgesellschaft. Diesen konkretisierten „übernahmerechtlichen“ Gleichbehandlungsgrundsatz hat der Gesetzgeber wegen der engen zeitlichen Vorgaben bei Übernahmeverfahren und aus Gründen der Rechtssicherheit aufgestellt, um (in den meisten Fällen) eine schnelle und zuverlässige Bestimmung der Mindestgegenleistung zu ermöglichen (Begr. RegE, BT- Drucks. 14/7034, S. 55 f.; Krause in: Assmann/Pötzsch/Uwe H. Schneider, WpÜG, 2. Aufl. 2013, § 31 WpÜG, Rn. 4).
Grundsätzlich werden bei § 31 Abs. 3 bis 5 WpÜG nur solche Vorgänge berücksichtigt, bei denen der Bieter das dingliche Eigentum an den Wertpapieren erhält. „Erwerb“ meint also den Erwerb des Aktieneigentums, nicht lediglich den Abschluss entsprechender Kaufverträge. § 31 Abs. 6 WpÜG stellt dem jedoch Vereinbarungen gleich, auf Grund derer der Bieter die Übereignung von Aktien verlangen kann. Gemeint sind damit alle Formen aufschiebend befristeter oder betagter Verpflichtungen zur Übertragung der Aktien auf den Erwerber (Wackerbarth, in MüKo a.a.O. § 31 WpÜG Rn. 32a, 84). § 31 Abs. 6 WpÜG sorgt dafür, dass außerbörslich bezahlte Paketzuschläge sowohl bei freiwilligen als auch bei Pflichtangeboten unter gewissen Voraussetzungen den anderen Inhabern von Aktien, die das Angebot angenommen haben, ebenfalls zugute kommen (Emmerich, in Emmerich/Habersack Aktien-/GmbH-KonzernR 8. Aufl. 2016, § 305 Rn. 49).
Bereits im Sommer 2014 hat der BGH entschieden: Ist die vom Bieter im Rahmen eines Übernahmeangebots nach § 29 Abs. 1 WpÜG vorgesehene Gegenleistung von vornherein nicht angemessen im Sinne des § 31 Abs. 1 Satz 1 WpÜG, so haben die Aktionäre, die das Übernahmeangebot angenommen haben, einen Anspruch gegen den Bieter auf Zahlung der angemessenen Gegenleistung. Der BGH hat u.a. auf § 31 Abs. 4 und Abs. 5 WpÜG verwiesen und ausgeführt, dass „nur schwer verständlich“ wäre, wenn (lediglich) im Falle eines Parallel- oder Nacherwerbs des Bieters zu höheren Preisen als dem Preis des öffentlichen Übernahmeangebots (§ 31 Abs. 4 und 5 WpÜG) ein zivilrechtlicher Anspruch bestünde, nicht aber dann, wenn die angebotene Gegenleistung von vornherein unangemessen ist. Das spricht für einen zivilrechtlich durchsetzbaren Anspruch auf Zahlung des Differenzbetrages zwischen der angebotenen und der angemessenen Gegenleistung (BGH, Urteil vom 29. Juli 2014 – II ZR 353/12 –, BGHZ 202, 180-202, Rn. 20 ff. „Postbank“). Dieser Anspruch steht allerdings, wie bereits hervorgehoben, nur denjenigen Aktionären zu, die das öffentliche Übernahmeangebot angenommen haben.
Mit Urteil vom 06. November 2017 hat der BGH zum Fall des Zweiten Übernahmeangebots von K bezüglich der A AG die bis dahin offene Streitfrage entschieden, ob im Rahmen des § 31 Abs. 6 WpÜG neben dem „originären“ Erwerb auch der „abgeleitete Erwerb“ von Wandelschuldverschreibungen bei der Berechnung der angemessenen Gegenleistung gemäß § 31 Abs. 1 und Abs. 6 Satz 1 WpÜG zu berücksichtigen ist. Der BGH hat die Rechtsfrage dahingehend entschieden, dass § 31 Abs. 6 WpÜG nicht nur schuldrechtliche Vereinbarungen erfasst, „auf Grund derer unmittelbar die Übereignung von Aktien verlangt werden kann“ (also etwa: Kaufverträge), sondern auch „Vereinbarungen, die nur die Grundlage für eine spätere Übereignung auf Grund eines Übereignungsverlangens bilden“ (also auch: mehraktige Vorgänge dahingehend, dass auf Grund der Vereinbarung zunächst Wandelschuldverschreibungen erworben werden, die auf ein gesondertes Wandlungsverlangen zum Abschluss eines Zeichnungsvertrages und in der Folge zur Übereignung der Aktien führen). § 31 Abs. 6 WpÜG dient demnach dem allgemeinen Umgehungsschutz. Der BGH kam vor diesem Hintergrund zu dem Ergebnis, dass die von der Antragsgegnerin im Zweiten Übernahmeangebot angebotene Gegenleistung in Höhe von 23,50 EUR pro Aktie nicht angemessen im Sinne von § 31 Abs. 1 WpÜG i.V.m. §§ 4, 5 WpÜGAngebV war. Im übernahmerechtlichen Sinne war maßgeblich der höchste, für den Erwerb der Wandelschuldverschreibungen bezogen auf eine Aktie gezahlte Betrag von 30,95 EUR, den die Antragsgegnerin innerhalb der Frist des § 4 Satz 1 WpÜGAngebV (also der Sechsmonatsfrist vor Veröffentlichung der Angebotsunterlage nach § 14 Abs. 2 Satz 1 WpÜG) bezahlt hatte (BGH, Urteil vom 07. November 2017 – II ZR 37/16 –, Rn. 14 ff., 35, juris). Die vier klagenden ehemaligen A-Aktionäre, die das öffentliche Übernahmeangebot zu 23,50 EUR pro Aktie angenommen hatten, konnten daher weitere 7,45 EUR pro Aktie verlangen.
In dem letztlich vom BGH abschließend entschiedenen Verfahren war zwischen den Parteien unstreitig, dass von einem bedingt durch die Wandelschuldverschreibungen höheren Preis von 30,95 EUR pro Aktie auszugehen war. Da die Wandelschuldverschreibungen zum Erwerb von Aktien ohne Gewinnbezugsrecht für das Jahr 2013 berechtigten, waren die von den klagenden ehemaligen Aktionären hingegebenen Aktien sogar noch mehr wert als die von der Antragsgegnerin auf Grund der Wandelanleihen erworbenen. Weil die klagenden Aktionäre jedoch nur den Differenzbetrag von 7,45 EUR pro Aktie verlangt hatten, konnte es das OLG Frankfurt in der vom BGH bestätigten Entscheidung dabei belassen, dass der den Klägern zustehende Mindestpreis „daher wenigstens den - geltend gemachten - Preis des geringwertigeren Vorerwerbs erreichen“ musste. Das fehlende Gewinnbezugsrecht für 2013 bei den über Wandelschuldverschreibungen erworbenen Aktien rechtfertige jedenfalls keinen Abschlag (OLG Frankfurt, Urteil vom 19. Januar 2016 – 5 U 2/15 –, Rn. 45, juris).
b. Meinungsstand bei aktienrechtlichen Strukturmaßnahmen
Es ist umstritten, ob und in welchen Fällen bei aktienrechtlichen Strukturmaßnahmen bezahlte Vorerwerbspreise bei der Bewertung des Unternehmens bzw. der Aktien und bei der Bestimmung der angemessenen Abfindung zu berücksichtigen sind.
aa.
Bei aktienrechtlichen Strukturmaßnahmen wie etwa dem Abschluss von Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen oder beim „Squeeze Out“ herrschte bislang die Auffassung vor, dass es hier im Gegensatz zur vom Gesetzgeber ausgeformten übernahmerechtlichen Situation (dazu oben a.) regelmäßig nur auf den anteiligen Unternehmenswert (i.d.R. nach dem Ertragswertverfahren berechnet) und den Börsenkurs, sofern repräsentativ, ankomme. Außerbörslich bezahlte (höhere) Vorerwerbspreise seien bei der Ermittlung der angemessenen Abfindung bei aktienrechtlichen Strukturmaßnahmen regelmäßig irrelevant (OLG Frankfurt, Beschluss vom 24. November 2011 – 21 W 7/11 –, Rn. 30, juris für eine am durchschnittlichen Börsenkurs orientierte Abfindung bei einem „Squeeze Out“; LG München I, Beschluss vom 30. Mai 2018 – 5 HK O 10044/16 –, Rn. 199, juris bei Übertragung nach § 62 Abs. 5 UmwG i.V.m. §§ 327a ff. AktG; LG München I, Beschluss vom 28. April 2017 – 5 HK O 26513/11 –, Rn. 191, juris).
Diese Auffassung wird damit begründet, dass die einschlägigen aktiengesetzlichen Normen – anders als § 4 WpÜGAngebV für das öffentliche Übernahmeangebot – keine wertunabhängige Berücksichtigung von Vorerwerbspreisen vorsehen und dass die Berücksichtigung solcher außerbörslicher Vorerwerbspreise auch verfassungsrechtlich nicht geboten sei. Die Frage, ob ein gezahlter Vorerwerbspreis im Einzelfall einen Anhalt für den „wahren“ Wert des Unternehmens bieten kann, wird entweder offengelassen (OLG Frankfurt, Beschluss vom 21. Dezember 2010 – 5 W 15/10 –, Rn. 95, juris unter Hinweis auf BT-Drs. 14/7034 S. 87) oder ausdrücklich verneint (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17. Dezember 2015 – I-26 W 22/14 (AktE) –, Rn. 58, juris: keine Aussage über den objektivierten Unternehmenswert zum Bewertungsstichtag). Das BVerfG hat in der „DAT/Altana“-Entscheidung, die die Beurteilung einer Abfindung nach Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags betraf, ausgeführt, dass es „von Verfassungs wegen keinen Bedenken“ begegne, „wenn von dem herrschenden Unternehmen tatsächlich gezahlte Preise für Aktien der abhängigen Gesellschaft bei der Bewertung des Anteilseigentums unberücksichtigt bleiben (BVerfG, Beschluss vom 27. April 1999 – 1 BvR 1613/94 –, Rn. 57, juris). Der Vermögensverlust, den der Minderheitsaktionär durch den Unternehmensvertrag oder die Eingliederung erleidet, stelle sich für ihn als Verlust des Verkehrswerts der Aktie dar. Dieser ist mit dem Börsenkurs der Aktie regelmäßig identisch. Ein existierender Börsenkurs dürfe deshalb bei der Ermittlung des Werts der Unternehmensbeteiligung nicht unberücksichtigt bleiben. Demgegenüber seien etwa „Paketzuschläge“ irrelevant, die der Mehrheitsaktionär bereit war oder ist, für Aktien zu bezahlen, die ihm zur Erlangung eines bestimmten Quorums noch fehlen. Der Preis, den ein Mehrheitsaktionär an die Minderheitsaktionäre für Aktien der gemeinsamen Gesellschaft zu zahlen bereit ist, habe zu dem „wahren“ Wert des Anteilseigentums in der Hand des Minderheitsaktionärs regelmäßig keine Beziehung. In ihm komme der Grenznutzen zum Ausdruck, den der Mehrheitsaktionär aus den erworbenen Aktien ziehen kann. Auch zu dem Verkehrswert des Aktieneigentums hätten außerbörslich gezahlte Preise regelmäßig keine Beziehung. Der überhöhte Preis, den der Mehrheitsaktionär im Interesse des Erwerbs fehlender Aktien zur Erreichung eines Quorums bezahlt, weil ihm sonst etwa die beabsichtigte Konzernierungsmaßnahme unmöglich wäre, sei nur „für den Mehrheitsaktionär bestimmend“, habe aber „für Dritte keine Bedeutung“. Aus Sicht des Minderheitsaktionärs sei der vom Mehrheitsaktionär außerbörslich bezahlte erhöhte Preis nur erzielbar, wenn es ihm gelingt, gerade seine Aktien an den Mehrheitsaktionär zu veräußern. Darauf habe er aber verfassungsrechtlich keinen Anspruch (BVerfG, Beschluss vom 27. April 1999 – 1 BvR 1613/94 –, Rn. 58 ff., juris).
In der Literatur wird die Ablehnung einer Verpflichtung zur Berücksichtigung von Vorerwerbspreisen oder Paketzuschlägen bei der Bestimmung der Abfindung nach aktienrechtlichen Strukturmaßnahmen auch mit der weiteren These begründet, dass zwischen dem Preis einzelner Aktien oder auch für Aktienpakete einerseits und dem Wert des Gesellschaftsunternehmens andererseits kein unmittelbarer Zusammenhang bestehe (Koch, in Hüffer/Koch AktG 13. Aufl. 2018, § 305 Rn. 31).
bb.
Das OLG Düsseldorf hat entschieden, dass im Falle eines 2010 beschlossenen „Squeeze Out“ ein zum Bewertungsstichtag mehr als drei Jahre zurückliegendes, vom Mehrheitsaktionär schon damals unterbreitetes öffentliches Übernahmeangebot ungeeignet erscheine, den Verkehrswert widerzuspiegeln (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17. Dezember 2015 – I-26 W 22/14 (AktE) –, Rn. 58, juris).
In dem vom BGH entschiedenen Fall der „Stollwerck AG“ war einem nach Mehrheitserwerb unterbreiteten Pflichtangebot vom September 2002 (zu 295 EUR pro Aktie) im April 2003 ein „Squeeze Out“-Beschluss (§§ 327a ff. AktG) gefolgt, der eine Übertragung der Aktien an den Mehrheitsaktionär gegen Barabfindung in gleicher Höhe (295 EUR pro Aktie) vorsah. Zur Beendigung eines Beschlussmängelstreits hatte sich der Mehrheitsaktionär verpflichtet, Minderheitsaktionären, die innerhalb einer bestimmten Frist auf die Durchführung eines Spruchverfahrens verzichteten, eine Barabfindung von 395 EUR pro Aktie zu zahlen. Dem BGH lag der Fall insbesondere mit Blick auf die Bestimmung des Referenzzeitraums zur Ermittlung des durchschnittlichen Börsenkurses vor (BGH Beschluss vom 19. Juli 2010 – II ZB 18/09 –, BGHZ 186, 229-242, Rn. 1, 2, 3). Der BGH entschied in Abweichung zu seiner bisherigen Rechtsprechung, dass der einer angemessenen Abfindung zugrunde zu legende Börsenwert der Aktie grundsätzlich aufgrund eines nach Umsatz gewichteten Durchschnittskurses innerhalb einer dreimonatigen Referenzperiode vor der Bekanntmachung einer Strukturmaßnahme zu ermitteln sei. Was den beim Pflichtangebot offerierten Betrag anbelange, verwies der BGH auf die einschlägigen Regelungen der §§ 4 Satz 1, 5 Abs. 1 WpÜGAngebV und führte in diesem Zusammenhang aus, dass die beim „Squeeze Out“ zu zahlende angemessene Abfindung sich nicht an den Preisen orientieren müsse, die vom Antragsgegner anderen Aktionären gezahlt werden oder wurden. Die Höhe des zur Beendigung des Beschlussmängelstreits einzelnen Aktionären unterbreiteten Vergleichsangebots (395 EUR pro Aktie) habe keine Auswirkungen auf die im Spruchverfahren zuzumessende Abfindung. Auf eine Gleichstellung der Antragsteller des Spruchverfahrens mit denjenigen Aktionären, denen der Mehrheitsaktionär im Wege des Vergleichs 395 EUR pro Aktie bei Verzicht auf Einleitung eines Spruchverfahrens versprochen habe, bestehe kein Anspruch, denn dieses Angebot habe unter der Bedingung gestanden, kein Spruchverfahren einzuleiten, und betreffe die Antragsteller des Spruchverfahrens somit nicht. Die Antragsteller des Spruchverfahrens hätten keinen Anspruch darauf, ebenfalls in den Genuss etwaiger ungerechtfertigter Sondervorteile zu kommen, selbst wenn das Vergleichsangebot solche Sondervorteile zugunsten der Adressaten enthalten sollte (BGH, Beschluss vom 19. Juli 2010 – II ZB 18/09 –, BGHZ 186, 229-242, Rn. 31, 32). cc. Demgegenüber vertreten Teile der Rechtsprechung und Literatur die Ansicht, Vorerwerbspreise seien auch bei aktienrechtlichen Strukturmaßnahmen zu berücksichtigen, weil auch eine sogenannte „Kontrollprämie“ Teil des Unternehmenswertes sei oder weil auch sie einen Marktpreis reflektierten. So hat das LG Köln in einem Spruchverfahren nach „Delisting“ ausgeführt, dass ein Paketzuschlag, der für die Erlangung der Unternehmenskontrolle gezahlt wird, zwangsläufig auf das Unternehmen bezogen sei und zwar möglicherweise nicht bei der „anteilsbezogenen Betrachtungsweise“ und dem Verkehrswert der einzelnen Aktie als Preis, den der Aktionär am Kapitalmarkt erzielen könne, wohl aber bei der Ermittlung des Verkehrswerts des gesamten Unternehmens berücksichtigt werden solle. Auch ein Verkehrswertgutachten eines Sachverständigen nach IDW S1 liefere keinen „besseren Verkehrswert“. Tatsächlich bezahlte Marktpreise bildeten den Verkehrswert unter üblichen Marktbedingungen zutreffend ab und hätten gegenüber mit zahlreichen fiktiven Annahmen arbeitenden und in der Prognose höchst fraglichen Sachverständigengutachten Vorrang (LG Köln, Beschluss vom 24. Juli 2009 – 82 O 10/08 –, Rn. 192 ff., juris).
Auch das LG Hannover hat sich bei der Prüfung und Festsetzung der Abfindung in einem Spruchverfahren nach einem „Delisting“ (Widerruf der Börsenzulassung zum Handel im amtlichen Markt auf Antrag der Gesellschaft, im konkreten Fall im Juli 2006) bei der Ermittlung des Unternehmenswerts an den Beträgen orientiert, die die Mehrheitsaktionärin aufgrund eines öffentlichen Übernahmeangebots den Stamm- und Vorzugsaktionären im Januar 2005 angeboten hatte. Das Gericht hat dabei die proportionale Mengenverteilung der Aktiengattungen berücksichtigt, den für jede angebotene Aktiengattung offerierten Preis mit der Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien pro Gattung multipliziert, die Werte addiert und die Summe wieder durch die Gesamtzahl aller ausgegebenen Aktien (unabhängig von der Gattung) dividiert, ohne Rücksicht darauf, dass der Mehrheitsaktionärin bei dem Übernahmeangebot tatsächlich viel weniger Aktien angeboten worden waren und sie bereits zuvor weitere Vorerwerbe getätigt hatte (LG Hannover, Beschluss vom 27. April 2011 – 23 AktE 130/06, juris Rn. 1, 2, 4, 117, 118, 137, 142).
Das LG Frankfurt hatte in einem Spruchverfahren zu entscheiden, in dem es um die Bestimmung der Abfindung nach „Squeeze Out“ (öffentliche Ankündigung im Juli 2012, Bewertungsstichtag im Dezember 2012) bei vorausgegangenem freiwilligem öffentlichem Übernahmeangebot (veröffentlicht im November 2010) ging. Zwar spielte der rund 2 Jahre vor dem „Squeeze Out“ angebotene Übernahmepreis letztlich keine Rolle, weil der gewichtete durchschnittliche Börsenkurs im Dreimonatszeitraum vor der öffentlichen Ankündigung höher war. Die Mehrheitsaktionärin hatte aber rund einen Monat vor der Veröffentlichung des Verlangens zum Ausschluss der Minderheitsaktionäre von verschiedenen Verkäufern nennenswerte Stückzahlen zu einem höheren Preis erworben, als sie den Minderheitsaktionären dann beim „Squeeze Out“ anbot. Das LG Frankfurt hat hervorgehoben, dass allen Gerichtsentscheidungen, in denen es abgelehnt wird, auf Vorerwerbe abzustellen, gemeinsam ist, dass nur eine Verpflichtung zur Orientierung an diesen Vorerwerbspreisen als Mindestabfindungshöhe abgelehnt wurde, dass es aber nicht ausgeschlossen sei, dass sich die angemessene Abfindung im Einzelfall daran orientieren kann. Das LG Frankfurt sprach den durch „Squeeze Out“ ausgeschlossenen Minderheitsaktionären in diesem Fall eine Abfindung in Höhe des höheren Vorerwerbspreises zu (LG Frankfurt, Beschluss vom 25. November 2014 – 3/5 O 43/13 – , Rn. 3, 5, 7, 83, juris).
Unter Verweis auf die soeben erwähnte Entscheidung des LG Frankfurt hält es Koch (in Hüffer/Koch a.a.O. § 305 Rn. 31) für zulässig, Vorerwerbspreise in Einzelfällen in richterliche Schätzung nach § 287 ZPO einfließen zu lassen.
Emmerich (in Emmerich/Habersack Aktien-/GmbH-KonzernR a.a.O., § 305 AktG Rn. 40) geht noch einen Schritt weiter. Er sieht in der Bevorzugung des regelmäßig im Wege des Ertragswertverfahrens unter Berücksichtigung von Börsenkursen ermittelten Grenzpreises und in der Ablehnung einer Beteiligung der außenstehenden Aktionäre an außerbörslich bezahlten Paketzuschlägen einen „klaren Verstoß gegen die Wertungen des § 738 BGB“ und des § 31 Abs. 6 WpÜG. § 738 Abs. 2 BGB bestimmt für die Auseinandersetzung einer BGB-Gesellschaft, dass der Wert des Gesellschaftsvermögens soweit erforderlich im Wege der Schätzung zu ermitteln ist. Emmerich plädiert für die Übertragung der übernahmerechtlichen Wertung des § 31 Abs. 6 WpÜG auf die Beurteilung einer Abfindung nach § 305 Abs. 1 AktG wegen eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages. Zur Begründung verweist er darauf, dass Börsenkurse (deren Berücksichtigung im Falle von Strukturmaßnahmen mittlerweile außer Frage steht, solange es sich um „aussagekräftige“ bzw. „repräsentative“ Börsenkurse handelt) nicht die einzigen „Marktpreise“ sind, an denen der Wert eines Unternehmens abgelesen werden kann. Einzelne Aktien und ganze „Aktienpakete“ können ebenso wie Unternehmen selbst an vielen Märkten gehandelt werden. Soweit solche Preise ermittelt werden können, müssen sie nach Auffassung von Emmerich gleichfalls bei der Bewertung von Unternehmen berücksichtigt werden.
Auch Schüppen/Tretter (in Frankfurter Kommentar WpÜG, § 327b AktG Rn. 16) plädiert für eine Einbeziehung von Vorerwerbs- bzw. Paketpreisen mindestens im Rahmen der Plausibilisierung des Ergebnisses des Ertragswertverfahrens und verweist darauf, dass in der Bewertungspraxis die nach dem Ertragswertverfahren oder dem DCF-Verfahren ermittelten Unternehmenswerte regelmäßig auf der Grundlage von Marktdaten plausibilisiert werden.
dd.
Verfassungsrechtliche Gesichtspunkte stehen einer fachgerichtlichen Berücksichtigung bei außerbörslichen Aktienerwerben vereinbarter „Vorerwerbspreise“ oder im Rahmen von Übernahmeangeboten angebotener Gegenleistungen bei der Angemessenheitsprüfung nicht entgegen.
Aus der Rechtsprechung des BVerfG ergibt sich lediglich, dass ein von einer aktienrechtlichen Strukturmaßnahme betroffener Aktionär verfassungsrechtlich keinen Anspruch darauf habe, eine Abfindung in Höhe außerbörslich bezahlter erhöhter Preise zu bekommen, weil er diesen erhöhten Preis nur hätte erzielen können, wenn es ihm gelungen wäre, gerade seine Aktien an den Mehrheitsaktionär zu veräußern (BVerfG, Beschluss vom 27. April 1999 – 1 BvR 1613/94 –, Rn. 58 ff.). Diese verfassungsrechtliche Beurteilung schließt es nicht aus, dass die Zivilgerichte im Rahmen der Anwendung einfachgesetzlicher Normen derartige außerbörslich bezahlte höhere Preise im Einzelfall im Wege der Schätzung nach § 287 Abs. 1 ZPO bei der Prüfung der Angemessenheit der Abfindung berücksichtigen (wie hier Koch in Hüffer/Koch a.a.O. § 305 Rn. 31; vgl. auch LG Köln, Beschluss vom 24. Juli 2009 – 82 O 10/08 –, Rn. 192 ff., juris; LG Frankfurt, Beschluss vom 25. November 2014 – 3/5 O 43/13 –, Rn. 83, juris). Hiervon haben, wie dargestellt, auch in der Vergangenheit Gerichte in Spruchverfahren bereits Gebrauch gemacht, gerade auch in Bezug auf dem abfindungsrelevanten Vorgang vorausgegangene öffentliche Übernahmeangebote und in Abgrenzung zum niedrigeren mithilfe der Ertragswertmethode ermittelten Unternehmenswert (LG Hannover, Beschluss vom 27. April 2011 – 23 AktG 130/06 Rn. 122 ff., 126 ff., 136 ff.).
Auch die Kammer macht im vorliegenden Sonderfall von der Möglichkeit Gebrauch, die übernahmerechtlichen Besonderheiten im Rahmen der Schätzung der angemessenen Abfindung (§ 287 Abs. 1 ZPO) einfließen zu lassen.
ee.
Die aufgeworfene Streitfrage, die zunächst von den Fachgerichten zu lösen ist, bedarf im vorliegenden Fall keiner Entscheidung. Jedenfalls im vorliegenden Sonderfall sprechen die besseren Argumente dafür, die beim Zweiten Übernahmeangebot angebotene Gegenleistung von 23,50 EUR zu berücksichtigen (dazu sogleich unten 4.). 4. Relevanz der im Übernahmeangebot tatsächlich angebotenen Gegenleistung Für die Berücksichtigung der im Rahmen des Zweiten Übernahmeangebots tatsächlich angebotenen Gegenleistung von 23,50 EUR pro Aktie sprechen im vorliegenden Fall – neben der bereits angesprochenen zulässigen richterlichen Schätzung (§ 287 ZPO) allgemein – folgende besonderen Gesichtspunkte:
- erstens das Bestehen eines Anspruchs eines jeden Aktionärs während des Übernahmeangebots, dem Mehrheitsaktionär seine Aktien zur angebotenen Gegenleistung anzudienen, in Abgrenzung zu „freiwilligen“ außerbörslichen
„Paketerwerben“, bei denen der einzelne Minderheitsaktionär vom Mehrheitsaktionär keine Gleichbehandlung verlangen kann (unten a);
- zweitens die zeitliche Nähe zwischen der Phase des Zweiten Übernahmeangebots und dem Bewertungsstichtag (unten b);
- drittens die im vorliegenden Fall theoretisch gegebene Möglichkeit des Mehrheitsaktionärs, die notwendigen Schritte zum Abschluss eines wirksamen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit der Gesellschaft bereits während der Phase des Zweiten Übernahmeangebots – und sogar ohne dessen Durchführung – durchzuführen (unten c);
- viertens die Ausstrahlungswirkung übernahmerechtlicher Vorschriften (unten d). a. Abgrenzung zu „freiwilligen Erwerben“
Der im Rahmen des Zweiten Übernahmeangebots angebotene Preis pro Aktie ist gerade nicht vergleichbar mit einem klassischen „Vorerwerbspreis“, auf den sich ein Mehrheitsaktionär und ein Dritter im Rahmen einer Transaktion verständigen, die der Mehrheitsaktionär nicht mit den übrigen Minderheitsaktionären in Bezug auf deren Aktienbesitz „wiederholen“ muss. Vielmehr hatten alle außenstehenden Aktionäre während der Geltung des Zweiten Übernahmeangebots einen sich aus dem WpÜG ergebenden Anspruch, ihre Aktien zu dem angebotenen Preis von 23,50 EUR dem Mehrheitsaktionär andienen zu können.
Der bereits erwähnte Fall „DAT/Altana“, der dem BVerfG zur Beurteilung aus verfassungsrechtlicher Sicht vorlag und in dem das BVerfG zur verfassungsrechtlichen Irrelevanz außerbörslich bezahlter erhöhter (Paket-)Preise gelangte (vgl. oben 3. b. aa), zeichnet sich hingegen dadurch aus, dass die Minderheitsaktionäre vor Abschluss des dortigen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages keinen zivilrechtlich begründbaren Anspruch hatten, dem beherrschenden Unternehmen ihre Aktien zu demselben (höheren) Preis anzudienen, zu dem dieses Aktienpakete von Dritten mit Paketzuschlägen erworben hatte. Ein Anspruch der Minderheitsaktionäre, dem beherrschenden Unternehmen ihre Aktien (überhaupt) gegen Barabfindung andienen zu können, entstand im Fall „DAT/Altana“ erst mit Abschluss des den Abfindungsanspruch auslösenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags.
Im Unterschied dazu hat sich die Antragsgegnerin im vorliegenden Fall im Januar / Februar 2014 entschlossen, allen Aktionären ein neues Übernahmeangebot zu unterbreiten. Dieses Zweite Übernahmeangebot stand im Gegensatz zum ersten, gescheiterten nicht unter weiteren Vollzugsbedingungen. Es war verbindlich, galt unbedingt und unabhängig von der Frage, ob und wie viele andere Aktionäre es annehmen würden. Jeder A-Aktionär konnte das Übernahmeangebot letztlich bis zum Ablauf der weiteren Annahmefrist am 22. April 2014 annehmen; die Antragsgegnerin konnte die Andienung nicht einzelnen annehmenden Aktionären gegenüber ablehnen. Mit der Annahme des Übernahmeangebots durch den Aktionär entstand jeweils ein vertraglicher Anspruch auf die angebotene Gegenleistung. Mit der übernahmerechtlich eingeräumten befristeten Möglichkeit, bis 22. April 2014 jederzeit einen Kaufvertrag zum Angebotspreis abzuschließen, verlieh die Antragsgegnerin faktisch jedem außenstehenden Aktionär eine befristet unentziehbare Rechtsposition, die bewertungsrelevant ist. Darin liegt zugleich die Rechtfertigung, die im Rahmen des Übernahmeangebots zu bezahlende Gegenleistung zumindest für diesen Zeitraum als Ausdruck des (Mindest-)Verkehrswerts der Aktie anzusehen. Während der Angebotsphase war klar, dass der Börsenkurs den angebotenen Preis für die Aktie „sicher erreicht“ (vgl. BGH, Beschluss vom 19. Juli 2010 – II ZB 18/09 –, Rn. 23).
Das Vorliegen annahmefähiger Vertragsangebote gerichtet an alle außenstehenden Aktionäre im Wege des öffentlichen Übernahmeangebots begründet den auch verfassungsrechtlich relevanten Unterschied zur Frage der Berücksichtigung außerbörslich an Dritte bezahlter Vorerwerbspreise bei einer aktienrechtlichen Strukturmaßnahme ohne vorausgegangenes öffentliches Übernahmeangebot: Während im erstgenannten Fall (Übernahmeangebot) ein Anspruch auf Gleichbehandlung und Andienung der Aktien zu dem Angebotspreis besteht, besteht im zweitgenannten Fall (außerbörsliche Vorerwerbe mit vereinbarten „Paketzuschlägen“) gerade kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Sinne eines Rechts zur Andienung zum selben Preis.
Auch ging es beim Zweiten Übernahmeangebot gerade nicht um einen außerbörslich bezahlten, subjektiv motivierten „Paketzuschlägen“ für den Erwerb von Aktienpaketen, die der Mehrheitsaktionär erwerben möchte, um ein bestimmtes Stimmrechtsquorum zu erreichen. Es richtete sich und musste sich wegen der dem Bieter vom Gesetz auferlegten Pflicht zur Gleichbehandlung unterschiedslos und unabhängig von der gehaltenen Beteiligungshöhe an alle Aktionäre richten. Zugleich liegt darin auch die entscheidende Abgrenzung zu der Konstellation, über die der BGH in der bereits erwähnten „Stollwerck“-Entscheidung zu befinden hatte (BGH, Beschluss vom 19. Juli 2010 – II ZB 18/09 – BGHZ 186, 229 ff., Rn. 31, 32). Dort ging es, wie dargestellt (3. b. bb), um die Frage der Relevanz eines Vergleichsangebots, das Anfechtungsklägern im Rahmen eines Beschlussmängelstreits unterbreitet worden war für den Fall, dass sie auf Einleitung eines Spruchverfahrens verzichteten. Das dortige Vergleichsangebot richtete sich nur an eine spezifische, eng umgrenzte Gruppe von Aktionären. Die übrigen Aktionäre, an die es nicht adressiert war, konnten sich konsequenterweise im Spruchverfahren nicht auf die Höhe dieses Vergleichsangebots berufen. Im Unterschied dazu konnten sich im Fall „A“ alle Aktionäre auf das Zweite Übernahmeangebot berufen, hätten es annehmen können, hatten mithin Anspruch auf Andienung und bei Andienung auch Anspruch auf Bezahlung der angebotenen Gegenleistung.
Die vorliegende Entscheidung der Kammer steht damit weder im Widerspruch zur Entscheidung des BVerfG in Sachen „DAT/Altana“ noch zur „Stollwerck“-Entscheidung des BGH noch zu obergerichtlichen Entscheidungen, die eine Relevanz „gewöhnlicher“ Vorerwerbs- oder Paketpreise für die Bestimmung der Abfindung anlässlich von Strukturmaßnahmen verneinen. Die nach diesen Entscheidungen tragenden Gründe, die in den entschiedenen Fällen gegen die zwingende Berücksichtigung „freiwillig“ vereinbarter Vorerwerbs- oder Paketpreise bei der Unternehmensbewertung angeführt wurden, treffen jedenfalls im vorliegenden Sonderfall gerade nicht zu. Denn vorliegend bestand – für alle Aktionäre gleichermaßen – während der Dauer des Zweiten Übernahmeangebots ein rechtlich durchsetzbarer und wertprägender Anspruch auf Abschluss eines Kaufvertrages zu einem Kaufpreis von 23,50 EUR pro angelieferter Aktie.
b. Zeitliche Nähe zum Bewertungsstichtag
Auch die zeitliche Nähe zwischen dem Ablauf der Annahmefrist des Zweiten Übernahmeangebots und dem Bewertungsstichtag spricht im vorliegenden Fall für die Berücksichtigung der angebotenen Gegenleistung im Rahmen des § 287 Abs. 1 ZPO bei der Angemessenheitsprüfung der Abfindung anlässlich des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages.
Im Unterschied zu dem vom OLG Düsseldorf entschiedenen Fall (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17. Dezember 2015 – I-26 W 22/14 AktE) lag das öffentliche Übernahmeangebot im vorliegenden Fall nicht mehr als drei Jahre vor der Strukturmaßnahme, um die es hier geht. Bewertungsstichtag für die Bestimmung der Abfindung und des Ausgleichs wegen des Abschlusses des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages ist der Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung über die Zustimmung zu diesem Vertrag am 15. Juli 2014. Das Zweite Übernahmeangebot mit dem gesetzwidrig zu niedrigen Angebotspreis von 23,50 EUR (der aber immer noch höher lag als die wenig später im Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag angebotene Abfindung von 22,99 EUR pro Aktie) wurde nur wenige Monate zuvor am 28. Februar 2014 veröffentlicht und konnte bis 02. April 2014 und im Anschluss innerhalb der weiteren Annahmefrist vom 08. April 2014 bis 22. April 2014 angenommen werden (Bl. 504, 1126 d.A.; Vertragsbericht Seite 2).
Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass sich die Vermögens- und Ertragslage der A AG zwischen dem 22. April 2014 und dem Bewertungsstichtag 15. Juli 2014 oder der objektive Unternehmenswert der A AG grundlegend verändert hätte. Die Nichtberücksichtigung des Zweiten Übernahmeangebots ließe sich daher nicht mit mangelnder Aktualität begründen.
Schon deshalb steht das Stichtagsprinzip der Berücksichtigung der beim Zweiten Übernahmeangebot tatsächlich angebotenen Gegenleistung von 23,50 EUR nicht entgegen, wenngleich am Bewertungsstichtag 15. Juli 2014 die weitere Annahmefrist für das Zweite Übernahmeangebot bereits abgelaufen war.
Das vorliegende Verfahren betrifft allerdings ausschließlich Aktionäre, die das Zweite Übernahmeangebot zu den veröffentlichten Konditionen (23,50 EUR pro Aktie) nicht angenommen haben. Sie konnten es nach Ablauf der Annahmefrist auch nicht mehr annehmen. Ein Vertrag zwischen ihnen und der Antragsgegnerin ist weder zu den im Zweiten Übernahmeangebot genannten Konditionen (23,50 EUR pro Aktie) noch zu den kraft Gesetzes „angepassten“ Konditionen (30,95 EUR pro Aktie) zustande gekommen, anders als bei denjenigen Aktionären, die das Zweite Übernahmeangebot zu dem (zu niedrigen, nach übernahmerechtlichen Gesichtspunkten nicht angemessenen) Preis angenommen haben und die jetzt einen zusätzlichen Anspruch auf den Differenzbetrag haben.
Entscheidend aber sind zwei Aspekte: Erstens hätten alle Aktionäre, die das Zweite Übernahmeangebot nicht angenommen haben, es annehmen können. Die Antragsgegnerin hätte die Andienung akzeptieren und den offerierten Preis für sämtliche ihr angedienten Aktien bezahlen müssen. Das betraf Aktionäre mit Kleinstbeteiligungen ebenso wie Aktionäre mit größeren Aktienpaketen oder solche, mit deren Hilfe die Antragsgegnerin über die Stimmrechtsschwelle von 95% kommen konnte. Das zeigt, dass es bei dem Zweiten Übernahmeangebot weder für die Antragsgegnerin noch für die betroffenen außenstehenden Aktionäre darum ging, „Paketzuschläge“ zu vereinbaren und zu zahlen. Bei der Entscheidung, das Zweite Übernahmeangebot zu veröffentlichen, waren der Antragsgegnerin die Aktien sämtlicher außenstehender Aktionäre offensichtlich „gleich viel wert“ – nämlich 23,50 EUR pro Aktie (ungeachtet des später noch zu erörternden Umstandes, dass sie teilweise sogar mehr, nämlich bis zu 30,95 EUR bezahlt hat).
Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass sich der anteilige Unternehmenswert von jedenfalls 23,50 EUR pro Aktie, von dem die Antragsgegnerin selbst bei Unterbreitung ihres Zweiten Übernahmeangebots ausgegangen ist, in der kurzen Zeitspanne zwischen dem Ablauf der Annahmefrist und dem Bewertungsstichtag reduziert hätte.
c. Sichere qualifizierte Hauptversammlungsmehrheit
Zweitens kommt im vorliegenden Fall die Besonderheit hinzu, dass die Antragsgegnerin schon zu dem Zeitpunkt, als sie das Zweite Übernahmeangebot veröffentlichte, sicher davon ausgehen konnte, dass aufgrund ihrer qualifizierten Stimmrechtsmehrheit in der Hauptversammlung der A AG der von ihr angestrebte, die hier streitgegenständliche Abfindungsansprüche auslösende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag die erforderliche Zustimmung finden würde. Der Umstand, dass diese Hauptversammlung erst am 15. Juli 2014 stattfand und deshalb den Bewertungsstichtag markiert, kann den Minderheitsaktionären nicht zum Nachteil gereichen, denn er beeinflusst den Unternehmenswert der A AG nicht. Von der Einhaltung von Formalien für die Hauptversammlungseinladung und von technischen Aspekten (depottechnische Behandlung der zur Annahme des Übernahmeangebots angelieferten Aktien) abgesehen, hätte die Hauptversammlung mit gleicher Aussicht auf das erfolgreiche Zustandekommen eines Zustimmungsbeschlusses zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag im Prinzip auch am 22. April 2014 oder davor, noch während des Laufs der Annahmefrist, stattfinden können.
Angesichts der Besonderheiten dieses Falles, die im Wege des § 287 Abs. 2 ZPO einbezogen werden, liegt in der Entscheidung der Kammer keine Abkehr vom Stichtagsprinzip.
d. Ausstrahlungswirkung nach übernahmerechtlichen Vorschriften
Dass ein Öffentliches Übernahmeangebot nicht bereits mit dem Ablauf der Annahmefrist jegliche Ausstrahlungswirkung in Bezug auf die Bewertung des Unternehmens verliert, ergibt sich bereits aus §§ 39a, 39c WpÜG. Nach einem Übernahme- oder Pflichtangebot sind dem Bieter, dem Aktien der Zielgesellschaft in Höhe von mindestens 95 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals gehören, gemäß § 39a Abs. 1 Satz 1 WpÜG auf seinen Antrag die übrigen stimmberechtigten Aktien gegen Gewährung einer angemessenen Abfindung durch Gerichtsbeschluss zu übertragen („übernahmerechtlicher Squeeze Out“). Stellt er diesen Antrag, muss die zu zahlende Abfindung gemäß § 39a Abs. 3 Satz 1 WpÜG der Gegenleistung des Übernahme- oder Pflichtangebots entsprechen. Selbst wenn der Bieter diesen Antrag nicht stellt, aber stellen könnte, weil die genannte Beteiligungsschwelle erreicht oder überschritten wurde, haben die Aktionäre, die das Übernahmeangebot nicht angenommen haben, in diesem Fall gemäß § 39c Satz 1 WpÜG noch ein dreimonatiges Andienungsrecht, können das Übernahmeangebot also nachträglich – nach Ablauf der Annahmefrist – innerhalb von drei Monaten doch noch annehmen.
Es ist nicht bekannt, ob die Antragsgegnerin im Rahmen des tatsächlich unterbreiteten Öffentlichen Übernahmeangebots eine Beteiligung von mindestens 95% der stimmberechtigten Aktien an der A AG erreicht hat. In diesem Fall hätten die verbliebenen Aktionäre das Übernahmeangebot noch innerhalb der weiteren Dreimonatsfrist des § 39c Satz 1 WpÜG, also bis zum 22. Juli 2014 und damit noch über den Bewertungsstichtag 15. Juli 2014 hinaus annehmen können. Auf die tatsächliche Frage, ob die 95%-Schwelle erreicht wurde oder bei gesetzeskonformem Angebot worden wäre, kommt es aber nicht entscheidend an. Die Wertungen des §§ 39a, 39c WpÜG zeigen, dass die Höhe einer im Rahmen eines Übernahmeangebots tatsächlich angebotenen Gegenleistung bei der Festlegung der Abfindung wegen des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages, dem die Hauptversammlung nur kurze Zeit später zugestimmt hat, nicht unberücksichtigt bleiben darf.
§ 31 Abs. 5 WpÜG steht der hier vorgenommenen Bewertung nicht entgegen. Außerbörsliche Nacherwerbe des Bieters, der mit ihm gemeinsam handelnden Personen oder deren Tochtergesellschaften innerhalb eines Jahres nach Ablauf der Angebotsfrist führen nach § 31 Abs. 5 Satz 1 WpÜG übernahmerechtlich zu einem Anspruch derjenigen Inhaber der Aktien, die das Angebot angenommen, auf Zahlung des „Unterschiedsbetrages“, wie bereits erwähnt. § 31 Abs. 5 Satz 2 WpÜG regelt als Ausnahme hiervon den Fall, dass der Bieter innerhalb der Jahresfrist weitere Aktien der Zielgesellschaft durch Verschmelzung, Spaltung oder Vermögensübertragung gegen Gewährung einer Abfindung an die Aktionäre erwirbt.
Die Regelung wird wie folgt interpretiert: Kommt es nach Ablauf der Annahmefrist des öffentlichen Übernahmeangebots etwa zu einem „Squeeze out“ gem. §§ 327a ff. AktG oder zu Maßnahmen nach dem UmwG, so bleiben die hierfür gewährten Abfindungszahlungen bei der Anwendung des § 31 Abs. 5 Satz 1 WpÜG außer Betracht. Selbst wenn sie höher sind als der Angebotspreis des öffentlichen Übernahmeangebots, bleibt es in diesem Fall dabei, d.h. den letzteres annehmenden Aktionären steht kein Anspruch auf den Differenzbetrag zu. Ebenso sollen Abfindungszahlungen im Rahmen eines Spruchverfahrens oder durch Abfindungsvergleich bei gerichtlicher Auseinandersetzung etwa beim Abschluss eines Beherrschungsvertrages mit der Zielgesellschaft außer Betracht bleiben (obwohl dieser Fall in § 31 Abs. 5 Satz 2 WpÜG nicht einmal ausdrücklich angesprochen ist). Zweck der Regelung sei zu vermeiden, dass der Bieter einem unkalkulierbaren Kostenrisiko aus einer übernahmerechtlichen Nachbesserungspflicht ausgesetzt ist, wenn er innerhalb des Nacherwerbszeitraumes eine der genannten Strukturänderungen (etwa einen „Squeeze Out“) durchführt (Wackerbarth, in MüKo a.a.O. § 31 WpÜG Rn. 80 m.w.N.).
Aus § 31 Abs. 5 Satz 2 WpÜG lässt sich aber nicht im Umkehrschluss entnehmen, dass ein Berücksichtigungsverbot des im Rahmen eines Übernahmeangebots gezahlten Preises für die entsprechenden aktienrechtlichen Abfindungszahlungen bestünde. § 31 Abs. 5 Satz 2 WpÜG schließt demnach nicht aus, die Höhe des im Rahmen eines öffentlichen Übernahmeangebots offerierten Preises bei der Kontrolle der Angemessenheit einer Abfindung nach § 304 Abs. 1 AktG wegen des Abschlusses eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zu berücksichtigen (Wackerbarth, in MüKo a.a.O. § 31 WpÜG Rn. 80).
Der Zweck des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes, eine schnelle und für die Beteiligten möglichst rechtssichere Abwicklung öffentlicher Marktransaktionen zu ermöglichen (vgl. BT-Drucks. 14/7034, S. 27), spricht schon nicht gegen einen zivilrechtlichen Anspruch der das Angebot annehmenden Aktionäre auf die tatsächlich angemessene, gesetzeskonforme Gegenleistung, weil die Durchführung der Transaktion an sich durch die sich anschließende zivilgerichtliche Überprüfung nicht gestört wird (BGH, Urteil vom 29. Juli 2014 – II ZR 353/12 –, BGHZ 202, 180-202, Rn. 25). Der Zweck des WpÜG und speziell des § 31 Abs. 1 WpÜG spricht daher erst Recht nicht gegen die Berücksichtigungsfähigkeit der angebotenen Gegenleistung im Rahmen eines zeitnah nach Ablauf der Annahmefrist abgeschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages bei der gerichtlichen Prüfung der in diesem Fall anzubietenden Abfindung (§ 305 Abs. 1 AktG).e. Abgrenzung zur Rechtsprechung bezüglich des Referenzzeitraums für Börsenkurse Gegen die vorstehenden Überlegungen sprechen angesichts der Besonderheiten des vorliegenden Falles auch nicht die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zur Bestimmung des Referenzzeitraums bezüglich des umsatzgewichteten durchschnittlichen Börsenkurses.
Für den Regelfall einer (einzigen) Strukturmaßnahme, die zu einem Anspruch der Minderheitsaktionäre führt, gegen angemessene Abfindung aus der Gesellschaft auszuscheiden, treffen die vom OLG Stuttgart angeführten und vom BGH übernommenen Erwägungen zu, die gegen eine Berücksichtigung von Börsenkursen nach der Bekanntgabe der beabsichtigten Strukturmaßnahme sprechen: Wenn diese Zeiten in die Referenzperiode einbezogen werden, spiegelt der ermittelte Börsenkurs nicht mehr - wie geboten - den Preis wider, den der Aktionär ohne die zur Entschädigung verpflichtende Intervention des Hauptaktionärs oder die Strukturmaßnahme erlöst hätte und der sich aus Angebot und Nachfrage unter dem Gesichtspunkt des vom Markt erwarteten Unternehmenswertes bildet. Der Börsenpreis widerspiegelt dann einen Preis, der gerade wegen der (abfindungspflichtigen) Strukturmaßnahme erzielt werden kann. Für die Entwicklung eines höheren Börsenkurses sorgt regelmäßig die durch die Strukturmaßnahme geweckte besondere Nachfrage. Mit dem Verkehrswert der Aktie, mit dem der Aktionär für den Verlust der Aktionärsstellung so entschädigt werden soll, als ob es nicht zur Strukturmaßnahme gekommen wäre, hat diese erhöhte, durch die Strukturmaßnahme ausgelöste Nachfrage nichts zu tun (BGH, Beschluss vom 19. Juli 2010 – II ZB 18/09 –, BGHZ 186, 229-242, Rn. 23 unter Hinweis auf OLG Stuttgart, ZIP 2007, 530, 533; ZIP 2010, 274, 278; Koch/Widders, Der Konzern 2007, 351, 353).
Diese Argumente treffen jedoch im vorliegenden Fall gerade nicht zu. Im vorliegenden Fall geht es um mehrere Maßnahmen: um ein Zweites Übernahmeangebot nach gescheitertem erstem Versuch und, sehr zeitnah dazu, um den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages.
Die Rechtsprechung hat für den Regelfall den Grundsatz entwickelt, dass es bezüglich der Börsenkursentwicklung nicht auf den Zeitraum zwischen Bekanntgabe des beabsichtigten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages und dem zustimmenden Hauptversammlungsbeschluss ankommt. Das betrifft hier den Zeitraum vom 23. Januar 2014 bis 15. Juli 2014. Genau in diesem Zeitraum lag hier jedoch das Zweite Übernahmeangebot (28. Februar 2014 bis 22. April 2014).
Entscheidend ist, dass es nach dem 23. Januar 2014 zu der dauerhaften Erreichung und sogar Überschreitung der 23,50 EUR pro Aktie auch dann gekommen wäre, wenn die Antragsgegnerin am 23. Januar 2014 nicht die Absicht zum Abschluss eines Beherrschungsvertrages bzw. die dazu mit der A AG geführten Verhandlungen veröffentlicht hätte.
Die Bekanntgabe der Absicht zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages einmal hinweggedacht, wäre die hypothetische Kursentwicklung während der Angebotsphase im vorliegenden Sonderfall allein maßgeblich vom Zweiten Übernahmeangebot geprägt gewesen. Das zeigt, dass die tatsächliche Kursentwicklung während der Angebotsphase hier gerade nicht das Ergebnis reiner Abfindungsspekulationen mit Blick auf den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag gewesen ist (letzteres wäre ein Effekt, der zu Recht bei der Angemessenheitsprüfung der Abfindung „eliminiert“ werden müsste). Nicht eine etwa erhöhte Nachfrage nach A-Aktien wegen der Ankündigung, einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag schließen zu wollen, und wegen damit verbundener Abfindungsspekulationen einiger Anleger, sondern die Höhe des Angebotspreises von 23,50 EUR pro Aktie wäre auch dann zur Überzeugung der Kammer in diesem Zeitraum an der Börse preisbestimmend gewesen. Das nicht unter Vollzugsbedingungen stehende, tatsächlich abgegebene Übernahmeangebot „sicherte“ den Verkehrswert der Aktien in Gestalt des Börsenkurses „nach unten“ ab – unabhängig von der Bekanntgabe oder Nichtbekanntgabe der Absicht zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages.
Erst nach endgültigem Ablauf der übernahmerechtlichen Annahmefrist (22. April 2014) konnten aufgrund des bevorstehenden Abschlusses des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages spekulative Erwägungen der Marktteilnehmer wegen der Abfindung nach § 305 AktG wieder mehr im Vordergrund stehen.
Lediglich dem Umstand der frühzeitigen, in der Hand der Antragsgegnerin liegenden Veröffentlichung der Absicht zum Abschluss des Beherrschungsvertrages (schon noch vor Veröffentlichung der Angebotsunterlage und fast sechs Monate vor der Hauptversammlung) ist geschuldet, dass bei Anwendung des im Regelfall heranzuziehenden Referenzzeitraums (23. Oktober 2013 bis 22. Januar 2014, entsprechend BGH, Beschluss vom 19. Juli 2010 – II ZB 18/09 –, BGHZ 186, 229-242 „Stollwerck AG“) die zeitlich nachgelagerte Phase des Zweiten Übernahmeangebots und die tatsächliche bzw. hypothetische Börsenkursentwicklung während dieser Zeit vollkommen außer Betracht blieb. Eine Verkehrswertermittlung während der Phase des Zweiten Übernahmeangebots mit einer allen Aktionären vorbehaltlos und ohne Vollzugsbedingungen angebotenen Gegenleistung von 23,50 EUR pro Aktie musste zwangsläufig einen Wert von mindestens 23,50 EUR ergeben. Die Abfindung nach § 305 Abs. 1 AktG muss aus verfassungsrechtlichen Gründen so bemessen sein, dass die Minderheitsaktionäre jedenfalls nicht weniger erhalten, als sie bei einer „freien Deinvestitionsentscheidung“ (zum Zeitpunkt der Strukturmaßnahme) erlangt hätten (BVerfG, Beschluss vom 27. April 1999 – 1 BvR 1613/94, Rn. 54, 56). Bei einer „freien Deinvestitionsentscheidung“ während der Phase des Zweiten Übernahmeangebots konnten alle Aktionäre mindestens den tatsächlichen Angebotspreis von 23,50 EUR pro Aktie erhalten, sei es an der Börse, sei es über die Einlieferung der Aktien auf das Übernahmeangebot. Dass als Bewertungsstichtag ein Hauptversammlungstermin wenige Wochen nach Ablauf der Annahmefrist gewählt wurde, kann den außenstehenden Aktionären im vorliegenden Sonderfall nicht zum Nachteil gereichen.
5. Zwischenergebnis: Mindestabfindung 23,50 EUR pro Aktie
Aufgrund der angesprochenen Besonderheiten des vorliegenden Falles ist im Ergebnis zunächst von einem Mindestabfindungsbetrag nach § 305 Abs. 1 AktG von 23,50 EUR pro Aktie wegen des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages auszugehen, unabhängig davon, dass die beim Zweiten Übernahmeangebot tatsächlich angebotene Gegenleistung von 23,50 EUR pro Aktie nicht einmal dem übernahmerechtlich angemessenen Mindestpreis entsprochen hat.
Sowohl das Bewertungsgutachten als auch der Prüfungsbericht des sachverständigen Prüfers erörtern zwar die Thematik, lassen aber im Ergebnis die beim Zweiten Übernahmeangebot tatsächlich angebotene Gegenleistung – nach Auffassung der Kammer aus Rechtsgründen zu Unrecht - unberücksichtigt. Die prozessuale Situation ist vergleichbar mit derjenigen, bei der im Rahmen der Prüfung gemäß § 293b Abs. 1 AktG ein aussagekräftiger Börsenkurs zu Unrecht unberücksichtigt bleibt und ein im Verhältnis niedrigerer Ertragswert als für die Abfindung maßgeblich behauptet wird (vgl. dazu Singhof, in Spindler/Stilz, a.a.O. § 327c Rn. 10 und oben I. 3. c). Der erste Prüfungsschritt der richterlichen Angemessenheitsprüfung führt hier zu einem negativen Ergebnis (oben I. 3. c) mit der Folge, dass das Gericht selbst die Höhe der angemessenen Abfindung nach § 305 Abs. 1 AktG zu schätzen hat. Im Wege der Schätzung gelangt die Kammer im vorliegenden Sonderfall zur Angemessenheit eines Abfindungsbetrages von mindestens 23,50 EUR pro Aktie. 6. Auswirkungen der fehlenden Gesetzeskonformität der angebotenen Gegenleistung nach § 31 Abs. 1 WpÜG i.V.m. §§ 4, 5 WpÜGAngebV Wie bereits ausgeführt, muss die Abfindung gemäß § 305 Abs. 1 AktG „angemessen“ sein und die Verhältnisse der Gesellschaft im Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung über den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag berücksichtigen. Die Kammer hat unter verschiedenen Gesichtspunkten geprüft, ob das Ergebnis des Zivilrechtsstreits, der mit der Entscheidung des BGH vom 07. November 2017 – II ZR 37/16 abgeschlossen wurde, für das vorliegende Spruchverfahren bedeutet, dass auch diejenigen Aktionäre, die das Übernahmeangebot nicht angenommen haben, wegen des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mindestens eine Abfindung in Höhe von 30,95 EUR pro A-Aktie beanspruchen können. Die Kammer verneint dies im Ergebnis. Dieses Ergebnis beruht – wiederum zunächst im Überblick - auf folgenden Erwägungen:
- unmittelbare übernahmerechtliche Rechtsfolgen der Unangemessenheit der angebotenen 23,50 EUR pro Aktie und der übernahmerechtlichen Angemessenheit von 30,95 EUR pro Aktie (unten a.)
- europarechtliche Überlegungen (unten b.)
- Voraussetzungen vorvertraglicher zivilrechtlicher Schadensersatzansprüche und Haftungsumfang (unten c.)
- Überlegungen zum tatsächlichen Börsenkursentwicklung nach der Bekanntgabe vom 23. Januar 2014 und zur hypothetischen Börsenkursentwicklung bei gesetzeskonformem Zweiten Übernahmeangebot (unten d.).
a. Übernahmerechtliche Rechtsfolgen
Wie vom OLG Frankfurt im Falle der vier Kläger entschieden und vom BGH bestätigt, war die angebotene Gegenleistung wegen Nichtberücksichtigung des Preises für aufgrund von Wandelschuldverschreibungen erworbenen Aktien nicht angemessen im Sinne von § 31 Abs. 1 WpÜG i.V.m. §§ 4, 5 WpÜGAngebV. Die vier klagenden Aktionäre, die das Angebot angenommen hatten, konnten und können zusätzlich zu den angebotenen 23,50 EUR die Zahlung des Differenzbetrages zur als angemessen anzusehenden Gegenleistung von 30,95 EUR verlangen (BGH, Urteil vom 07. November 2017 – II ZR 37/16 –, Rn. 14 ff., 35, juris; OLG Frankfurt, Urteil vom 19. Januar 2016 – 5 U 2/15; vgl. bereits BGH, Urteil vom 29. Juli 2014 – II ZR 353/12 –, BGHZ 202, 180-202, Rn. 20 ff. „Postbank“ zur möglichen Inanspruchnahme des Bieters bei einer unangemessen zu niedrigen Gegenleistung eines Übernahmeangebots).
Der zivilrechtliche Anspruch auf diesen Unterschiedsbetrag ergibt sich aus dem mit Angebotsannahme zustande gekommenen Vertrag und ergänzend aus §§ 31 Abs. 1, 4, 5 und 6 WpÜG analog (Santelmann/Nestler in: Steinmeyer, WpÜG, 3. Aufl. 2013, WpÜG § 31, Rn. 111). Wie bereits ausgeführt, kann man entsprechend § 31 Abs. 4 WpÜG dogmatisch von einem Fall der Vertragsänderung kraft Gesetzes (automatische Erhöhung der Gegenleistung) ausgehen (Wackerbarth, in MüKo AktG a.a.O. § 31 WpÜG Rn. 75). Der Anspruch der das Übernahmeangebot annehmenden Aktionäre auf den Unterschiedsbetrag stand und steht – Verjährungsfragen einmal dahingestellt – zusätzlich zur tatsächlich angebotenen Gegenleistung von 23,50 EUR pro Aktie jedem Aktionär zu, der das Zweite Übernahmeangebot angenommen hat.
Das vorliegende Verfahren betrifft allerdings ausschließlich Aktionäre, die das Zweite Übernahmeangebot zu den veröffentlichten Konditionen (23,50 EUR pro Aktie) nicht angenommen haben. Sie konnten es nach Ablauf der Annahmefrist nicht mehr annehmen. Ein Vertrag zwischen ihnen und der Antragsgegnerin ist weder zu den im Zweiten Übernahmeangebot genannten Konditionen (23,50 EUR pro Aktie) noch zu den kraft Gesetzes „angepassten“ Konditionen (30,95 EUR pro Aktie) zustande gekommen. Ihnen stand und steht deshalb zum Bewertungsstichtag auch kein Zahlungsanspruch in Höhe der Differenz von 7,45 EUR pro Aktie zu, der bei der Bewertung ihrer Aktien berücksichtigt werden könnte.
Hätte die Antragsgegnerin am 28. Februar 2014 ein gesetzeskonformes Übernahmeangebot über 30,95 EUR pro Aktie vorgelegt, so hätten zwar auch die vom vorliegenden Verfahren betroffenen Aktionäre, die tatsächlich keine Annahmeerklärung abgegeben und ihre Aktien auf das Übernahmeangebot nicht eingeliefert haben, entscheiden können, ob sie dieses modifizierte Angebot annehmen. Allein aus den Vorschriften des Übernahmerechts (insbesondere §§ 12, 31 Abs. 1 WpÜG) ergibt sich aber kein Anspruch dieser Aktionäre, nun wirtschaftlich so gestellt zu werden, als hätte die Antragsgegnerin ein gesetzeskonformes Übernahmeangebot zum übernahmerechtlich angemessenen Preis abgegeben. Das ist vielmehr eine Frage des Schadensersatzrechts (dazu unten c.).
Einer Berücksichtigung der tatsächlich angemessenen Gegenleistung stünde allerdings nicht bereits die Entscheidung des BGH zum Fall „BKN“ entgegen. Der BGH hat zwar 2013 entschieden, dass die Aktionäre der Zielgesellschaft keine Ansprüche gegen einen Erwerber der Kontrolle im Sinne des WpÜG haben, wenn dieser es unterlässt, ein Pflichtangebot nach § 35 Abs. 2 WpÜG zu veröffentlichen (BGH, Urteil vom 11. Juni 2013 - II ZR 80/12, ZIP 2013, 1565 Rn. 9 ff. – „BKN“). Die Unterlassung eines unter den Voraussetzungen des § 35 Abs. 2 WpÜG obligatorischen öffentlichen Übernahmeangebots („Pflichtangebot“) führt nach Auffassung des BGH auch nicht dazu, dass die Aktionäre gemäß § 823 Abs. 2 BGB Anspruch darauf hätten, dass der Erwerber der Kontrolle ihre Aktien zu dem Preis übernehmen müsste, der hätte geboten werden müssen, als die Voraussetzungen für ein Pflichtangebot erfüllt waren (BGH, Urteil vom 29. Juli 2014 – II ZR 353/12 –, BGHZ 202, 180-202, Rn. 19 unter Hinweis auf die „BKN“- Entscheidung). In der Entscheidung von 2014 hat der BGH aber auch klargestellt, dass solche Fälle (eines unterbliebenen Pflichtangebots) nicht vergleichbar sind mit dem vorliegenden, in dem es um die Angemessenheit eines abgegebenen (aber zu niedrigen) Angebots geht. Als zentralen Gesichtspunkt für die Abgrenzung dieser Fallkonstellationen hat der BGH den Rechtsverlust des Kontrollerwerbers gemäß § 59 WpÜG genannt: Unterlässt es der Kontrollerwerber, ein Pflichtangebot nach § 35 Abs. 2 WpÜG zu veröffentlichen, kann er nach § 59 WpÜG keine Rechte mehr aus diesen Aktien geltend machen, d.h. er darf weder Dividende beziehen noch das Stimmrecht ausüben. Damit ist der Zweck des Gesetzes, die Aktionäre vor einem Kontrollerwerb zu schützen, erreicht. Demgegenüber hat er, wenn er ein Übernahmeangebot veröffentlicht hat, „sei es auch mit einer nur unangemessenen Gegenleistung“, die Kontrolle, und es besteht Anlass, die „austrittswilligen“ Aktionäre durch das Gebot der angemessenen Gegenleistung zu schützen (BGH, Urteil vom 29. Juli 2014 – II ZR 353/12 –, BGHZ 202, 180-202, Rn. 27).
Eine andere, durch die „BKN“-Entscheidung nicht geklärte Frage ist aber, welche Aktionäre in den Genuss der Korrektur einer unangemessenen Gegenleistung kommen sollen und welche nicht.
b. Europarechtliche Überlegungen
§ 31 Abs. 1, 4 WpÜG dienen der Umsetzung von Art. 5 Abs. 4 der Richtlinie 2004/25/EG (ABl. L 142 vom 30. April 2004, S. 12 – „Übernahmerichtlinie“; vgl. dazu BGH, Urteil vom 07. November 2017 – II ZR 37/16 –, Rn. 33, juris; BGH, Urteil vom 29. Juli 2014 – II ZR 353/12 –, BGHZ 202, 180-202, Rn. 32). Art. 3 Abs. 1 lit. a der Übernahmerichtlinie statuiert nicht nur das Gleichbehandlungsgebot bezüglich aller Inhaber von Wertpapieren der Zielgesellschaft, die derselben Gattung angehören, sondern regelt darüber hinaus, dass auch „die anderen Inhaber von Wertpapieren“ geschützt werden müssen, wenn eine Person die Kontrolle über die Gesellschaft erwirbt. Die Regelungen des § 31 Abs. 1 und des Abs. 4 WpÜG, wonach höhere Vorerwerbs- und Parallelerwerbspreise übernahmerechtlich bei der Bestimmung der angemessenen Gegenleistung zu berücksichtigen sind, gehen auf § 5 Abs. 4 der Übernahmerichtlinie zurück. Es ist nach Art. 17 Satz 1 der Übernahmerichtlinie Aufgabe der Mitgliedstaaten, die Sanktionen festzulegen, die bei einem Verstoß gegen die einzelstaatlichen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie zu verhängen sind.
Art. 17 Satz 2 der Übernahmerichtlinie besagt, dass diese Sanktionen „wirksam, verhältnismäßig und abschreckend“ sein müssen. Diese Vorgabe setzt allerdings nicht zwingend Zahlungsansprüche aller Aktionäre bei Verstößen gegen das WpÜG voraus. Derartige Zahlungsansprüche hat der BGH bereits verneint, wenn – wie etwa im Falle des pflichtwidrig unterbliebenen Pflichtangebots nach § 35 WpÜG – das Gesetz bereits eine andere wirksame Sanktion in Gestalt des Stimmrechtsverbots und des Ausschlusses vom Dividendenbezug über § 59 WpÜG vorsieht (BGH, Urteil vom 11. Juni 2013 – II ZR 80/12 –, Rn. 32, juris). Der Zuerkennung von Zahlungsansprüchen bei pflichtwidrig zu niedriger, nicht mehr i.S.v. § 31 Abs. 1 WpÜG angemessener Gegenleistung steht das zwar nicht entgegen, zumal in diesem Fall die Sanktionen des § 59 WpÜG nicht greifen (BGH, Urteil vom 29. Juli 2014 – II ZR 353/12 –, BGHZ 202, 180-202, Rn. 32). Das besagt aber nicht, dass es europarechtlich geboten wäre, den auch europarechtlich insbesondere mit Blick auf die annehmenden Aktionäre formulierten Gleichbehandlungsgrundsatz zwingend auf diejenigen Aktionäre auszudehnen, die das Angebot nicht angenommen haben. Diese Gruppe der Aktionäre hat sich entschieden, die Aktien zu dem angebotenen Preis nicht anzudienen. Bereits der Nachzahlungsanspruch der das Angebot annehmenden Aktionäre auf den Differenzbetrag zur tatsächlich angemessenen Gegenleistung führt insgesamt zu relevanten Zahlungspflichten der Antragsgegnerin und stellt eine angemessene Sanktion für das pflichtwidrig zu niedrige Angebot und den Verstoß gegen den übernahmerechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz dar.
Die Kammer hat keinen Zweifel daran, dass es eine zusätzliche abschreckende Sanktion darstellen würde, wenn sich im Falle eines Übernahmeangebots, bei dem eine im Sinne der Übernahmerichtlinie und im Sinne von § 31 Abs. 1 WpÜG unangemessene Gegenleistung angeboten wurde, nicht nur diejenigen Aktionäre, die das Angebot zu den niedrigen Konditionen angenommen haben, im Wege von Zahlungsansprüchen auf die Gesetzwidrigkeit der angebotenen Gegenleistung könnten und einen Ausgleich erhielten (wie vom BGH entschieden), sondern auch diejenigen Minderheitsaktionäre, die das Angebot angesichts der niedrigen Gegenleistung nicht angenommen haben und denen wenig später vom Bieter im Rahmen eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages eine noch niedrigere Abfindung angeboten wird. Die Kammer hat jedoch Zweifel, ob ein solches Ergebnis zur effektiven Durchsetzung der Übernahmerichtlinie als Sanktion erforderlich im europarechtlichen Sinne wäre. c. Voraussetzungen vorvertraglicher Schadensersatzansprüche. Wäre mit den nicht angedienten Aktien untrennbar ein schuldrechtlicher Anspruch auf den Differenzbetrag zu den übernahmerechtlich tatsächlich angemessenen 30,95 EUR verbunden, so wäre dies bei der Wertermittlung zu berücksichtigen und müsste sich auch bei der Abfindungshöhe niederschlagen. Die Einbeziehung des Preises, der gemäß § 31 Abs. 1, 6 WpÜG bei gesetzeskonformer Ausgestaltung des Zweiten Übernahmeangebots hätte angeboten werden müssen (30,95 EUR pro Aktie), in die Angemessenheitsprüfung im Rahmen des § 305 Abs. 1 AktG lässt sich im Ergebnis aber auch nicht mit allgemeinen schuldrechtlichen Überlegungen oder konkret Schadensersatzansprüchen begründen, wie im Folgenden aufgezeigt wird.
aa.
An dieser Stelle ist zunächst auf den Vortrag der Antragsgegnerin einzugehen, es sei „völlig unbekannt“, ob die Übernahmetransaktion in der Weise (wie tatsächlich geschehen) durchgeführt worden wäre, hätte die BaFin im Vorfeld der Bekanntmachung des Übernahmeangebots gegenüber der Antragsgegnerin die Rechtsauffassung vertreten, die letztlich der BGH im „Mindestpreisverfahren“ Jahre später (d.h. am 07. November 2017) ausgesprochen habe. Es sei denkbar, dass die Antragsgegnerin von der Übernahmetransaktion „gänzlich Abstand genommen hätte“ (Bl. 1128 d.A.).
Die spekulativen Überlegungen zur Frage, wie die Antragsgegnerin reagiert hätte, wenn bereits die BaFin und nicht erst der BGH die übernahmerechtliche Unangemessenheit der angebotenen Gegenleistung beanstandet und die Veröffentlichung der Angebotsunterlage untersagt hätte, führen im vorliegenden Fall nicht weiter.
(1)
Erstens schuldete die BaFin gegenüber der Antragsgegnerin keine Rechtsberatung oder gar eine rechtlich abschließende Prüfung.
Die Antragsgegnerin hatte die neue Angebotsunterlage im Vorfeld des Zweiten Übernahmeangebots der BaFin vorgelegt, wie in § 14 Abs. 1 Satz 1 WpÜG vorgesehen. Die Behörde hat in solchen Fällen zehn Werktage Zeit, das Angebot zu untersagen. Erst nach Ablauf der Frist oder nach Gestattung durch die BaFin darf und muss ein Bieter die Angebotsunterlage gemäß § 14 Abs. 2, 3 WpÜG unverzüglich veröffentlichen. Im konkreten Fall wurden der BaFin die Vorgänge im Zusammenhang mit dem Erwerb der Wandelschuldverschreibungen zwar offengelegt, und die späteren Kläger, die beim OLG Frankfurt und beim BGH schließlich obsiegt und ihren Anspruch auf den Differenzbetrag durchgesetzt haben, hatten sogar bereits im Rahmen des Prüfungsverfahrens eine Untersagung des Angebots begehrt. Die BaFin hatte jedoch darauf hingewiesen, dass die Anträge der ehemaligen Aktionäre auf Untersagung des Übernahmeangebots unzulässig seien, weil es den Klägern offenstehe, etwaige Ansprüche im Zivilrechtswege durchzusetzen (LG Frankfurt, Urteil vom 02. Dezember 2014 – 3/5 O 44/14 –, Rn. 27, juris). Dazu kam es dann später bekanntlich auch.
Der BGH hat bereits 2014 hervorgehoben, dass die Prüfung eines öffentlichen Übernahmeangebots durch die BaFin schon mit Blick auf die knapp bemessene Zeit der Prüfung nicht dieselbe Tiefe wie eine Prüfung im Rahmen eines Rechtsstreits vor den Zivilgerichten haben kann. Das spreche aber nicht gegen einen zivilrechtlichen Anspruch auf die angemessene Gegenleistung (BGH, Urteil vom 29. Juli 2014 – II ZR 353/12 –, BGHZ 202, 180-202, Rn. 24, 25).
Die unterbliebene Beanstandung durch die BaFin spricht demnach weder für noch gegen die Angemessenheit des öffentlich angebotenen Preises für die Aktien. Umgekehrt würde die hypothetische Beanstandung durch die BaFin nicht die Annahme rechtfertigen, dass ein gesetzeskonformes Zweites Übernahmeangebot in diesem Fall unterblieben wäre.
(2)
Zweitens war es die Entscheidung der Antragsgegnerin, und nicht die Verantwortung der BaFin, nach der Befreiungsentscheidung gemäß § 26 Abs. 1 WpÜG (Bl. 504 d.A.) und nach Prüfung und Gestattung der zweiten Angebotsunterlage durch die BaFin (vgl. LG Frankfurt, Urteil vom 02. Dezember 2014 – 3/5 O 44/14 - Rn. 26, juris) in Kenntnis der übernahmerechtlichen Risiken das Zweite Übernahmeangebot mit der angebotenen Gegenleistung von 23,50 EUR zu veröffentlichen – einem Preis, der sich später wegen der ihr bekannten höheren Erwerbspreise über die Ausübung von Wandelschuldverschreibungen als unangemessen zu niedrig erwies. Dementsprechend hat die Antragsgegnerin auch für die Folgen ihrer Pflichtverletzung zivilrechtlich einzustehen.
Die Antragsgegnerin als Schädigerin kann schadensrechtlich nicht beanspruchen, so gestellt zu werden, als hätte es ihre pflichtwidrige Handlung (Veröffentlichung des Zweiten Übernahmeangebots mit unangemessen niedriger Gegenleistung) nie gegeben. Genau das versucht sie jedoch mit dem Hinweis darauf, bei anderer Positionierung der BaFin sei „denkbar“, dass sie von der Übernahmetransaktion gänzlich Abstand genommen hätte (Bl. 1128 d.A.).
bb.
§ 12 WpÜG regelt die – hier nicht einschlägige - Haftung des Bieters gegenüber denjenigen, die das Angebot angenommen haben, für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angebotsunterlage.
In der übernahmerechtlichen Literatur wird darüber hinaus diskutiert, dass beispielsweise eine mit Fehlern behaftete Angebotsunterlage, in der etwa Vorerwerbe nicht vollständig offengelegt werden oder relevante Bewertungsinformationen insiderrechtlich verbotenerweise verschwiegen werden, zur zivilrechtlichen Haftung des Bieters führt. Derartige Ansprüche stehen der Literatur zufolge sämtlichen Anlegern zu, nicht nur denjenigen, die das Angebot angenommen haben (Wackerbarth, in MüKo AktG a.a.O.
§ 31 WpÜG Rn. 94 m.w.N.). Um derartige Fehler der Angebotsunterlage geht es jedoch hier nicht. Es geht vielmehr um einen Fehler der Antragsgegnerin bei der Anwendung des § 31 Abs. 1, 4, 5 WpÜG.
Mit der Unterbreitung des Zweiten Übernahmeangebots, das an die jeweiligen Inhaber der Aktien gerichtet war, ist – zunächst unabhängig von seiner Fehlerhaftigkeit und Gesetzeswidrigkeit wegen der unangemessen niedrigen Gegenleistung - ein vorvertragliches Schuldverhältnis im Sinne des §§ 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB zustande gekommen. Der Begründung eines solchen vorvertraglichen Schuldverhältnisses durch die Veröffentlichung des freiwilligen Übernahmeangebots nach § 31 Abs. 1 WpÜG steht nicht die Rechtsprechung des BGH entgegen, wonach die Aktionäre bei gesetzwidrig unterbliebenem Pflichtangebot weder aus § 35 Abs. 2 WpÜG noch aus einem mitgliedschaftlichen Schuldverhältnis Zahlungsansprüche gegen den „Kontrollerwerber“ geltend machen können; die einschneidende Sanktion ist in diesem Fall der Stimmrechtsverlust des „Kontrollerwerbers“ gemäß § 59 WpÜG (BGH, Urteil vom 11. Juni 2013 – II ZR 80/12 –, Rn. 9, juris) bis zur Nachholung des Pflichtangebots. Die Situation bei einem unter Verstoß gegen § 35 Abs. 2 WpÜG unterbliebenen Pflichtangebot unterscheidet sich insoweit hinsichtlich möglicher Ansprüche der betroffenen Aktionäre grundlegend von derjenigen bei einem tatsächlich unterbreiteten Übernahmeangebot mit zu niedriger angebotener Gegenleistung. Dass im letzteren Fall ein Schuldverhältnis besteht, aufgrund dessen Zahlungsansprüche geltend gemacht werden können, ist geklärt (BGH, Urteil vom 29. Juli 2014 – II ZR 353/12 –, BGHZ 202, 180-202, Rn. 20).
Aufgrund des mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage begründeten Schuldverhältnisses und §§ 11 Abs. 2 Nr. 4, 31 Abs. 1 WpÜG war die Antragsgegnerin gegenüber allen Aktionären – also nicht nur gegenüber den das Angebot annehmenden Aktionären – verpflichtet, ihnen eine „angemessene“ Gegenleistung für ihre Aktienanzubieten, nachdem sie die Entscheidung getroffen hatte, überhaupt ein Zweites Übernahmeangebot zu veröffentlichen.
Gegen diese schuldrechtliche Verpflichtung hat die Antragsgegnerin gegenüber allen damals außenstehenden Aktionären verstoßen, wie die bereits Entscheidungen des OLG Frankfurt und des BGH zum vorliegenden Fall „A AG“ zeigen (BGH, Urteil vom 07. November 2017 – II ZR 37/16 –, Rn. 14 ff., 35, juris; OLG Frankfurt, Urteil vom 19. Januar 2016 – 5 U 2/15).
Es spricht Einiges dafür, dass alle betroffenen außenstehenden Aktionäre, die während der Angebotsphase bis zum Ablauf der Annahmefrist Aktien der A AG hielten und die das Übernahmeangebot bis zum Ende der Annahmefrist nicht angenommen haben, wegen der Pflichtverletzung dem Grunde nach gemäß § 280 Abs. 1 Satz 1 BGB Schadensersatz von der Antragsgegnerin verlangen können (zur Anwendbarkeit auf Schuldverhältnisse gemäß §§ 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB H. P. Westermann in: Erman, BGB, 15. Aufl. 2017, § 280 BGB, Rn. 5; Schwarze, in Staudinger BGB Kommentar 2014, § 280 Rn. B 8; Seichter in: Herberger/Martinek/Rüßmann/Weth/Würdinger, jurisPK-BGB, 8. Aufl. 2017, § 280 BGB, Rn. 21).
cc.
Die Voraussetzungen für einen Wegfall der Verschuldenshaftung nach § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB (fehlendes Vertretenmüssen) liegen offenkundig nicht vor. Denn bei einem Rechtsirrtum werden hohe Anforderungen an den Wegfall des Verschuldens gestellt, und Fahrlässigkeit liegt bereits dann vor, wenn der Schuldner mit der Möglichkeit rechnen musste, dass die Gerichte einen anderen Rechtsstandpunkt einnehmen (Seichter in: Herberger/Martinek/Rüßmann/Weth/Würdinger, jurisPK-BGB, 8. Aufl. 2017, § 280 BGB, Rn. 124). An einem unverschuldeten, unvermeidbaren Rechtsirrtum fehlt es dann, wenn eine Rechtsfrage noch nicht abschließend geklärt ist und es in der Literatur verschiedene gegenläufige Auffassungen gibt (BGH, Urteil vom 15. Juli 2014 – XI ZR 418/13 –, Rn. 20, 21 juris). So liegt es hier: Die Frage, ob eine von § 31 Abs. 6 WpÜG erfasste Umgehungsgestaltung auch dann vorliegt, wenn aufgrund erworbener Wandelschuldverschreibungen nach deren Ausübung für die bezogenen Aktien höhere Preise bezahlt werden als an der Börse, war im Jahr 2014 in der Literatur umstritten. Die überwiegenden Literaturstimmen gingen sogar davon aus, dass § 31 Abs. 6 Satz 1 WpÜG den Erwerb von Wandelanleihen erfasse, ohne zwischen originärem und abgeleitetem Erwerb zu differenzieren (OLG Frankfurt, Urteil vom 19. Januar 2016 – 5 U 2/15 –, Rn. 35, juris unter Hinweis auf Haarmann, in: FK-WpÜG, 3. Aufl., § 31 Rdn. 150; Heidel/Glade, Aktien- und Kapitalmarktrecht, 4. Aufl., § 31 WpÜG Rdn. 32; Krause, in: Assmann/Pötzsch/ Schneider, WpÜG, 2. Aufl., § 31 Rdn. 151; Kremer/Oesterhaus, in: KK-WpÜG, 2. Aufl., § 31 Rdn. 98 sowie die kontroverse Beurteilung durch Santelmann/Nestler in: Steinmeyer, WpÜG, 3. Aufl., § 31 Rdn. 104 einerseits und Wackerbarth in: MüKo-AktG, 3. Aufl., § 31 WpÜG Rdn. 84 andererseits). Erst durch die BGH-Entscheidung vom 07. November 2017 (II ZR 37/16) wurde Klarheit geschaffen.
Auf die 2014 getroffene Entscheidung der BaFin, die Veröffentlichung der Angebotsunterlage zum Zweite Übernahmeangebot nicht zu untersagen, obwohl Aktionäre Einwände gerade wegen der im Wege von Wandelschuldverschreibungen bezahlten höheren Preise erhoben hatten, kann sich die Antragsgegnerin ebenfalls nicht berufen, um fehlendes Verschulden im Sinne von § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB zu belegen. Denn erstens ist die der BaFin zur Verfügung stehende Zeit begrenzt (BGH, Urteil vom 29. Juli 2014 – II ZR 353/12 –, BGHZ 202, 180-202, Rn. 24, 25). Zweitens ist die Schwelle für ein behördliches Einschreiten der BaFin bei der Prüfung und Untersagung von Übernahmeangeboten hoch: Nach dem hier einschlägigen § 15 Abs. 1 Nr. 2 WpÜG hätte die BaFin das Angebot nur bei einem „offensichtlichen“ Verstoß gegen das WpÜG oder die WpÜGAngebV untersagen können; daran fehlte es aus Sicht der BaFin möglicherweise wegen der kontroversen Beurteilung in der Literatur. Ein schuldhafter Rechtsirrtum im Sinne des § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB liegt dagegen nicht erst dann vor, wenn es um einen „offensichtlichen“ Gesetzesverstoß als Pflichtverletzung geht. Auch ein nicht „offensichtlicher“ Gesetzesverstoß (der schon fast auf eine vorsätzliche Pflichtverletzung hindeutet) ist regelmäßig schuldhaft. Drittens hat die BaFin die Untersagungsanträge der Aktionäre nicht als unbegründet, sondern als unzulässig zurückgewiesen und die Aktionäre auf den Zivilrechtsweg verwiesen (vgl. LG Frankfurt, Urteil vom 02. Dezember 2014 – 3/5 O 44/14 –, Rn. 27, juris). Bereits mit diesem Hinweis der BaFin war im Grunde klar, dass sich die Antragsgegnerin nicht sicher sein konnte, dass ihre rechtliche Einschätzung zuträfe.
dd.
Allerdings ist die oben begründete, sich aus §§ 311 Abs. 2, 241 Abs. 2, 280 Abs. 1 Satz 1 BGB ergebende Schadensersatzforderung der Adressaten des Zweiten Übernahmeangebots betroffenen Aktionäre wegen des pflichtwidrig zu niedrigen Angebotspreises darauf gerichtet, so gestellt zu werden, als hätte sich die Antragsgegnerin gesetzeskonform verhalten. Das konnte zweierlei bedeuten: Sie unterbreitet ein Übernahmeangebot in Höhe von 30,95 EUR pro Aktie. Oder sie sieht gänzlich von einem Zweiten Übernahmeangebot ab. Nach allgemeinen schadensrechtlichen Kriterien kann der Geschädigte schadensrechtlich gemäß § 249 Abs. 1 BGB verlangen, so gestellt zu werden, wie er ohne das schädigende Verhalten des anderen Teils gestanden hätte. Im Rahmen der Haftung nach §§ 311 Abs. 2, 241 Abs. 2, 280 Abs. 1 BGB stellt sich freilich die Frage, ob nur das „negative Interesse“ oder auch das „positive Interesse“ im Einzelfall ersatzfähig ist.
In der Regel ist bei Ansprüchen nach §§ 311 Abs. 2, 241 Abs. 2, 280 Abs. 1 BGB nur der Vertrauensschaden zu ersetzen, der etwa nutzlose Aufwendungen und sonstige Kosten umfasst, die im Vertrauen auf den Abschluss des Vertrages gemacht wurden, also das sog. „negative Interesse“. Das entspricht dem Haftungsumfang für den – hier jedoch nicht einschlägigen - Fall der unrichtigen oder unvollständigen Angebotsunterlage nach § 12 Abs. 1 WpÜG, wie dort ausdrücklich gesetzlich normiert. Im Falle des § 12 WpÜG soll der Schadensersatzberechtigte nicht die Herstellung eines den fehlerhaften Angaben entsprechenden Zustands verlangen können („positives Interesse“; vgl. Assmann in: Assmann/Pötzsch/Uwe H. Schneider, WpÜG, 2. Aufl. 2013, § 12 WpÜG, Rn. 57 m.w.N.).
Nach allgemeinen Grundsätzen ist bei Ansprüchen wegen vorvertraglicher Pflichtverletzungen das „positive Interesse“, also das Interesse an der Erfüllung eines nicht zustande gekommenen Vertrages nur dann zu ersetzen, wenn feststeht, dass die Parteien bei pflichtgemäßem Verhalten des Schädigers den Vertrag zu für den Geschädigten günstigeren Bedingungen geschlossen hätten (Kindl in: Erman, BGB, 15. Aufl. 2017, § 311 BGB, Rn. 29 unter Hinweis auf BGH NJW 1998, 2900, 2901; BGH NJW 2001, 3698, 3700; Lapp in: Herberger/Martinek/Rüßmann/Weth/Würdinger, jurisPK-BGB, 8. Aufl. 2017, § 311 BGB, Rn. 60; vgl. auch LG Köln, Urteil vom 20. Oktober 2017 – 82 O 11/15 –, Rn. 598, juris gerade im Zusammenhang mit einem Übernahmeangebot). Eine solche Feststellung kann die Kammer hier nicht treffen.
Die Antragsgegnerin versucht in Zweifel zu ziehen, dass sie bei entsprechendem Hinweis der BaFin das Zweite Übernahmeangebot zu 30,95 EUR pro Aktie bei im Übrigen unveränderten Konditionen veröffentlicht hätte. Sie behauptet, es sei „denkbar, dass die Antragsgegnerin von der Übernahmetransaktion gänzlich Abstand genommen hätte“ (Bl. 1128 d.A.). Hätte sie ein Angebot zu 30,95 EUR nicht veröffentlicht, sondern davon „gänzlich Abstand genommen“, so hätte es von keinem Aktionär angenommen werden können und es bestünde kein Anlass, über Schadensersatzansprüche nach §§ 311 Abs. 2, 241 Abs. 2, 280 Abs. 1 BGB wegen Verstoßes gegen § 31 Abs. 1 WpÜG bei derFestlegung des Angebotspreises nachzudenken. Das rechtmäßige Alternativverhalten „gänzliches Absehen von einem Angebot“ hätte somit nicht zu Ansprüchen der außenstehenden Aktionäre geführt. Damit stellt die Antragsgegnerin die schadensrechtlichen Voraussetzungen der Ersatzfähigkeit des „positiven Interesses“ in Abrede.
Die Antragsgegnerin hatte bereits vor Veröffentlichung des Zweiten Übernahmeangebots durch dingliche Aktienübertragungen und mittelbar durch schuldrechtliche Vereinbarungen den sicheren „Zugriff“ auf 75% der Stimmrechte (selbst nach Verwässerung bei Ausübung der Wandelschuldverschreibungen). Die erforderliche qualifizierte Hauptversammlungsmehrheit zum Abschluss des schon damals angestrebten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags (§ 293 Abs. 1 Satz 2 AktG) hatte sie demnach auch ohne das Zweite Übernahmeangebot bereits inne. Zugleich müssen der rechtlich beratenen Antragsgegnerin die hohen Risiken bekannt gewesen sein, die sich nach der damals bereits vorherrschenden Literaturauffassung für die Einbeziehung von aufgrund von Wandelschuldverschreibungen erworbenen Aktien bei der angemessenen Gegenleistung nach §§ 31 Abs. 1, 6 WpÜG im Hinblick auf potentielle „Nachzahlungsansprüche“ ergaben. Ihr muss klar gewesen sein, dass die Entscheidung der BaFin, das Zweite Übernahmeangebot nicht zu untersagen, keine zivilrechtlich bindende Wirkung hatte und berechtigte zivilrechtliche „Nachzahlungsansprüche“ nicht zu Fall bringen konnte.
Wenn sie in Kenntnis dieser Risiken dennoch entschied, zu diesem Zeitpunkt ein Zweites Übernahmeangebot (freilich zu einem unangemessen niedrigen Preis) zu veröffentlichen, dann spricht das dafür, dass sie „notfalls“ auch bereit war, am Ende doch den höheren angemessenen Übernahmepreis zu bezahlen. Dieses Risiko muss sie „einkalkuliert“ haben. Da sie zum Veröffentlichungszeitpunkt nicht wusste, ob und für wie viele Aktien das Zweite Übernahmeangebot angenommen werden würde, und ob und wie viele annehmenden Aktionäre später in unverjährter Zeit Zahlungsansprüche hinsichtlich des Differenzbetrages von 7,45 EUR pro Aktie geltend machen würden, spricht die Veröffentlichung des Angebots in Kenntnis der Risiken dafür, dass sie ein mögliches Risiko einer Nachzahlung für sämtliche außenstehenden Aktien bewusst in Kauf genommen hat.
Das mit dem riskanten Zweiten Übernahmeangebot zu einem unangemessen niedrigen Preis in Kauf genommene maximale „Nachzahlungsrisiko“ beläuft sich immerhin auf über 376 Mio. EUR (ausgehend von 1.567.026 Aktien, für die das Angebot angenommen wurde, und 48.943.046 Aktien, die nach Ablauf der Annahmefrist noch außen standen, ergeben sich in Summe 50.510.072 Aktien, die zum Zeitpunkt der Angebotsveröffentlichung davon „potentiell“ betroffen waren; zu multiplizieren mit 30,95 EUR ./. 23,50 EUR, also 7,45 EUR pro Aktie).Schon beim ersten Übernahmeangebot waren nicht nur der Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages, sondern auch ein „Squeeze Out“ und das „Delisting“ der A-Aktie als mögliche Maßnahmen der Bieterin nach Kontrollerwerb genannt worden (vgl. Anl. AG 33, Seite 39 ff.) – insgesamt Ankündigungen, die eine dauerhafte Minderheitsbeteiligung außenstehender Aktionäre objektiv unattraktiv machten. Bemerkenswert ist auch die enge zeitliche Abfolge zweier öffentlicher Übernahmeangebote (das Zweite Übernahmeangebot wurde am 23. Januar 2014 angekündigt, nachdem das erste am 09. Januar 2014 gescheitert war) und des bereits einen Monat nach Ablauf der weiteren Annahmefrist am 22. Mai 2014 noch vor der Zustimmung der Hauptversammlung geschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages.
All das zeigt wiederum, dass die Antragsgegnerin danach strebte, möglichst viele Aktien innerhalb kürzester Zeit zu erwerben. Dass es ihr darauf ankam, die Aktien möglichst zu einem günstigen Preis zu erwerben, liegt ökonomisch betrachtet auf der Hand.
Die von den Prozessbevollmächtigten der Antragsgegnerin zuletzt angedeuteten Überlegungen zu „alternativen Transaktionsstrukturen“ (Bl. 1128 d.A.) sprechen nicht dafür, dass es zur Unterbreitung eines gesetzeskonformen Zweiten Übernahmeangebots (mit Gegenleistung von 30,95 EUR pro Aktie) eine für die Antragsgegnerin sicher günstigere Lösung gegeben hätte. Die Antragsgegnerin hätte ohne ein weiteres Übernahmeangebot einen Vertragskonzern bilden und auch danach sukzessive über ggf. längere Zeiträume Aktien an der Börse hinzuerwerben können, um sich der 95%-Schwelle zu nähern. Bei Erreichen der 95%-Schwelle - mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem deutlich späteren Zeitpunkt als bei Nutzung der Möglichkeiten des WpÜG - hätte sie dann einen „Squeeze Out“ durchführen können. Bei der dann regelmäßig durchzuführenden Unternehmensbewertung zur Abfindungsermittlung wären gemäß IDW S1 i.d.F. 2008 (Tz. 33 f.) auch unechte Synergieeffekte aus der in diesem Stadium bereits angelegten Konzernierung zu berücksichtigen gewesen. Das hätte sich positiv auf den Ertragswert und die den außenstehenden Aktionären beim „Squeeze Out“ zu gewährende Abfindung ausgewirkt.
Demgegenüber ließen sich durch ein dem Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zeitlich unmittelbar „vorgeschaltetes“ Übernahmeangebot für beide Schritte die Partizipation der Minderheitsaktionäre an den angestrebten Synergieeffekten vermeiden. Im Gegensatz zur Abfindung bei einem „Squeeze Out“ spielt der Ertragswert bei der Angemessenheitskontrolle der Gegenleistung im Falle eines Übernahmeangebots grundsätzlich keine Rolle, wenn wie hier aussagekräftige Börsenkurse vorhanden sind (§ 31 Abs. 1 WpÜG, § 5 Abs. 4 WpÜGAngebV). Diesen Vorteil eines Zweiten Übernahmeangebots hätte die Antragsgegnerin auch gehabt, wenn sie es gesetzeskonform ausgestaltet hätte, also 30,95 EUR pro Aktie angeboten hätte.
Trotz dieser Indizien kann die Kammer aber nicht mit dem erforderlichen Maß der Überzeugung feststellen, dass die Antragsgegnerin, wenn ihr der Ausgang des Zivilprozesses, der durch die erwähnte BGH-Entscheidung vom November 2017 beendet wurde und der die Aktionäre betrifft, die das Angebot angenommen haben, schon im Januar 2014 bekannt gewesen wäre, tatsächlich „gleich“ ein Übernahmeangebot mit einer Gegenleistung von 30,95 EUR pro A-Aktie veröffentlicht hätte. Die Antragsgegnerin hat offensichtlich die sich ihr bietende Chance nutzen wollen, die Aktien der außenstehenden Aktionäre wie diejenigen des früheren Mehrheitsaktionärs H für 23,50 EUR pro Stück erwerben zu können und (gegebenenfalls, d.h. wenn niemand den Klageweg beschreitet) keine Nachzahlung leisten zu müssen. Ihr darf schadensrechtlich nicht der Wille unterstellt werden, „notfalls“ auch ein Angebot zu 30,95 EUR unterbreiten zu wollen. Wie die Antragsgegnerin selbst mitgeteilt hat, beliefe sich der theoretische Erhöhungsbetrag von 7,45 EUR bei den nach Ablauf des Übernahmeangebots noch außenstehenden 48.943.046 Aktien auf rund 365 Mio. EUR.
Es steht im Übrigen auch nicht zweifelsfrei fest, dass die außenstehenden Aktionäre, die das tatsächlich unterbreitete Angebot (von 23,50 EUR) nicht angenommen haben, auf das Angebot eingegangen wären, wenn stattdessen eine Gegenleistung von 30,95 EUR offeriert worden wäre, wenngleich eine höhere angebotene Gegenleistung zweifellos die Neigung der außenstehenden Aktionäre zur Annahme gesteigert hätte.
Löst man sich von den zum deutschen Recht entwickelten Kriterien der haftungsausfüllenden Kausalität bei vorvertraglichen Schadensersatzansprüchen, dann könnte zwar die sich aus Art. 17 Satz 2 der Übernahmerichtlinie ergebende Überlegung, dass Verstöße gegen das Gebot der angemessenen Gegenleistung nach § 31 Abs. 1 WpÜG bzw. Art. 5 Abs. 4 der Übernahmerichtlinie mit einer verhältnismäßigen, aber auch wirkungsvollen Sanktion bewehrt sein müssen, wiederum für die ausnahmsweise Ersatzfähigkeit des „positiven Interesses“ sprechen. Immerhin droht sonst, dass sich die gesetzeswidrige Ungleichbehandlung der Veräußerer von Wandelschuldverschreibungen und der sonstigen Aktionäre durch die Antragsgegnerin beim Übernahmeangebot letztlich im anschließenden Spruchverfahren wegen des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages fortsetzt. Dass eine so weitgehende Sanktion jedoch europarechtlich zwingend erforderlich wäre, um dem übernahmerechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz zur Geltung zu verhelfen, der sich in erster Linie an die annehmenden Aktionäre richtet, ist nicht belegt, zumal es hier um Aktionäre geht, die das Angebot gerade nicht angenommen haben.Nach alledem liegen schadensrechtlich die bereits erwähnten Voraussetzungen für den Ersatz des „positiven Interesses“ im Wege des §§ 311 Abs. 2, 241 Abs. 2, 280 Abs. 1 BGB nicht vor. Die Antragsgegnerin kann schadensrechtlich zwar nicht verlangen, so gestellt zu werden, als hätte es das zu niedrige Angebot nie gegeben. Umgekehrt können die nach Ablauf der Annahmefrist verbliebenen außenstehenden Aktionäre anlässlich des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages aber auch nicht verlangen, bei der Abfindung nach § 305 Abs. 1 AktG so gestellt zu werden, als wäre ihnen ein Übernahmeangebot zu 30,95 EUR pro Aktie unterbreitet worden. Schadensrechtlich können sie nur verlangen, so gestellt zu werden, als hätte die Antragsgegnerin ganz auf das Zweite Übernahmeangebot verzichtet.
d. Überlegungen zur tatsächlichen und hypothetischen Börsenkursentwicklung
Die Kammer hat auch Überlegungen zur tatsächlichen und zur hypothetischen Entwicklung des Börsenkurses bei Veröffentlichung eines gesetzeskonformen Zweiten Übernahmeangebots angestellt. Auch diese Überlegungen führen im vorliegenden Fall aber nicht zu einer weiteren Erhöhung des Abfindungsanspruchs wegen des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages auf 30,95 EUR pro Aktie.
Anknüpfungspunkt für die Angemessenheit der Abfindung nach § 305 Abs. 1 AktG bleibt die verfassungsrechtlich gebotene Gewährung einer „vollen Entschädigung“ in Höhe des anteiligen Verkehrswerts. Dass der Kapitalmarkt der A-Aktie wegen der unangemessen niedrigen angebotenen Gegenleistung einen Wert in Höhe der tatsächlich übernahmerechtlich angemessenen Gegenleistung in Höhe von 30,95 EUR beigemessen hätte, kann die Kammer nicht feststellen. Im Gegenteil, bewegte sich der Börsenkurs zwischen dem 23. Januar 2014 und dem 15. Juli 2014 (dem Bewertungsstichtag) im Wesentlichen zwischen rund 23,50 EUR und etwa 26,00 EUR. Nachdem die Vorerwerbe von Wandelschuldverschreibungen zu umgerechneten Preisen von bis zu 30,95 EUR pro A-Aktie in der Angebotsunterlage offengelegt worden sind und damit dem Kapitalmarkt alle Fakten bekannt waren, anhand deren die Kapitalmarktteilnehmer bereits damals auf eine Nachzahlung für die im Rahmen des Übernahmeangebots andienenden Aktionäre hätten spekulieren können, kann davon ausgegangen werden, dass in die Börsenkursentwicklung zwischen dem 23. Januar 2014 und dem 22. April 2014 (Ende der Annahmefrist) zumindest auch eine Bewertung der Chance auf eine solche Nachzahlung eingeflossen ist. Die tatsächliche Börsenkursentwicklung belegt, dass sich diese Bewertung durch die Kapitalmarktteilnehmer nicht auf 100% des letztlich nachzuzahlenden Differenzbetrages von 7,45 EUR pro Aktie für die das Angebot annehmenden Aktionäre belief, sondern im Schnitt auf deutlich unter 50% dieser Differenz, bezogen auf den tatsächlichen Angebotspreis. Ein Angebot zu 30,95 EUR pro Aktie hätte zweifellos unmittelbare Auswirkungen auf den Börsenkurs zumindest während der Geltungsdauer des befristeten Übernahmeangebots gehabt, wie sich auch das tatsächlich unterbreitete Angebot von 23,50 EUR unmittelbar auf den Börsenkurs auswirkte und diesen „nach unten absicherte“.
Die Börsenkurse, die bei der Ermittlung der Abfindung vom Bewertungsgutachter herangezogen wurden, wurden für den Dreimonatszeitraum vom 23. Oktober 2013 bis 22. Januar 2014 ermittelt (BewGA Seite 111). Bewertungsstichtag ist dagegen der 15. Juli 2014, der Tag der Beschlussfassung der Hauptversammlung. Der für die Berechnung des umsatzgewichteten durchschnittlichen Börsenkurses betrachtete Dreimonatszeitraum entspricht formal auch den Vorgaben der Rechtsprechung, wonach es auf den Dreimonatszeitraum vor der Bekanntmachung der Maßnahme ankommt. Die Kursentwicklung im Zeitraum danach wird als für die Bestimmung der angemessenen Abfindung regelmäßig untauglich angesehen, weil gewöhnlich mit der Ankündigung einer Strukturmaßnahme an die Stelle der Markterwartung hinsichtlich der Entwicklung des Unternehmenswertes und damit des der Aktie innewohnenden Verkehrswertes die Markterwartung an die Abfindungshöhe tritt (BGH, Beschluss vom 19. Juli 2010 – II ZB 18/09 –, BGHZ 186, 229-242, Rn. 10, 12). Die Markteinschätzung beruht nach Ankündigung einer Strukturmaßnahme in der Regel auf „Abfindungsspekulationen“, die mit der Frage der Angemessenheit einer Abfindung wenig zu tun haben.
Der BGH hat in der „Stollwerck“-Entscheidung ausgeführt, dass im Falle eines längeren Zeitraums zwischen der Ankündigung einer Strukturmaßnahme (im entschiedenen Fall: „Squeeze Out“) und dem Tag der Hauptversammlung eine Anpassung des im Dreimonatszeitraum vor Bekanntgabe der beabsichtigten Strukturmaßnahme ermittelten durchschnittlichen gewichteten Börsenkurses geboten sein könne. Bei einem Zeitraum von siebeneinhalb Monaten seien Feststellungen zur „Entwicklung der allgemeinen oder branchentypischen Aktienkurse“ bis zum Bewertungsstichtag zu treffen (BGH, Beschluss vom 19. Juli 2010 – II ZB 18/09 –, BGHZ 186, 229-242, Rn. 30).
Hätte die Antragsgegnerin am 28. Februar 2014 anstelle des tatsächlich veröffentlichen Zweiten Übernahmeangebots zum Preis von 23,50 EUR pro A-Aktie ein gesetzeskonformes Zweites Übernahmeangebot zum Preis von 30,95 EUR pro Aktie bei im Übrigen gleichen Konditionen unterbreitet und dieses, wie das tatsächliche Angebot, bis zum 22. April 2014 befristet, so hätte sich der Börsenkurs jedenfalls während dieser Zeit zur Überzeugung der Kammer bei mindestens 30,95 EUR pro A-Aktie „eingependelt“. Denn das Zweite Übernahmeangebot enthielt im Gegensatz zum ersten, gescheiterten Übernahmeangebot keine Vollzugsbedingungen mehr. Während des Zeitraums dieses fiktiven, aber im Gegensatz zum tatsächlichen Angebot auch bezüglich der Gegenleistung gesetzeskonformen Angebots hätte jedermann davon ausgehen können, der Bieterin A- Aktien zum Preis von 30,95 EUR andienen zu können. Diese Möglichkeit stand jedem Dritten offen, der während dieses Zeitraums A-Aktien hielt oder erwarb. Für die Kapitalmarktteilnehmer hätte es keinen sachlichen Grund gegeben, diese Aktien an der Börse zu einem niedrigeren Preis zu veräußern als zu 30,95 EUR.
Es kann aber wiederum nicht festgestellt werden, dass die Abgabe eines Zweiten Übernahmeangebots mit einer Gegenleistung von 30,95 EUR pro Aktie die einzige Handlungsmöglichkeit der Antragsgegnerin war. Auf die schadensrechtlichen Überlegungen wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen.
7. Ergebnis
Aus der bereits erwähnten BGH-Entscheidung vom November 2017 zum Fall „A AG“ ergibt sich aus übernahmerechtlicher Sicht lediglich eine anlässlich des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zu gewährende Mindestabfindung von 23,50 EUR pro Aktie. Eine Erhöhung der Abfindung auf 30,95 EUR pro Aktie lässt sich nicht begründen III. Zu kapitalisierende Ergebnisse (Planung) im Rahmen des Ertragswertverfahrens. Obwohl bereits nach den obigen Ausführungen feststeht, dass jedenfalls die im Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vorgesehene (am Börsenkurs, nicht aber am Übernahmeangebot orientierte) Abfindung nicht angemessen im Sinne von § 305 AktG ist (oben II.), hat die Kammer die Ertragswertermittlung einer Prüfung unterzogen. Grund dafür ist zum Einen, dass ein theoretisch denkbarer, 23,50 EUR pro Aktie übersteigender Ertragswert wiederum die Höhe der Abfindung beträfe, und zum Andern, dass der Ertragswert ohnehin ermittelt werden muss, um die Angemessenheit der vorgesehenen Ausgleichszahlung beurteilen zu können.
1. Grundsätzliches
Im IDW Standard „Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen“ (IDW S 1 i.d.F. 2008) heißt es (Tz. 4, 5): „Der Wert eines Unternehmens bestimmt sich unter der Voraussetzung ausschließlich finanzieller Ziele durch den Barwert der mit dem Eigentum an dem Unternehmen verbundenen Nettozuflüsse an die Unternehmenseigner (Nettoeinnahmen als Saldo von Ausschüttungen bzw. Entnahmen, Kapitalrückzahlungen und Einlagen). Zur Ermittlung dieses Barwerts wird ein Kapitalisierungszinssatz verwendet, der die Rendite aus einer zur Investition in das zu bewertende Unternehmen adäquaten Alternativanlagen repräsentiert. Demnach wird der Wert des Unternehmens allein aus seiner Ertragskraft, d.h. seiner Eigenschaft, finanzielle Überschüsse für die Unternehmenseigner zu erwirtschaften, abgeleitet. Dieser Wert ergibt sich grundsätzlich aus den finanziellen Überschüssen, die bei Fortführung des Unternehmens und Veräußerung etwaigen nicht betriebsnotwendigen Vermögens erwirtschaftet werden (Zukunftserfolgswert)…“ Der IDW S 1 erwähnt ausdrücklich das Ertragswertverfahren und die Discounted Cash Flow-Verfahren als in der Unternehmensbewertungspraxis gängige Verfahren (IDW S 1, Tz. 7).
Nach der Ertragswertmethode bestimmt sich der Unternehmenswert nach dem Ertragswert des betriebsnotwendigen Vermögens. Er wird ergänzt durch eine gesonderte Bewertung des nicht betriebsnotwendigen Vermögens. Der Ertragswert ergibt sich aus der risikoadäquaten Diskontierung künftiger erwarteter Nettozuflüsse der Anteilseigner aus dem Unternehmen.
Grundlage für die zur Unternehmensbewertung nach dem Ertragswertverfahren erforderliche Prognose der künftigen Erträge (IDW S 1, Tz. 25) sind unternehmensbezogene Informationen, insbesondere die internen Planungsdaten der Gesellschaft (IDW S 1, Tz. 71), wobei vergangenheits- und stichtagsbezogene Informationen nach dem IDW S 1 (Tz. 70) nur insoweit von Bedeutung sind, als sie als Grundlage für die Schätzung künftiger Entwicklungen oder für die Vornahme von Plausibilitätsbeurteilungen dienen können. Die Vergangenheitsanalyse bildet den Ausgangspunkt für die Prognose künftiger Entwicklungen und für die erforderliche Vornahme von Plausibilitätsüberlegungen des Wirtschaftsprüfers (IDW S 1, Tz. 72).
Die in die Zukunft gerichteten Planungen der Unternehmen und die darauf aufbauenden Prognosen ihrer Erträge sind gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbar. Zu berücksichtigen ist, dass es nicht nur eine richtige Prognose über die künftige Entwicklung eines Unternehmens gibt, und in den seltensten Fällen trifft sie so wie vorhergesagt ein (OLG Stuttgart, Beschluss vom 05. November 2013 – 20 W 4/12 –, Rn. 84, juris). Die unternehmerischen Planungen sind in erster Linie ein Ergebnis der jeweiligen unternehmerischen Entscheidung der für die Geschäftsführung verantwortlichen Personen. Beruhen diese planerischen Entscheidungen auf zutreffenden Informationen und realistischen Annahmen und sind diese nicht in sich widersprüchlich, darf also die Geschäftsführung vernünftigerweise annehmen, ihre Planung sei realistisch, so darf diese Planung nicht durch andere - letztlich ebenfalls nur vertretbare - Annahmen des Gerichts oder der am Spruchverfahren Beteiligten ersetzt werden (vgl. OLG Stuttgart, Beschluss vom 27. Juli 2015 – 20 W 5/14 –, Rn. 75, juris; OLG Stuttgart, Beschluss vom 26. Oktober 2006 – 20 W 14/05 –, Rn. 28, juris; OLG München, Beschluss vom 14. Juli 2009 – 31 Wx 121/06 –, Rn. 12, juris;).
Im Spruchverfahren sind deshalb vorhandene Planungsrechnungen nur auf ihre Plausibilität zu überprüfen. Demzufolge kann eine Korrektur der Planung nur dann erfolgen, wenn diese nicht plausibel und unrealistisch ist. Fehlen Planungsrechnungen oder sind sie nicht plausibel, so sind sachgerechte Prognosen zu treffen oder Anpassungen vorzunehmen (vgl. OLG München, Beschluss vom 14. Juli 2009 – 31 Wx 121/06 –, Rn. 12, juris; OLG Stuttgart, Beschluss vom 05. November 2013 – 20 W 4/12 – , Rn. 84, juris; OLG Frankfurt, Beschluss vom 17. Januar 2017 – 21 W 37/12 –, Rn. 30, juris; zur verfassungsrechtlichen Unbedenklichkeit der Beschränkung auf eine Plausibilitätsprüfung BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 24. Mai 2012 – 1 BvR 3221/10 –, Rn. 12, 30, juris).
Die Kammer hat zwar die im „Z-Gutachten“ (auf das sich die Antragsteller Ziff. 1, 30, 31, 36 bis 40 bezogen haben, vgl. Bl. 654 ff. d.A.) sehr detailliert aufgeführten Kritikpunkte, angefangen bei der Kritik an der fehlenden „vollumfänglichen Marktuntersuchung“ (Z-GA Seite 7) zur Kenntnis genommen. Der Kammer leuchtet auch ein, dass „ohne fundierte Kenntnisse des spezifischen Marktes, in dem ein Unternehmen tätig ist, eine Unternehmensplanung weder verifiziert noch modelliert werden kann“ (vgl. das Zitat von Habbel/Krause/Ollmann bei Wollny, Der objektivierte Unternehmenswert, 3. Aufl. Seite 262). Eine „vollumfängliche Marktuntersuchung“ zu fordern, lässt aber schon den konkreten Umfang der geforderten Analyse offen und hieße im Extremfall schlicht, unmöglich Leistbares zu fordern. Maßgeblich muss das Ziel bleiben, nicht plausible, unrealistische Planungsprämissen des Vorstands zu erkennen. Dass man stets noch weitere potentielle Wettbewerber finden und zusätzlich analysieren könnte, mag sein; die Frage bleibt aber, welcher zusätzliche Erkenntnisgewinn sich daraus für die Bewertungsfrage im konkreten Fall ergibt. Dass der Bewertungsgutachter den Markt untersucht hat, in dem die A AG tätig ist bzw. war, leugnet auch das Z-Gutachten nicht (vgl. u.a. Z-GA Seite 9).
Nach den vorstehenden Maßstäben hat es im vorliegenden Fall unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Anhörung des sachverständigen Prüfers im Termin am 22. November 2016 und seiner weiteren Ausführungen bei den der Unternehmensbewertung zugrunde liegenden Planannahmen zu bleiben. Im Einzelnen:
2. Der Bewertung zugrunde liegende unternehmensinterne Planzahlen
Dem Bewertungsgutachten liegt folgende, zwischen den Geschäftsbereichen „Consumer Solutions“ und „Pharmacy Solutions“ und der Holding differenzierende Ertragsplanung der A AG für den Detailplanungszeitraum von 2014 bis 2018 zugrunde (BewGA Seite 55, 64), wobei sowohl vom Bewertungsgutachter als auch vom sachverständigen Prüfer durchaus auch die Holding („Zentralbereich“) berücksichtigt wurde (vgl. BewGA Seite 73; PB Seite
27 u.a.):
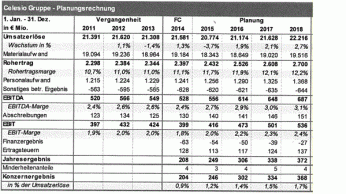
Wegen der genaueren Aufschlüsselung dieser Planzahlen nach Geschäftsbereichen / Holding und nach Ländern wird auf die im Bewertungsgutachten abgedruckten Tabellen Bezug genommen.
Den für die Bewertung verwendeten Planzahlen liegt, wie im Bewertungsgutachten ausgeführt, die vom Vorstand der A AG am 14. Mai 2014 verabschiedete unternehmensinterne Planung zugrunde (BewGA Seite 52).
3. Planungsprozess
Als problematisch anzusehen wäre, wenn ein Bewertungsgutachten bei Planannahmen faktisch „Sonderplanungen“ zugrunde legt, die ausschließlich zu Bewertungszwecken und außerhalb des formalen unternehmerischen Planungsprozesses erstellt wurden. Eine derartige „Sonderplanung“ ist kritisch zu sehen und fällt nur bedingt unter die unternehmerische Planungsvorhand der Gesellschaft (OLG Karlsruhe, Beschluss vom 18. Mai 2016 – 12a W 2/15 –, Rn. 35, juris; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 15. August 2016 – I-26 W 17/13 (AktE) –, Rn. 45, juris). Anlassbezogene Plananpassungen wären kritisch zu prüfen (OLG Stuttgart, Beschluss vom 02. Dezember 2014 – 20 AktG 1/14 –, Rn. 82, juris).
Ebenso bedenklich wäre, wenn der Bewertung veraltete Planzahlen zugrunde gelegt worden wären. Denn entscheidend ist, welche Abfindung sich auf Grundlage der aktuellen Planung ergibt. Die Anpassung der Planung an neue Erkenntnisse im Vorfeld einer Unternehmensbewertung ist nicht per se unzulässig, sondern vielmehr in vielen Fällen geboten (OLG Stuttgart, Beschluss vom 02. Dezember 2014 – 20 AktG 1/14 –, Rn. 81, 89, juris).
Von der Verwendung veralteter Planzahlen kann hier aber nicht die Rede sein. Aus dem Bewertungsgutachten ergibt sich, dass es bei der A AG einen regulären Planungsprozess gab, der mit der strategischen Planung im Februar eines jeden Jahres begann und sich mit der „Strategiediskussion“ mit den einzelnen Ländern im Rahmen einer „aktualisierten Konzernstrategie“ im April fortsetzte. Spätestens im Juni gebe man den Geschäftseinheiten für operative Planungszwecke zentrale Planungsparameter vor und auf dieser Grundlage fänden die „Bottum up“-Planungen auf Ebene der einzelnen länderspezifischen Geschäftseinheiten statt, die dann vom Konzerncontrolling zunächst aggregiert, auf Abweichungen von zentral vorgegebenen Planungsparametern analysiert und dann im September im Vorstand zur Abstimmung vorgestellt würden. Nach Abstimmung bei operativen Planungsgesprächen werde diese abgestimmte operative Planung vom Vorstand im November als Konzernplanung verabschiedet und dem Aufsichtsrat vorgestellt (BewGA Seite 51 f.). Hochrechnungen für das laufende Geschäftsjahr fänden jeweils im April, Juli und Oktober statt (BewGA Seite 52).
Ausgangspunkt für die Bewertung der A AG durch den Bewertungsgutachter war dementsprechend im vorliegenden Fall die am 18. November 2013 genehmigte konsolidierte Planungsrechnung. Der Vorstand habe sich jedoch vor dem Hintergrund der aktuellen Erkenntnisse aus den Branchen- und Geschäftsentwicklungen in den wichtigsten Ländern der A-Gruppe entschieden, den im April 2014 durchgeführten Prozess der strategischen Planung als Ausgangspunkt für eine Aktualisierung der Planzahlen vom November 2013 zu verwenden, wobei der Bewertungsgutachter den Vorstand „methodisch unterstützt“ habe (BewGA Seite 52). Es habe sowohl Aktualisierungen „nach oben“ als auch „nach unten“ gegeben (Bl. 797 d.A.). Der sachverständige Prüfer hat sein Hauptaugenmerk daher konsequenterweise auf die vorgefundenen, im Frühjahr 2014 vom Vorstand aktualisierten und am 14. Mai 2014 beschlossenen (vgl. nochmals BewGA Seite 52) Planzahlen gerichtet, die er – zu Recht – als Bestandteil der „regulären Planung“ angesehen hat, wie in der mündlichen Verhandlung deutlich wurde (PB Seite 30; Bl. 796, 797 d.A.). Als Beispiel für vorgenommene Aktualisierungen hat er die Berücksichtigung eines weggefallenen Kunden in Norwegen genannt (Bl. 797 d.A.).
Viele derjenigen Antragsteller, die von einer „anlassbezogenen“ Negativplanung sprechen, bestreiten zwar nicht den Wegfall des norwegischen Kunden, beanstanden aber, dass man etwa beim Joint Venture „N…“ Ergebnisverbesserungen nicht angemessen in der Planung berücksichtigt habe (etwa Antragsteller Ziff. 32, Bl. 405 d.A.; Ziff. 43, Bl. 405). Dass sich aus der aktuellen Geschäftsentwicklung Anlässe für eine Änderung der Planung ergaben, die von der Unternehmensleitung tatsächlich dann auch vorgenommen wurde, und dass diese Änderung der Planung nicht etwa „willkürlich“ aus sachfremden Erwägungen außerhalb des regulären Planungsprozesses unter einem Vorwand vorgenommen wurde, kann somit auch unter Berücksichtigung dieses Vortrages zugrunde gelegt werden.
Wäre es demgegenüber als Grundlage der Bewertung zum 15. Juli 2014 bei der Verwendung der nicht aktualisierten, im November 2013 verabschiedeten Planzahlen geblieben, ohne die neueren Entwicklungen im Rahmen des regulären Planungsprozesses (hier: aktuellere strategische Planung, „Strategiediskussion“ im April 2014) zu berücksichtigen, hätte der Einwand erhoben werden können, es sei eine veraltete Planung zugrunde gelegt worden.
Die bereits erwähnte, im Bewertungsgutachten offengelegte und auch vom sachverständigen Prüfer erwähnte (PB Seite 30) „methodische Unterstützung“ erschöpfte sich nach Darstellung der Antragsgegnerin in der „technischen Verarbeitung“ der Plandaten inklusive Steuerplanung und Finanzierungsrechnung in einem „integrierten Planungsmodell“ bestehend aus Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Kapitalflussrechnungen. Der Bewertungsgutachter habe weder dem Grunde noch der Höhe nach Einfluss auf die Aktualisierung der Planzahlen genommen (Bl. 517 d.A.). Zwar hat der sachverständige Prüfer in der mündlichen Verhandlung am 22. November 2016 angegeben, es seien „durch X in Abstimmung und in der Diskussion mit dem Vorstand Aktualisierungen bezogen auf ca. vier Länder“ vorgenommen worden (Bl. 796 d.A.), was doch auf eine gewisse inhaltliche Einflussnahme auf die unternehmensinterne Planung hindeutet. Auffällig ist auch, dass die Verabschiedung der „modifizierten Planung“ am 14. Mai 2014 exakt auf den Tag fällt, an dem das Bewertungsgutachten erstattet wurde (BewGA Seite 117). Das kann angesichts des über 200 Seiten umfassenden Bewertungsgutachtens, das auf diesen Planzahlen beruht, nur bedeuten, dass die „modifizierten“ Planzahlen, die am 14. Mai 2014 verabschiedet wurden, (mindestens) schon zuvor gegenüber dem Bewertungsgutachter kommuniziert oder mit ihm besprochen worden sein müssen, damit sie überhaupt noch „analysiert“ werden konnten.
Es kann aber nicht festgestellt werden, dass der Bewertungsgutachter oder der sachverständige Prüfer etwa eigenmächtige Plananpassungen vorgenommen hätten oder ihre eigene Planung anstelle derjenigen des Vorstands zur Bewertungsgrundlage gemacht hätte, was im Regelfall unzulässig wäre (vgl. OLG Stuttgart, Beschluss vom 24. Juli 2013 - 20 W 2/12 - Rn. 128 f.; auch OLG Düsseldorf, Beschluss vom 12. November 2015 – I-26 W 9/14 (AktE) –, Rn. 33, juris zu Sonderfällen). Mit der bereits erwähnten Verabschiedung der „aktualisierten Planung“ durch den Vorstand am 14. Mai 2014, auf die sowohl das Bewertungsgutachten als auch der Prüfungsbericht abstellen, ist deutlich geworden, dass der Vorstand – und nicht etwa der Bewertungsgutachter oder der sachverständige Prüfer – die Verantwortung für die der Bewertung insgesamt zugrunde gelegten aktualisierten Planzahlen übernommen hat.
Losgelöst von der hier doch bemerkenswerten zeitlichen Koinzidenz, ist die Mitwirkung des Bewertungsgutachters an einer Planaktualisierung in der Praxis üblich und grundsätzlich unbedenklich. Sie widerspricht der Rolle des Bewertungsgutachters nicht (OLG Stuttgart, Beschluss vom 02. Dezember 2014 – 20 AktG 1/14 –, Rn. 93, juris). Wenn der Vorstand – und wenn auch nur aufgrund eines Hinweises des Bewertungsgutachters auf die fehlende Plausibilität der bisherigen Planung – seine Planung „nach den Vorgaben“ anpasst, ist auch nach Auffassung anderer Gerichte fortan diese neue Planung als solche des Vorstands anzusehen, von der im Zuge der weiteren Unternehmensbewertung und sodann auch in dem gerichtlichen Spruchverfahren auszugehen ist (LG Frankfurt, Beschluss vom 27. Mai 2014 – 3-05 O 34/13 –, Rn. 43, juris).
Gegen das von einzelnen Antragstellern behauptete Vorliegen einer „anlassbezogenen Negativplanung“ spricht inhaltlich bereits die Tatsache, dass in der konsolidierten Planungsrechnung der A-Gruppe für 2014 im Vergleich zum abgeschlossenen Geschäftsjahr 2013 mit einem Anstieg des Jahresergebnisses auf 208 Mio. EUR geplant wurde (bei einem Ist-Wert von 166 Mio. EUR für 2013, vgl. Bl. 517 Rs.). Auf einzelne Planzahlen und deren Plausibilisierung wird später noch eingegangen.
4. Plausibilität der Planzahlen (Detailplanungsphase)
Planungen und Prognosen sind in erster Linie ein Ergebnis der jeweiligen unternehmerischen Entscheidung der für die Geschäftsführung verantwortlichen Personen. Diese Entscheidungen müssen auf zutreffenden Informationen und daran orientierten, realistischen Annahmen beruhen; sie dürfen nicht in sich widersprüchlich sein. Kann die Geschäftsführung auf dieser Grundlage vernünftigerweise annehmen, ihre Planung sei realistisch, darf ihre Annahme nicht durch andere - letztlich ebenfalls nur vertretbare - Annahmen des Gutachters oder des Gerichts ersetzt werden. Im Rahmen eines Spruchverfahrens unterliegt die der Bewertung zugrunde gelegte Planung einer nach den vorgenannten Maßstäben eingeschränkten gerichtlichen Prüfung (OLG Stuttgart, Beschluss vom 02. Dezember 2014 – 20 AktG 1/14 –, Rn. 79, juris m.w.N.; OLG Stuttgart, Beschluss vom 17. Oktober 2011 – 20 W 7/11 –, Rn. 180, juris; OLG Stuttgart, Beschluss vom 14. September 2011 – 20 W 4/10 –, Rn. 71, juris).
a. Prüfung anhand von Vergangenheitszahlen und Branchenvergleich aa.
Sowohl der Bewertungsgutachter (BewGA Seite 52 ff.) als auch der sachverständige Prüfer haben eine Vergangenheitsanalyse vorgenommen, um die Planungstreue zu überprüfen. Das entspricht dem IDW S 1-Standard (Tz. 72). Diese Analyse verfolgt vor allem den Zweck zu ermitteln, inwieweit die Zukunftsprognosen – hier insbesondere die Planzahlen für die Jahre 2014 bis 2018 – plausibel sind.
Der Bewertungsgutachter hat dabei festgestellt, dass sowohl in Bezug auf die Umsatzerlöse als auch das EBIT die früheren Planzahlen verfehlt wurden, also zu optimistisch waren. In Bezug auf das geplante Jahresergebnis der Geschäftsjahre 2009 bis 2013 ergibt sich aus seiner Gegenüberstellung sogar, dass die geplanten Ergebnisse später durchgängig nicht erreicht, sondern teils deutlich unterschritten wurden (BewGA Seite 53). Als Ursachen hat er ein in den einzelnen Märkten nicht realisiertes Marktwachstum in Bezug auf Mengen und Preise insbesondere aufgrund von Sparmaßnahmen der staatlichen Gesundheitssysteme, nicht erreichte Marktanteilsgewinne sowie überplanmäßige Kundenrabatte und Währungskurseffekte ausgemacht. Im Ergebnis seien die betrachteten konsolidierten Planungsrechnungen jeweils „sehr optimistisch“ im Vergleich zu den Ist-Zahlen gewesen (BewGA Seite 54).
Vorgenommene Bereinigungen der Vergangenheitszahlen beruhen auf einmaligen, außergewöhnlichen und voraussichtlich nicht wiederkehrenden Ergebniseffekten und nicht fortgeführten Geschäftsaktivitäten, sind in Anlage 2 des Bewertungsgutachtens transparent und mit Einzelerläuterungen sehr detailliert dargestellt (BewGA Seite 128 ff.) und dienen der besseren Vergleichbarkeit mit den Planzahlen.
bb. Branchenvergleich
Der Bewertungsgutachter hat die geplante Umsatzentwicklung auch einem Branchenvergleich unterzogen und dabei festgestellt, dass das für die Jahre 2015 bis 2017 geplante Umsatzwachstum im Vergleich zur prognostizierten Marktentwicklung geringer ausfalle. Der Bewertungsgutachter hat allerdings auch sachliche Gründe genannt, die diese im Branchenvergleich zurückhaltendere Planung rechtfertigen: erstens marktsegmentspezifische Faktoren und strategische Annahmen der Gesellschaft, die von der generellen Marktentwicklung abweichen (u.a. geplante Umsatzverluste durch Rabattreduzierungen zur Sicherstellung der Profitabilität); zweitens der Wegfall eines bedeutenden Distributionsvertrages in Norwegen im Planjahr 2015. Zum Ende des Detailplanungszeitraums nähere sich die erwartete Umsatzentwicklung der prognostizierten Gesamtentwicklung an und liege im Planjahr 2018 wieder auf Marktniveau (BewGA Seite 76).
Auch der sachverständige Prüfer hat die Planung anhand einer Analyse des Markt- und Wettbewerbsumfeldes der A AG überprüft und anhand von Zahlen belegt, dass die zum Vergleich herangezogenen Unternehmen eine sehr hohe Bandbreite der erwarteten Wachstumsraten der Umsatzerlöse (etwa für 2015: zwischen 1,3% und 20,5%) aufweisen. Die Aussagekraft des Vergleichs sei jedoch eingeschränkt, u.a. weil auch das erwartete Umsatzwachstum einzelner Wettbewerber durch Sondereffekte bei Akquisitionen verzerrt werde (PB Seite 35).
Der sachverständige Prüfer hat auch die geplante Entwicklung der EBIT-Marge einem Vergleich mit Wettbewerbern unterzogen. Ziel solcher Vergleiche (auch mit Branchenunternehmen, über deren Vergleichbarkeit man streiten könne) sei, sich einen guten Eindruck über die Marktentwicklung zu verschaffen, in die das zu bewertende Unternehmen eingegliedert ist, und durch solche Vergleiche eine Entwicklung zu erkennen, die „völlig aus der Reihe fällt“ und die ein Hinweis auf einen „strukturellen Bruch“ (in der Planung) sein könnte, was dann weitere Plausibilisierungsmaßnahmen auslöse. Ein solcher struktureller Bruch sei hier aber nicht erkennbar (Bl. 799 d.A.). Die A AG habe bereits in der Vergangenheit deutlich niedrigere EBITDA- und EBIT-Margen erzielt als die meisten Vergleichsunternehmen. Die Fortschreibung dieser Entwicklung hielt er daher für plausibel (PB Seite 37).
b. Synergien
Einige Antragsteller kritisieren die Behandlung von Synergieeffekten bei der Unternehmensbewertung.
Die Gesellschaft musste auf „stand alone-Basis“ für die Zwecke der Abfindungs- und Ausgleichsbestimmung nach §§ 304, 305 AktG so bewertet werden, wie sie ohne den Unternehmensvertrag stünde (OLG Stuttgart, Beschluss vom 05. Juni 2013 – 20 W 6/10 – , Rn. 169, juris; OLG Frankfurt, Beschluss vom 28. März 2014 – 21 W 15/11 –, Rn. 146, juris). Es durften nur solche Synergien oder Verbundeffekte Berücksichtigung finden, die auch ohne die geplante Strukturmaßnahme durch Geschäfte mit anderen Unternehmen hätten realisiert werden können. Der Anspruch auf angemessenen Ausgleich und angemessene Abfindung gewährt kein Recht auf die Beteiligung an Vorteilen, die sich ohne den Unternehmensvertrag gar nicht ergeben hätten (OLG Stuttgart, Beschluss vom 04. Februar 2000 – 4 W 15/98 –, Rn. 23, juris; vgl. auch LG München I, Beschluss vom 28. April 2017 – 5 HK O 26513/11 –, Rn. 94, juris m.w.N.).
Dementsprechend basiert die „objektivierte Bewertung“ eines Unternehmens nach dem IDW S1-Standard i.d.F. 2008 (Abschnitt 4.4.2, Tz. 32) auf der am Bewertungsstichtag vorhandenen Ertragskraft, die die Ertragschancen von zum Bewertungsstichtag bereits eingeleiteten Maßnahmen oder aus hinreichend konkretisierten Maßnahmen im Rahmen des bisherigen Unternehmenskonzepts und der Marktgegebenheiten ergeben. Mögliche, aber noch nicht hinreichend konkretisierte Maßnahmen sowie die daraus vermutlich resultierenden finanziellen Überschüsse sind danach bei der Ermittlung des objektivierten Unternehmenswerts unbeachtlich. Der IDW S1-Standard i.d.F. 2008 (Tz. 33 f.) unterscheidet weiter zwischen echten und unechten Synergieeffekten. Echte Synergieeffekte sind solche, die sich erst aufgrund des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages realisieren lassen; sie bleiben bei der Bewertung außer Betracht. Sogenannte unechte Synergieeffekte, d.h. solche, die sich ohne Durchführung der dem Bewertungsanlass zugrunde liegenden Maßnahme realisieren lassen, sind hingegen zu berücksichtigen, wenn und insoweit die Synergie stiftenden Maßnahmen bereits eingeleitet oder im Unternehmenskonzept dokumentiert sind (IDW S1, Tz. 34).
Die „vorvertraglichen Synergien“, von deren Berücksichtigung in den Planzahlen im Bewertungsgutachten die Rede ist (BewGA Seite 78), sind solche unechten Synergieeffekte, die in die Bewertung mit eingeflossen sind. Sie belaufen sich auf 2,2 Mio. EUR für das Planjahr 2015, 6,6 Mio. EUR für 2016, 9,3 Mio. EUR für 2017 und 11,3 Mio. EUR für 2018. Der sachverständige Prüfer hat bestätigt, dass die auch ohne Unternehmensvertrag denkbaren Vorteile aus einem Einkaufsverbund vollständig in der Planung werterhöhend berücksichtigt worden seien (PB Seite 34).
Soweit einige Antragsteller auf eine Pressemitteilung von K vom 24. Oktober 2013 abstellen, in der geschätzte Synergieeffekten zwischen 275 Mio. und 325 Mio. US-$ ausgewiesen seien, handelt es sich den Ausführungen des sachverständigen Prüfers im Prüfungsbericht zufolge im Wesentlichen um Vorteile, die den Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages voraussetzen und die als echte Synergieeffekte unberücksichtigt blieben und bleiben durften (PB Seite 34). Zudem hat K in die Eigendarstellung nach Angaben der Antragsgegnerin auch Steuervorteile mit einbezogen, die ausschließlich K zugute kommen und die daher keine Bewertungsrelevanz haben (Bl. 534 d.A.).
Die von einigen Antragstellern geforderte genauere Aufteilung der bezifferten und in die Planung einbezogenen Synergieeffekte ist im vorliegenden Fall für Bewertungszwecke nicht erforderlich, zumal im Rahmen einer Übernahme keine detaillierte Berechnung zu publizierten Synergiepotentialen erwartet werden kann (vgl. PB Seite 33).
c. Plausibilisierung der Planzahlen im Einzelnen aa. Umsatzerlöse
Der Bewertungsgutachter hat die geplanten Zahlen der A AG zur Umsatzentwicklung als „insgesamt nachvollziehbar und plausibel“ bezeichnet (BewGA Seite 77). Der sachverständige Prüfer hat ebenfalls ausgeführt, dass er die Planung u.a. in Bezug auf die Umsatzerlöse für plausibel halte (PB Seite 37).
Bei der Gewichtung ist zunächst zu berücksichtigen, dass beim Geschäft der A AG vor dem Bewertungsstichtag das Großhandelssegment „Pharmacy Solutions“ mit einem Umsatzanteil von über 80% dominierte, während der relative Beitrag des Bereichs „Consumer Solutions“ auf Ergebnisebene deutlich größer war (PB Seite 31). Mehr alszwei Drittel der Umsatzerlöse des Geschäftsbereichs „Pharmacy Solutions“ wiederum entfallen auf Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Betrachtet man die Umsätze der Vergangenheit, so war der Großhandelsmarkt in Frankreich für die A AG mit Abstand am bedeutsamsten (BewGA Seite 65).
Die geplanten Umsatzerlöse in Summe ergeben sich aus der Tabelle auf Seite 54 im Bewertungsgutachten, die Aufschlüsselung nach Geschäftsbereichen / Holding aus Seite 32 des Prüfungsberichts. Ein Vergleich mit den dort ebenfalls wiedergegebenen Ist- Zahlen für 2011 bis 2013 zeigt, dass die Gesellschaft nach einem Anstieg 2013/2014 in den Jahren 2015 und 2016 mit geringeren Umsätzen und erstmals für 2017 mit einem Umsatz in etwa auf dem Niveau von 2012 und sodann mit weiterem Umsatzwachstum plante. Dabei schlägt insbesondere der planmäßige Rückgang im Bereich „Pharmacy Solutions“ zu Buche, während im Geschäftsbereich „Consumer Solutions“ schon ab dem ersten Planjahr 2014 gegenüber den Ist-Zahlen für 2013 durchgängig bis 2018 mit einem kontinuierlichen Umsatzwachstum gerechnet wurde, das aber den Planzahlen zufolge den vorübergehenden Einbruch im Geschäftsbereich „Pharmacy Solutions“ nicht kompensieren konnte. Die Gesellschaft plante also mit einer Verschiebung des „Umsatzmixes“ (PB Seite 31).
Sowohl aus dem Bewertungsgutachten als auch aus dem Prüfungsbericht ergeben sich nachvollziehbare Begründungen, die für die Angemessenheit dieser konkreten Umsatzplanung sprechen. Angesprochen werden etwa
- als Erklärung temporärer Umsatzverluste im Geschäftsbereich „Pharmacy Solutions“ u.a. Kundenabwanderungen durch die geplante Neustrukturierung des Rabattsystems in Deutschland bei „seit 2012 anziehendem Rabattwettbewerb, intensiviert ab 2013“; drastische staatliche Einsparungsziele mit dadurch bedingten Marktrückgängen in Frankreich bei ohnehin schon angespannter Wettbewerbssituation; Verlust des Krankenhausgeschäfts in Norwegen mit dadurch bedingtem Wegfall eines Großteils der bisherigen Umsatzerlöse ab 2015; Verlust eines Distributionsvertrages in Großbritannien aufgrund einer Ausschreibung; erwartete Abwertung des brasilianischen Real; rückläufige Absatzpreise in Österreich durch bereits 2012/2013 vorherrschenden Preisdruck und massive Generikasubstitution (PB Seite 32; BewGA Seite 65, 66, 67);
- erwartete Umsatzbelastungen in Italien 2014 im Geschäftsbereich „Consumer Solutions“ durch Preisrückgänge für verschreibungspflichtige Medikamente nach in der Vergangenheit gegenüber dem Gesamtmarkt deutlich besserer Entwicklung (BewGA Seite 57);
- bereits seit längerer Zeit anhaltende negative Entwicklungen, etwa der seit 2012 in Deutschland intensivierte Preiswettbewerb, der zu einem Verfall der durchschnittlichen Großhandelsmargen und zu einem Anstieg der Großhandelsrabatte an Apotheken führte, verbunden mit der Koppelung der Vergütung der Distributionsleistung an die Herstellerabgabepreise und ein reguliertes Preissystem (vgl. BewGA Seite 137 f.).
Mögliche positive Effekte aus der alternden Bevölkerung in Europa sind, wie sich aus dem Bewertungsgutachten ergibt, in der Planung bereits berücksichtigt. Danach rechnet man mit steigenden Ausgaben für Gesundheitsleistungen und einem Volumenwachstum. Gerade deshalb sind jedoch gesetzgeberische Eingriffe in den Pharmadistributionsmarkt zu erwarten, und häufig sind Arzneimittelpreise ohnehin regulatorisch festgelegt. Pharmahersteller versuchen wiederum durch Änderung ihrer Vertriebsmodelle (u.a. Direktbelieferung von Krankenhäusern durch die Hersteller) Kosteneinsparungen zu erzielen und selbst die Margenpotentiale (anstelle der Großhändler) auszuschöpfen. Hieraus ergibt sich für den Pharmagroßhandel permanenter regulatorischer und wettbewerbsbedingter Preis- und Margendruck. Wenn noch hinzu kommt, dass es für die Abnehmer zunehmend keine Hürde mehr darstellt, den Großhändler zu wechseln, dann wird deutlich, dass sich trotz der eingangs genannten demographischen Entwicklung für den Pharmagroßhandel, in dem die A AG den weit überwiegenden Anteil ihres Gesamtumsatzes generierte, nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten zur Steigerung von Umsatz und Profitabilität ergeben (vgl. BewGA Seite 32 f.; Bl. 520 d.A.).
Die Antragsteller Ziff. 32 und 33 haben darauf hingewiesen, dass es eine strategische Fehlentscheidung der A AG gewesen sei, durch den Aufbau des Versandgeschäfts unter der Bezeichnung „M“ das Direktgeschäft der Einzelapotheken zu schädigen. Die von der A AG betriebene „Versandkonkurrenz“ habe die Apotheken veranlasst, das Unternehmen zu boykottieren, so dass die A AG trotz Preiszugeständnissen Marktanteile verloren habe (Bl. 238, 273 d.A.). Auch dies spricht eher für als gegen die Richtigkeit der sehr vorsichtigen Planung bezüglich der weiteren Umsatzentwicklung und für die Prognose, dass die Entwicklung von A AG hinter seinen Wettbewerbern zurückbleibe. Im Übrigen spricht der „Boykott“ für die Marktmacht der Apotheken, den das Z-Gutachten anscheinend in Zweifel zieht (Z-GA Seite 11).
Dass einzelne Planannahmen mit Blick auf vergangene Wachstumsraten in einzelnen Ländern, in denen die A AG schwerpunktmäßig tätig ist, durchaus hinterfragt werden könnten (vgl. Z-GA Seite 13), mag sein. Dass man mit Blick hierauf durchaus auch positiver planen könnte, ist aber nach dem oben Gesagten noch kein Beleg dafür, dass die Planung des Vorstands tatsächlich vollkommen „unrealistisch“ wäre, nachdem es um eine vertretbare Prognose und „Erwartungswerte“ geht.
Soweit im Z-Gutachten hervorgehoben wird, der Bewertungsgutachter spreche von einem „ambitionierten“ geplanten Umsatzwachstum, während der sachverständige Prüfer es als „unterdurchschnittlich“ bezeichnet habe (Z-GA Seite 20), kommt in derartigen Unterschieden die eigenständige Rolle des sachverständigen Prüfers zum Ausdruck, dessen Aufgabe es ist, die Angemessenheit der vom Bewertungsgutachter ermittelten Abfindung eigenständig zu überprüfen. Das spricht nicht etwa, wie Z meint, für die „Unzulänglichkeit“ der vorgenommenen Bewertung bzw. Prüfung.
Z gibt zu erkennen, dass die Plausibilität der Annahme hinsichtlich des geänderten Produktmixes im Geschäftsbereich „Consumer Solutions“ „grundsätzlich nur schwer nachprüfbar“ sei, hält die Annahme aber „langfristig als nicht sachgerecht“, ohne wiederum diese These zu belegen (Z-GA Seite 30; auf den Folgeseiten geht es um die Analyse von EBIT-Margen allgemein). Das kann nur bedeuten, dass es auch aus Sicht von Z keinen Beleg dafür gibt, dass die getroffene planerische Annahme unrealistisch sei. Offenkundig wird – im Rahmen der gerichtlichen Angemessenheitsprüfung unzulässigerweise – versucht, eine anhand von Fakten nicht widerlegbare unternehmerische Planungsprämisse zur veränderten Gewichtung verschiedener Umsätze durch eine eigene zu ersetzen.
Es ist nicht zulässig, an die Stelle der nach den oben genannten Kriterien nicht zu beanstandenden Umsatzplanung des Vorstands im Rahmen einer ex-post-Betrachtung die inzwischen für den Planungszeitraum überwiegend bereits bekannten Ist- Umsatzzahlen zu setzen (OLG Frankfurt, Beschluss vom 30. März 2009 – 20 W 101/04 – , Rn. 42, juris). Die Entwicklung nach dem Bewertungsstichtag kann allenfalls zur Prüfung der Plausibilität der Unternehmensplanung herangezogen werden (OLG Stuttgart, Beschluss vom 14. September 2011 – 20 W 4/10 –, Rn. 88, juris).
Dass der Umsatz der A-Gruppe im Geschäftsjahr 2014 (22.326 Mio. EUR, also +4,8% gegenüber 2013, vgl. Bl. 520 Rs. und BewGA Seite 54) rund 3,5% über dem prognostizierten Umsatz lag (21.581 Mio. EUR, also geplant +1,3% gegenüber 2013), deutet zwar auf eine ins Gewicht fallende Schätzungenauigkeit und eine sehr vorsichtige Prognose hin. Die Antragsgegnerin hat insoweit u.a. auf Währungseffekte infolge des am Bewertungsstichtag nicht vorhersehbaren Ergebnisses des schottischen Unabhängigkeitsreferendums (zugunsten des Verbleibs bei Großbritannien) verwiesen (Bl. 520 Rs. d.A.). Wie die vom Bewertungsgutachter vorgenommene Analyse der Planungstreue zeigt, hatte es auch bei vorausgegangenen Planungen in Bezug auf den Umsatz teils noch deutlichere Abweichungen in die eine oder andere Richtung gegeben (etwa 2010: Ist-Zahlen 6,0% über den Planzahlen; 2011: 1,3%; demgegenüber etwa 2011: Ist-Plan-Abweichung -4,1%; vgl. BewGA Seite 53). Unabhängig davon gibt die festzustellende Abweichung wegen des Prognosecharakters der unternehmerischen Planung, angesichts der ihr zugrunde liegenden sachlichen Erwägungen und wegen fehlender hinreichend konkreter Anhaltspunkte für bewusst „falsche“, unrealistische Planungsprämissen des Vorstands in tatsächlicher Hinsicht keinen Anlass, die Plausibilität der unternehmerischen Planung in Frage zu stellen und diese durch fiktive, für die außenstehenden Aktionäre günstigere Planzahlen zu ersetzen.
Betrachtet man die länderbezogene Aufteilung des europäischen Gesamtmarkt des Pharma(groß)handels einerseits (auf der Basis der von IMS Health, einem US- amerikanischen Marktforschungsunternehmen in der Pharmabranche stammenden, im Bewertungsgutachten offengelegten Zahlen, BewGA Seite 34) und die tatsächliche bisherige Verteilung der Umsatzerlöse der A AG im Geschäftsbereich „Pharmacy Solutions“ nach Ländern andererseits (BewGA Seite 65), so fällt beispielsweise der überproportionale von der A AG in Frankreich erzielte Umsatzanteil auf (tatsächliches Gewicht bezogen auf 2013 von rund 38% bei nur rund 24% gewichtetem Marktvolumen; vgl. auch Tabelle in der Antragserwiderung, Bl. 522 Rs.). Schon dieser Vergleich zeigt, dass Vergleiche der Planzahlen bezogen auf den Gesamtumsatz im Bereich „Pharmacy Solutions“ mit Prognosen der Branche für die europäische Gesamtentwicklung in diesem Bereich nur sehr eingeschränkte Aussagekraft besitzen und nicht geeignet sind, die Planung in Zweifel zu ziehen. Hinzu kommt, dass sich die A AG auch in der Vergangenheit teils schlechter als Vergleichsunternehmen der Branche entwickelt hatte, wie bereits erwähnt und im Prüfungsbericht näher erläutert (PB Seite 35 ff.).
In Anlage 3 zum Bewertungsgutachten (BewGA Seite 134 ff.) werden die länderspezifischen Markt- und Planungsanalysen ausführlich dargestellt. Damit ist insoweit auch für hinreichende Transparenz der Planungsanalyse gesorgt. Die länderbezogenen Planungen wurden in der jeweils gültigen Landeswährung geplant (Bl. 802 d.A.). Laut Bewertungsgutachten beruhten die Planungen der Gesellschaft auf der Annahme eines konstanten Wechselkursniveaus, jedoch wurden bei der Umrechnung in EUR zur Abbildung zu erwartender Wechselkursschwankungen Forward Rates verwendet (BewGA Seite 55). In den Vergangenheitszahlen sind Wechselkursgewinne und –verluste zusammen mit anderen Positionen im Finanzergebnis berücksichtigt. Laut Bewertungsgutachten ist man für den Detailplanungszeitraum von einem „neutralen Wertbeitrag“ des übrigen Finanzergebnisses ausgegangen (BewGA Seite 80). Der sachverständige Prüfer ging hingegen bei seiner Anhörung von einer Planung auf der Basis konstanter Kurse aus (Bl. 802 d.A.). Die Antragsgegnerin dagegen hat vorgetragen, man habe für die Planjahre 2014 und 2015 mit Forward Rates gearbeitet und ab dem Planjahr 2016 zum Vorteil der außenstehenden Aktionäre konstante Wechselkurse unterstellt (Bl. 525 Rs. d.A.). Zunächst ist festzuhalten, dass die angemessene Vorgehensweise in Bezug auf Wechselkursschwankungen bei der Bewertung vom konkreten Einzelfall abhängt (nicht jede Schwankung wird bei unterschiedlichen Unternehmen in gleicher Weise bewertungsrelevant sein). Zudem ist die Frage in der Betriebswirtschaftslehre und Unternehmensbewertung noch nicht geklärt, wie der sachverständige Prüfer ausgeführt hat (Bl. 801 d.A.; vgl. dazu auch Duscha/Ihlau/Köllen, BB 2015, 1323; LG München I, Beschluss vom 28. April 2017 – 5 HK O 26513/11 –, Rn. 76, juris: Vorzugswürdigkeit des Ansatzes von Forward Rates bei Erwirtschaftung eines erheblichen Teils der Umsätze in Währungen außerhalb des Euro-Raumes). Im Rahmen eines Spruchverfahren gehört es nicht zu den Aufgaben des Gerichts, wirtschaftswissenschaftlich umstrittene Fragen der Unternehmensbewertung zu klären oder hierzu auch nur einen Beitrag zu leisten. Bei noch nicht abgeschlossener wirtschaftswissenschaftlicher Diskussion kann das Gericht auf alle Bewertungen zurückgreifen, die auf in der Wirtschaftswissenschaft anerkannten und in der Praxis gebräuchlichen Bewertungsmethoden und methodischen Einzelfallentscheidungen beruhen (Steinle/Liebert/Katzenstein, in MünchHdB GesR 5. Aufl. 2016, § 34 Rn. 93). Demnach besteht in Bezug auf die Abbildung von Wechselkursveränderungen kein Anlass zur gerichtlichen Anpassung der Planung.
Soweit die Antragsteller das im Bewertungsgutachten angesprochene, plangemäß höhere Investitionsniveau im Planungszeitraum im Vergleich zu den Jahren 2011 und 2012 thematisieren (BewGA Seite 83), ergeben sich bereits aus dem Bewertungsgutachten plausible Argumente dafür, dass diese Investitionen sich nicht sofort umsatzsteigernd auswirken werden: Unter anderem geht es um die Erhaltung und Steigerung der Profitabilität durch Optimierung interner Prozesse, wie etwa der Implementierung eines neuen Warenwirtschaftssystems (BewGA Seite 83); derartige Maßnahmen haben jedoch keinen Einfluss auf den bereits geschilderten Wettbewerbsdruck, dem die A AG ausgesetzt ist und war. Die Antragsgegnerin hat im Übrigen vorgetragen, dass die Investitionen schon zur Erhaltung des aktuellen Umsatzniveaus unerlässlich seien (Bl. 527 d.A.).
bb. Materialaufwand, Personalaufwand, sonstige betriebliche Aufwendungen / Erträge.
Der von der A AG geplante Material- und Personalaufwand sowie das geplante sonstige betriebliche Ergebnis und die geplanten Abschreibungen ergeben sich für die Planjahre 2014 bis 2018, auch aufgeschlüsselt nach Geschäftsbereichen und Holding, aus dem Bewertungsgutachten (BewGA Seite 55 ff., 64 ff., 73). Landesspezifische Details werden in Anlage 3 zum Bewertungsgutachten erörtert (BewGA Seite 134 ff.).
Der von einigen Antragstellern angesprochene Zusammenhang bzw. vermeintliche Widerspruch zwischen der im Geschäftsbericht 2013 angekündigten Produktivitätssteigerung und der Entwicklung des geplanten Personalaufwandes ist nicht nachvollziehbar. Produktivitätssteigerungen lassen sich nicht allein durch Senkung von Personalkosten, sondern etwa auch durch Optimierungen im Bereich Einkauf und IT erreichen (vgl. Bl. 535 d.A.). Den Planzahlen lässt sich zudem entnehmen, dass der Personalaufwand im Geschäftsbereich „Consumer Solutions“ insgesamt unterproportional zu den Umsatzerlösen steigen soll (vgl. BewGA Seite 60). Demgegenüber wurde im Geschäftsbereich „Pharmacy Solutions“ zunächst eine wesentliche Reduktion der Personalkosten, dann aber ein überproportionaler Anstieg der Personalaufwendungen erwartet (BewGA Seite 70). Der von den Antragstellern behauptete Widerspruch ist auch angesichts teils gegenläufiger Effekte nicht festzustellen.
cc. EBITDA, EBITDA-Marge, EBIT und EBIT-Marge
Aus den vorstehend erörterten Planzahlen ergibt sich zunächst durch schlichte Addition bzw. Subtraktion das geplante EBITDA (d.h. der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, also letztlich die operative Leistungsfähigkeit vor Investitionsaufwand). Durch einen Vergleich mit der jeweils geplanten Gesamtleistung erhält man die EBITDA-Marge.
Das EBIT ergibt sich, wie im Bewertungsgutachten dargestellt, als rechnerisches Ergebnis aus dem hergeleiteten EBITDA abzüglich der Abschreibungen. Die EBIT-Marge ist der Quotient aus EBIT und Gesamtleistung im jeweiligen Planjahr.
Die Kritik, die EBIT-Planung sei „nicht nachvollziehbar und unplausibel“, ist vor dem Hintergrund der transparenten Darstellung der Berechnung im Bewertungsgutachten nicht begründet.
Zudem hat der sachverständige Prüfer die Planzahlen auch bezüglich EBITDA- und EBIT- Marge überprüft und als „plausibel und nachvollziehbar“ bezeichnet (PB Seite 37). Was einen denkbaren Vergleich mit EBIT-Margen von Wettbewerbern anbelangt, so ist zu berücksichtigen, dass die A AG nach den vom sachverständigen Prüfer bestätigten Feststellungen des Bewertungsgutachtens auch in der Vergangenheit geringere Margen erzielte als die meisten verglichenen Unternehmen. Die Kammer schließt sich nach eigener Überprüfung der Beurteilung des sachverständigen Prüfers an.
dd. Finanz- und Beteiligungsergebnis
Das in die Planzahlen aufgenommene Zinsergebnis wurde, wie aus dem Prüfungsbericht ersichtlich, bezogen auf den Detailplanungszeitraum von der A AG auf der Grundlage der Bilanzplanung anhand einer Cashflow-Berechnung unter Berücksichtigung der geplanten Ausschüttungsquoten berechnet. Der sachverständige Prüfer hat die Berechnungen nachvollzogen und die angemessene Ermittlung des Zinsergebnisses bestätigt (PB Seite 37 f.).
Dass entgegen der Kritik einiger Antragsteller weder die aktuelle Bonität der A AG noch diejenige zum Bewertungsstichtag allein ausschlaggebend sein kann für den zu veranschlagenden Zinsaufwand, weil dessen Höhe insbesondere vom Zinsaufwand aus bereits in der Vergangenheit emittierten Schuldverschreibungen der niederländischen Finanzierungsgesellschaft und vom Inhalt bereits vertraglich vereinbarter Finanzierungskonditionen abhängt (Bl. 528 Rs. d.A.), leuchtet der Kammer ohne Weiteres ein.
ee. Steuern
Die Planung der Ertragsteuern beruht auf einer nach Ländern differenzierten Berechnung (BewGA Seite 80 f.). Die der Bewertung zugrunde gelegten nominalen Steuersätze wurden von der Antragsgegnerin in der Antragserwiderung offengelegt (Bl. 530 d.A.). Die bereits im Bewertungsgutachten erwähnte und von der Antragsgegnerin auf entsprechende Kritik vertiefte Darstellung zur Nutzung inländischer Verlustvorträge (BewGA Seite 80 f.; Bl. 530 Rs. d.A.) erklärt die plangemäße Belastung inländischer Gewinne mit 0% in den Planjahren 2014 bis 2016 und 2018. Die im Planungszeitraum einmalige, dargelegte Überschreitung der Grenze der steuerlich nutzbaren Verluste erklärt die geringe geplante Körperschaftsteuerbelastung im Planjahr 2017.
5. Plausibilität der Prognose ab 2020 („ewige Rente“)
Der IDW S1 i.d.F. 2008 geht in nachvollziehbarer Weise davon aus, dass sich die künftige Entwicklung der finanziellen Überschüsse in der ersten Planungsphase, der Detailplanungsphase plausibler beurteilen und sicherer prognostizieren lasse als für die späteren Jahre. Die Planungsjahre der ferneren zweiten Phase basierten i.d.R. ausgehend von der Detailplanung der ersten Phase auf langfristigen Fortschreibungen von Trendentwicklungen, wobei zu untersuchen sei, ob sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nach der Phase der detaillierten Planung im sogenannten Gleichgewichts- oder Beharrungszustand befinde oder ob sich die jährlichen finanziellen Überschüsse zwar noch verändern, jedoch eine als konstant oder mit konstanter Rate wachsend angesetzte Größe die sich ändernden finanziellen Überschüsse finanzmathematisch angemessen repräsentiert (IDW S1 i.d.F. 2018, Abschnitt 5.3 Tz. 75-78).
Der Bewertungsgutachter geht aus der Perspektive des Bewertungsstichtages für den von der Detailplanungsphase der Gesellschaft nicht mehr erfassten Zeitraum („ewige Rente“) von folgender Ergebnisrechnung aus (BewGA Seite 54):
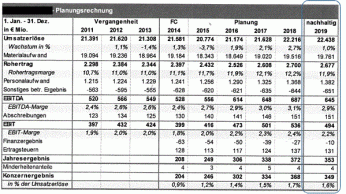
Bei der Ermittlung des nachhaltigen Ergebnisses ist der Bewertungsgutachter in Bezug auf die Umsatzerlöse von einem um 1% über dem Wert des letzten Planjahres liegenden Betrag von 22.438 Mio. EUR ausgegangen (BewGA Seite 85). Diese im Vergleich zur Inflationsrate moderate Erhöhung hat er nachvollziehbar u.a. mit aktuellen Markterwartungen der A AG, mit angekündigten regulatorischen Eingriffen in den europäischen Märkten, mit Auswirkungen weiterer zu erwartender Kostensenkungsmaßnahmen im Gesundheitssektor und mit der Einschätzung begründet, dass infolge der stark regulatorisch geprägten Preissetzung für Pharmahändler kaum Möglichkeiten bestünden, inflationsbedingt steigende Aufwendungen über korrespondierende Preisgestaltungen an ihre Kunden weiterzugeben (BewGA Seite 85).
Z kritisiert u.a., die These „regulatorischer geprägter Preissetzungen“ sei „ohne Nachweis geblieben“ (Z-GA Seite 35). Diese Kritik ist schlicht unbegründet. Der Bewertungsgutachter verweist bereits im allgemeinen Teil u.a. auf die regulatorischen Rahmenbedingungen der Preisbildung für Arzneimittel in den europäischen Ländern und auf die vertiefte länderspezifische Darstellung in Anlage 3 (BewGA Seite 25). Dort findet man exemplarisch für Deutschland Hinweise auf sog. „Zwangsrabatte“ für Medikamente, die über das staatliche Gesundheitssystem abgerechnet werden, und auf die Preisrelevanz der „Nutzenbewertung“ durch den Gemeinsamen Bundesausschuss nach SGB V (BewGA Seite 137). Für Österreich wird mit Quellenangabe auf die gesetzliche Regelung der Preisbildung von Arzneimitteln auf Großhandelsebene durch die „Preiskommission des Bundesministeriums für Gesundheit“ verwiesen; demnach gibt es dort Vorgaben für die Höhe des Großhandelsaufschlags auf den Herstellerabgabepreis je nach Preisstufe (BewGA Seite 165). Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Angaben in der länderbezogenen Anlage 3 des Bewertungsgutachtens verwiesen. Der von einzelnen Antragstellern über das Z-Gutachten erhobene Vorwurf der nicht sachgerechten Planung und der unzureichenden Überprüfung durch Bewertungsgutachter und sachverständigen Prüfer erweist sich also auch in diesem Punkt als nicht haltbar.
Das OLG Stuttgart hat bereits 2011 klargestellt, dass es an dem für die „ewige Rente“ zu fordernden „eingeschwungenen Zustand“ nicht schon dann fehlt, wenn das nachhaltige Gewinnwachstum unterhalb der erwarteten Inflationsrate bleibt (OLG Stuttgart, Beschluss vom 17. Oktober 2011 – 20 W 7/11 –, Rn. 440, juris). Dasselbe gilt für das Umsatzwachstum.
Für die Rohergebnismarge des nachhaltigen Ergebnisses hat der Bewertungsgutachter mit 11,9% eine etwas oberhalb des Durchschnitts der Marge in den Planjahren 2014 bis 2018 liegende Marge angesetzt. Für die nachhaltige EBITDA-Marge hat er mit 2,9% ebenfalls einen etwas oberhalb des Durchschnitts der Planjahre 2014 bis 2018 und über dem Durchschnitt der Peer Group liegenden Wert angenommen. Als nachhaltige EBIT- Marge hat er mit 2,2% einen dem Durchschnitt der Planjahre entsprechenden Wert zugrunde gelegt (BewGA Seite 86). Der sachverständige Prüfer hat bereits im Prüfungsbericht bekundet und bei seiner mündlichen Anhörung mit der Bezugnahme auf „unterschiedliche Denkschulen“ nochmals bestätigt, dass die prozentuale Fortschreibung der Umsatzerlöse und der Ansatz einer nachhaltigen, leicht über dem Mittelwert liegenden EBIT-Marge eine sachgerechte Alternative zur bloßen Fortschreibung des letzten Planjahres darstelle (PB Seite 40 f.; Bl. 803 d.A.). In der betriebswirtschaftlichen Literatur werden für die Ableitung eines nachhaltigen Zukunftserfolges („eingeschwungener Zustand“ bzw. „Gleichgewichts- oder Beharrungszustand“, vgl. OLG Stuttgart, Beschluss vom 17. Oktober 2011 – 20 W 7/11 – , Rn. 440, juris) verschiedene Vorschläge unterbreitet: die Fortschreibung des letzten Detailplanungsjahres, die Bildung eines Durchschnittswertes aus dem gesamten Detailplanungszeitraum oder die mittelbare Anknüpfung an die Detailplanungsphase (Wollny, Der objektivierte Unternehmenswert, 3. Aufl. 2018, 17.11.2 Seite 316 ff. mit kritischen Anmerkungen und m.w.N.). Wenn das zu bewertende Unternehmen in einer konjunkturabhängigen Branche tätig ist, muss das für die ewige Rente zugrunde gelegte Ergebnis dem eines „durchschnittlichen“ Jahres entsprechen, weil andernfalls Boom- oder Rezessionsphasen des Zyklus als Dauerzustand in die Zukunft fortgeschrieben werden, was zu unrealistischen Ergebnissen führt (OLG München, Beschluss vom 31. März 2008 – 31 Wx 88/06 –, Rn. 23, juris). Dass das Geschäft der A AG in hohem Maße zyklisch sei, hat der sachverständige Prüfer bei der Anhörung bestätigt (Bl. 804 d.A.).
Gegen nachhaltig steigende Margen spricht in der Tat der vom sachverständigen Prüfer bei der Anhörung angesprochene Gesichtspunkt, dass in der Branche zu erwarten ist, dass staatliche Regulierer (ebenso wie Wettbewerber und Marktakteure) auf einen vorübergehenden Anstieg von Margen der Pharmagroßhändler rasch reagieren. Die Marge könne in der ewigen Rente höher, aber auch niedriger sein als im letzten Planjahr. Sinngemäß hat er ausgeführt, dass die Ansätze nicht unplausibel seien, solange sich die angenommenen Margen im bisherigen Spektrum bewegten und es um Schwankungen im überschaubaren Bereich gehe (Bl. 803 f. d.A.).
Wie die folgende Tabelle zur geplanten Entwicklung des Konzernergebnisses zeigt (vgl. BewGA Seite 100),
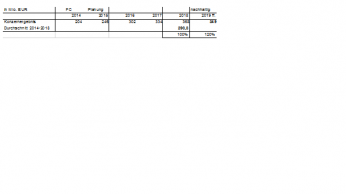
liegt das der Bewertung zugrunde gelegte nachhaltige Konzernergebnis mit 349 Mio. EUR um rund 20% über dem Durchschnitt der fünf Planjahre 2014 bis 2018. Angesichts dessen, dass die für die nachhaltig zu veranschlagenden Werte eine Schätzung darstellen, ist entgegen der von Z offenbar vertretenen Auffassung (Z-GA Seite 35 ff.) nicht zu fordern, dass jeder auf dem Weg zur Ableitung des nachhaltigen Ergebnisses eingesetzte Wert „belegt“ oder rechnerisch als „richtig“ nachgewiesen werden sollte.
Als Ergebnis hat der sachverständige Prüfer festgehalten, dass die Ableitung des nachhaltig ausschüttbaren Ergebnisses sachgerecht erfolgt sei (PB Seite 41). Die Kammer schließt sich diesem Votum an. Die dokumentierten Überlegungen des Bewertungsgutachters und des sachverständigen Prüfers bilden eine hinreichende Schätzgrundlage.
6. Ableitung der erwarteten Netto-Ausschüttungen
Anhand der vorstehend erörterten Zahlen ergeben sich die zu kapitalisierenden Ergebnisse, wie sie im Bewertungsgutachten in tabellarischer Form dargestellt sind (BewGA Seite 54 und 100).
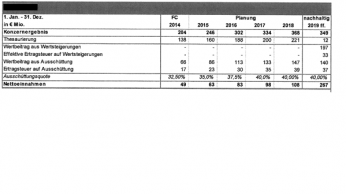
Dem Bewertungsgutachten zufolge, geht die unternehmerische Planung für die Detailplanungsphase von einer sukzessive von 32,5% auf 40,0% ansteigenden Ausschüttungsquote aus. Für die Phase der „ewigen Rente“ sei ebenfalls von einer langfristigen Ausschüttungsquote von 40% ausgegangen worden (BewGA Seite 100). Gegen die Zugrundelegung der Ausschüttungsplanung in der Detailplanungsphase bestehen keine Bedenken (vgl. auch OLG Stuttgart, Beschluss vom 15. Oktober 2013 – 20 W 3/13 –, Rn. 110, juris). Die für die „ewige Rente“ zugrunde gelegte Ausschüttungsquote von 40% begegnet ebenfalls keinen durchgreifenden Bedenken. Denn nach dem IDW S1-Standard ist in der Phase der ewigen Rente das Ausschüttungsverhalten des zu bewertenden Unternehmens äquivalent zu dem Ausschüttungsverhalten der Alternativanlage zu planen (IDW S1 i.d.F. 2008, Tz. 37). Solange sich die zugrunde gelegte Ausschüttungsquote im Rahmen der am Kapitalmarkt beobachtbaren Quoten bewegt, ist das nicht zu beanstanden (vgl. OLG Stuttgart, Beschluss vom 15. Oktober 2013 – 20 W 3/13 –, Rn. 111, juris unter Hinweis auf ein 2006 in der Literatur angegebenes Spektrum von 40 bis 60% nach Wagner/Jonas/Ballwieser/Tschöpel, Wpg 2006, 1005, 1009; zu der Bandbreite vgl. auch LG München I, Beschluss vom 28. April 2017 – 5 HK O 26513/11 –, Rn. 100, juris).
Aus diesem Grunde ist auch nicht erkennbar, welchen Inhalt und welchen zusätzlichen Erkenntnisgewinn die von Z offenbar für erforderlich gehaltene „spezifische Analyse“ der nachhaltigen Ausschüttungsquote für die A AG haben könnte (vgl. Z-GA Seite 41). Z verweist auf niedrigere durchschnittliche Ausschüttungsquoten einer Peer Group (Z-GA Seite 42), lässt dabei aber außer Betracht, dass in Bezug auf die Ausschüttungsquote bei der Alternativanlage nicht zwingend nur an Unternehmen zu denken ist, die in derselben Branche tätig sind. Im vorliegenden Fall kommt hinzu, dass offenkundig keines der Unternehmen der Peer Group seinen Sitz in Deutschland hat, und zwar ganz gleich, ob man auf die im Z-Gutachten auf Seite 42 oder auf Seite 46 aufgeführten Unternehmen abstellt. Aus Sicht der Kammer ist jedoch naheliegend, prognostisch auf das Ausschüttungsverhalten etwa von börsennotierten Aktiengesellschaften in Deutschland (unabhängig von der Branche) oder Europa abzustellen. Dass die Annahme einer Ausschüttungsquote von 40% nicht sachgerecht wäre, steht nicht fest. Für den von Z als Ausschüttungsquote der eigenen Peer Group ermittelte Wert von 30% (Z-GA Seite 46) spricht weder eine höhere „Richtigkeitsgewähr“ oder Wahrscheinlichkeit noch beweist (was mit Blick auf die zitierte ständige Rechtsprechung entscheidender wäre) die Berechnung von Z die Unvertretbarkeit der vom Bewertungsgutachter angenommenen und vom sachverständigen Prüfer nicht beanstandeten 40% Ausschüttungsquote für das nachhaltige Ergebnis im vorliegenden Fall.
IV. Kapitalisierungszinssatz
Der Wert der prognostizierten künftigen Überschüsse muss nach der Ertragswertmethode auf den Stichtag der Hauptversammlung abgezinst werden. Der hierfür heranzuziehende Kapitalisierungszinssatz soll die Beziehung zwischen dem bewerteten Unternehmen und den anderen Kapitalanlagemöglichkeiten herstellen.
1. Gesamtüberblick
Ausgangspunkt ist die im IDW S1-Standard niedergelegte, überzeugende und auch vom Bewertungsgutachten im vorliegenden Fall herangezogene Überlegung (BewGA Seite 88 f.), dass der zu ermittelnde Kapitalisierungszinssatz die Rendite aus einer zur Investition in das zu bewertende Unternehmen adäquaten Alternativanlage repräsentieren soll und dem zu kapitalisierenden Zahlungsstrom hinsichtlich Fristigkeit, Risiko und Besteuerung äquivalent sein muss (IDW S1 i.d.F. 2008, Tz. 114). Als Ausgangsgrößen für die Bestimmung von Alternativrenditen kommen dem Standard zufolge insbesondere Kapitalmarktrenditen für Unternehmensbeteiligungen (in Form eines Aktienportfolios) in Betracht, wobei sich die Renditen für Unternehmensanteile grundsätzlich in einen Basiszinssatz und in eine von den Anteilseignern aufgrund der Übernahme unternehmerischen Risikos geforderte Risikoprämie zerlegen lässt (IDW S1 i.d.F. 2008, Tz. 115).
Der Bewertungsgutachter verwendet folgende Kapitalisierungszinssätze (BewGA Seite 100):
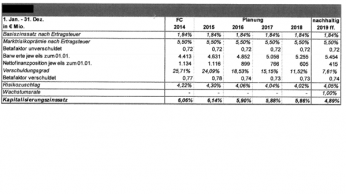
2. Nachsteuerbetrachtung
Die vorgenommene Nachsteuerbetrachtung sowie die zu Grunde gelegten Steuersätze können der gerichtlichen Schätzung zu Grunde gelegt werden. Die Nachsteuerbetrachtung, wonach die Auswirkungen persönlicher Ertragssteuern der Anteilseigner zum einen auf der Ebene der künftigen Zuflüsse und zum anderen beim Kapitalisierungszinssatz berücksichtigt werden, ist für den vorliegenden Bewertungsanlass allgemein anerkannt und gebräuchlich. Dasselbe gilt für die Typisierung der steuerlichen Verhältnisse der Anteilseigner nach dem IDW-Standard (IDW S1 i.d.F. 2008, Tz. 28-31, 43 ff.; vgl. auch OLG Stuttgart, Beschluss vom 15. Oktober 2013 – 20 W 3/13 –, Rn. 113, juris).
3. Basiszinssatz
Nach dem IDW S1-Standard i.d.F. 2008 ist für den objektivierten Unternehmenswert bei der Bestimmung des Basiszinssatzes von dem „landesüblichen Zinssatz“ für eine (quasi) risikofreie Kapitalmarktanlage auszugehen, weshalb „grundsätzlich“ auf die langfristig erzielbare Rendite öffentlicher Anleihen abgestellt wird (IDW S1 i.d.F. 2008, Tz. 116).
Der Bewertungsgutachter hat die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichte Zinsstrukturkurve für Bundeswertpapiere herangezogen (BewGA Seite 90).
Das entspricht der Empfehlung des IDW im IDW S1-Standard (i.d.F. 2008, Tz. 117), ist methodisch in der Rechtsprechung anerkannt (vgl. OLG Karlsruhe, Beschluss vom 12. September 2017 – 12 W 1/17 –, Rn. 70, juris; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 06. April 2017 – I-26 W 10/15 (AktE) –, Rn. 45, juris; OLG Frankfurt, Beschluss vom 17. Januar 2017 – 21 W 37/12 –, Rn. 100, juris; Oberlandesgericht Saarbrücken, Beschluss vom 11. Juni 2014 – 1 W 18/13 –, Rn. 58, juris; LG München I, Beschluss vom 28. April 2017 – 5 HK O 26513/11 –, Rn. 113, juris) und entspricht der anerkannten Expertenauffassung des IDW (OLG Stuttgart, Beschluss vom 15. Oktober 2013 – 20 W 3/13 –, Rn. 124, juris). Die Zinsstrukturkurven bilden laufzeitspezifische Basiszinssätze ab. Aus laufzeitspezifischen Zinssätzen für einen langen Zeitraum kann finanzmathematisch ein barwertäquivalenter einheitlicher Basiszinssatz abgeleitet werden.
Die Unternehmensbewertung ist, vom hier nicht vorliegenden Sonderfall eines Unternehmens mit zeitlich begrenzter Lebensdauer abgesehen (vgl. IDW S1 i.d.F. 2008, Tz. 117), auf die Ewigkeit ausgelegt (vgl. LG München I, Beschluss vom 28. April 2017 – 5 HK O 26513/11 –, Rn. 113, juris). Weil das Unternehmen beim Ertragswertverfahren mit einer zeitlich unbegrenzten Lebensdauer bewertet wird, spricht man bezogen auf die künftigen Nettoerträge nach der Detailplanungsphase auch von der „ewigen Rente“. Dem bereits erwähnten (betriebswirtschaftlichen) Gebot der Laufzeitäquivalenz entsprechend, wäre als Basiszinssatz grundsätzlich die am Bewertungsstichtag zu erzielende Rendite einer zeitlich ebenfalls nicht begrenzten Anleihe der öffentlichen Hand heranzuziehen (IDW S1 i.d.F. 2008, Tz. 117). Weil es solche „ewigen Anleihen“ jedoch nicht gibt, zieht man nach dem IDW-Standard hilfsweise die Zinsstrukturkurven und zeitlich darüber hinausgehende Prognosen heran (IDW S1 i.d.F. 2008, Tz. 117), um so näherungsweise theoretische Rendite für Anleihen mit unendlicher Laufzeit zu ermitteln.
Betriebswirtschaftlich ist grundsätzlich zu fordern, dass der Kapitalisierungszinssatz für den zu kapitalisierenden Zahlungsstrom hinsichtlich Fristigkeit, Risiko und Besteuerung äquivalent ist (LG München I, Beschluss vom 28. April 2017 – 5 HK O 26513/11, Rn. 113, juris). Da die Regressionsparameter der Deutschen Bundesbank nur eine auf empirischen Daten basierende „unmittelbare“ Ableitung einer Zinsstrukturkurve für einen dreißigjährigen Zeitraum zulassen, es im vorliegenden Fall jedoch um die Ermittlung des Barwerts einer ewigen Rente geht, stellt das Bewertungsgutachten im vorliegenden Fall konsequenterweise nicht allein auf die Zinsstrukturkurve für einen dreißigjährigen Zeitraum ab, sondern setzt zur Abbildung einer Zinsstrukturkurve mit einer unendlichen Laufzeit den ermittelten Zero-Bond-Zinssatz für eine Restlaufzeit von dreißig Jahren als nachhaltigen Schätzwert an und ermittelt hieraus einen barwertäquivalenten „einheitlichen Basiszinssatz“ (BewGA Seite 90). Dass anstelle eines „einheitlichen Basiszinssatzes“ auch der Ansatz „fristenkongruent berechneter Zinssätze“ bzw. „periodenspezifischer Basiszinssätze“ für einzelne Zeiträume und Zahlungsströme theoretisch denkbar wäre, mag sein. Erstens rechtfertigt sich die einheitliche Festlegung des Basiszinssatzes aber bereits aus der Überlegung, dass Erträge zwar jährlich erzielt und ausgeschüttet werden sollen, die Dauer des Unternehmens und damit die Ermittlung des Ertragswertes aber in die Ewigkeit angelegt ist und demzufolge auch nicht von einer jährlich neu stattfindenden Alternativanlage ausgegangen werden kann, wenn Bewertungsanlass das Ausscheiden eines Aktionärs aus der Gesellschaft gegen Abfindung ist (vgl. LG München I, Beschluss vom 28. April 2017 – 5 HK O 26513/11 –, Rn. 116, juris). Zweitens entspricht die Verwendung eines typisierten, einheitlichen laufzeitkonstanten Basiszinssatzes anstelle von laufzeitspezifischen Zinsen einer Empfehlung des Fachausschusses für Unternehmensbewertung und Betriebswirtschaft des IDW von 2005 (vgl. dazu OLG Stuttgart, Beschluss vom 15. Oktober 2013 – 20 W 3/13 –, Rn. 125, juris; Beschluss vom 05. Juni 2013 – 20 W 6/10 –, Rn. 195, juris; Beschluss vom 27. Juli 2015 – 20 W 5/14 –, Rn. 97, juris). Sie steht außerdem in Einklang mit der aktuellen Empfehlung des IDW (vgl. IDW S1 2008 Rdn. 117; wie hier OLG Frankfurt, Beschluss vom 02. Mai 2011 – 21 W 3/11 –, Rn. 49, juris). Drittens entspricht es der allgemein üblichen Vorgehensweise, im Rahmen eines Bewertungsmodells notwendige Vereinfachungen und Pauschalierungen vorzunehmen. Das ist angesichts der gebotenen Schätzung des Unternehmenswerts nach § 287 Abs. 2 ZPO nicht zu beanstanden (vgl. OLG Stuttgart, Beschluss vom 15. Oktober 2013 – 20 W 3/13 –, Rn. 125, juris; Beschluss vom 05. Juni 2013 – 20 W 6/10 – , Rn. 195, juris; LG München I, Beschluss vom 28. April 2017 – 5 HK O 26513/11 –, Rn. 116, juris).
Im Übrigen hat der sachverständige Prüfer bestätigt, dass die Verwendung eines barwertäquivalenten einheitlichen Basiszinssatzes aus Praktikabilitätsgründen bei einer nicht stark schwankenden Zahlungsreihe zum gleichen Ergebnis führt (PB Seite 42; vgl. auch OLG Düsseldorf, Beschluss vom 14. Dezember 2017 – I-26 W 8/15 (AktE) –, Rn. 54, juris: „keine allzu hohe Abweichung“).
Das Bewertungsgutachten vom 14. Mai 2014 geht von einem unter Rückgriff auf die Zinsstrukturdaten im Dreimonatszeitraum vom 15. Februar bis 14. Mai 2014 ermittelten einheitlichen Basiszinszinssatz von 2,55% aus, der zur Glättung kurzfristiger Marktschwankungen und möglicher Schätzfehler auf 2,50% gerundet wurde (BewGA Seite 90). Der über den Dreimonatszeitraum zum Bewertungsstichtag 15. Juli 2014 abgeleitete einheitliche Basiszinssatz betrug ungerundet 2,397% (vgl. Bl. 547 d.A.), wie auch von einigen Antragstellern vorgetragen. Bei Vornahme einer Rundung auf volle ¼-Prozentpunkte ergibt sich wieder der bei der Bewertung tatsächlich zugrunde gelegte einheitliche Basiszinssatz von 2,50%. Eine Anpassung der Bewertung war daher bezüglich des zugrunde gelegten Basiszinssatzes nicht vorzunehmen.
Dass nicht auf den stichtagsgenauen Basiszinssatz, der sich mehr oder weniger zufällig ergibt, sondern auf einen Dreimonatsdurchschnitt – freilich aus der Perspektive des Stichtags - abgestellt wird, ist in der Rechtsprechung seit langem anerkannt (OLG Stuttgart, Beschluss vom 27. Juli 2015 – 20 W 5/14 –, Rn. 96, juris; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 06. Juni 2016 – I-26 W 4/12 (AktE) –, Rn. 20, juris; LG München I, Beschluss vom 28. April 2017 – 5 HK O 26513/11 –, Rn. 114, juris). Bei der Zukunftsprognose geht es um die aus der Sicht des Bewertungsstichtags von kurzfristigen Einflüssen bereinigte, künftig auf Dauer zu erzielende Verzinsung (OLG Stuttgart, Beschluss vom 15. Oktober 2013 – 20 W 3/13 –, Rn. 121, juris).
Die Kammer ist der Auffassung, dass es bei der vorgenommenen Rundung auf volle Viertelprozente bleiben kann, denn diese entspricht einer Empfehlung des FAUB von 2005 (IDW-FN 2005, Seite 555 ff.) und wurde in der Vergangenheit vom OLG Stuttgart nicht beanstandet (OLG Stuttgart, Beschluss vom 27. Juli 2015 – 20 W 5/14 –, Rn. 95, juris; im Ergebnis auch LG München I, Beschluss vom 02. Dezember 2016 – 5HK 5781/15 –, Rn. 119, juris, wonach die Aufrundung von § 287 Abs. 2 ZPO gedeckt sei; ebenso noch OLG Karlsruhe, Beschluss vom 01. April 2015 – 12a W 7/15 –, Rn. 80, juris; kritischer jetzt im Beschluss vom 12. September 2017 – 12 W 1/17 –, Rn. 70, juris, wonach bei einer Bewertung unter Anwendung des IDW S1 i.d.F. 2005 „kein Anlass“ zur Rundung gesehen werde; vgl. auch OLG Düsseldorf, Beschluss vom 06. April 2017 – I-26 W 10/15 (AktE) –, Rn. 45, juris, das im entschiedenen Fall eine Abrundung als „keineswegs zwingend“ einschätzte, zugleich aber auf die beschränkte Plausibilitätsprüfung hinwies).
Die Nachsteuerbetrachtung ergibt dann unter Berücksichtigung des einkommensteuerlichen Steuersatzes der „Abgeltungsteuer“ von 25% zuzüglich Solidaritätszuschlag von 5,5%, also eines Steuerabzugs von 26,375% den im Bewertungsgutachten angegebenen Basiszinssatz nach Steuern von 1,84% (BewGA Seite 91). Der sachverständige Prüfer hat aufgrund eigener Berechnungen diesen Wert und zudem dessen Angemessenheit bestätigt (PB Seite 43).
4. Marktrisikoprämie
a. Grundsätzliche Überlegungen
aa. Zum Tax-CAPM und zur Kritik an dessen Anwendung
Dem IDW-Standard IDW S1 i.d.F. 2008 liegt die Überlegung zugrunde, dass sich Renditen für Unternehmensanteile grundsätzlich in einen Basiszinssatz und eine von den Anteilseignern aufgrund der Übernahme unternehmerischen Risikos geforderte Risikoprämie zerlegen lassen (Tz. 115). Dem Standard zufolge, können aus den am Kapitalmarkt empirisch ermittelten Aktienrenditen mithilfe von Kapitalmarktpreisbildungsmodellen („Capital Asset Pricing Model“, kurz CAPM; Tax- CAPM) Risikoprämien abgeleitet werden (Tz. 118).
Der Bewertungsgutachter hat, dem (Tax-)CAPM folgend, den ermittelten Basiszinssatz einer gedachten risikofreien Alternativanlage dementsprechend um einen Risikozuschlag erhöht, der sich als Produkt aus zwei Faktoren ergibt: der Marktrisikoprämie und dem Betafaktor (BewGA Seite 93). Der sachverständige Prüfer hat anderweitig geäußerte Vorbehalte gegen das Tax-CAPM erwähnt, die Üblichkeit und Angemessenheit der angewandte Methode aber inzident bestätigt (PB Seite 43). Neben dem CAPM oder dem Tax-CAPM werden in der Wirtschaftswissenschaft auch andere Methoden zur Ermittlung des Risikozuschlags wie etwa die „Risikozuschlagsmethode“ (dazu Veil, in Spindler/Stilz, AktG 3. Aufl. § 305 Rn. 89) erörtert. Letztere wird in der heutigen Literatur allerdings bereits als „überholt“ bezeichnet (Emmerich, in Emmerich/Habersack Aktien-/GmbH- KonzernR 8. Aufl. 2016, § 305 AktG Rn. 68 f.).
Das OLG München hat in einer Entscheidung von 2008 das Tax-CAPM nicht als unbrauchbar verworfen, aber zum Ausdruck gebracht, dass eine Festlegung des Risikozuschlags auch „pauschal aufgrund von Erfahrungswerten“ erfolgen könne. Das sei in der Vergangenheit weitgehend üblich gewesen und gebe „der subjektiven Beurteilung des Bewerters erheblichen Raum“. Der Senat halte das seinerzeit im Vordringen befindliche Tax-CAPM „nicht für überlegen“ (OLG München, Beschluss vom 31. März 2008 – 31 Wx 88/06 –, Rn. 31, juris). Richtig ist auch, dass die Bewertung nach dem Tax- CAPM wie jede andere Methodik der Unternehmensbewertung von subjektiven Einschätzungen des Bewerters abhängt. Die „Zuschlagsmethode“ ist aber keine intersubjektiv nachprüfbare Methode und deshalb dem Tax-CAPM nicht methodisch überlegen.
Es muss an dieser Stelle dahingestellt bleiben, ob und welche Vor- und Nachteile andere betriebswirtschaftliche Methoden gegenüber dem Tax-CAPM haben. Denn entscheidend bleibt nach den oben dargestellten Rechtsprechungsgrundsätzen der Angemessenheitsprüfung, dass das Tax-CAPM weiterhin eine in der Wirtschaftswissenschaft anerkannte, in der Bewertungspraxis gebräuchliche und in der Rechtsprechung weitgehend akzeptierte Methode darstellt (auch dazu Veil, in Spindler/Stilz a.a.O. § 305 Rn. 90; vgl. OLG Frankfurt, Beschluss vom 17. Januar 2017 – 21 W 37/12 –, Rn. 105, juris; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 15. Dezember 2016 – I-26 W 25/12 (AktE) –, Rn. 78, juris; OLG Stuttgart, Beschluss vom 01. April 2014 – 20 W 4/13 –, Rn. 69, juris zum IDW S1 i.d.F. 2000; Beschluss vom 15. Oktober 2013 – 20 W 3/13 –, Rn. 128; Beschluss vom 24. Juli 2013 – 20 W 2/12, Rn. 162, juris; auch OLG Stuttgart, Beschluss vom 27. Juli 2015 – 20 W 5/14 –, Rn. 18, 25, 95, 98 juris ohne weitere Thematisierung angesichts des beschränkten Beschwerdevorbringens). Im Rahmen eines Spruchverfahrens kann es, wie bereits ausgeführt, nicht darum gehen, einen wirtschaftswissenschaftlichen Methodenstreit richterlich zu entscheiden (vgl. OLG Stuttgart, Beschluss vom 01. April 2014 – 20 W 4/13 –, Rn. 49, 67 juris). Die Wahl des Tax-CAPM zur Ermittlung des Risikozuschlags im vorliegenden Fall ist daher nicht grundsätzlich zu beanstanden.
Eine andere, noch zu erörternde Frage ist, mit welchen Werten die Parameter der Formel, die das Tax-CAPM vorgibt, im konkreten Fall ausgefüllt werden.
bb. Verzicht auf jeglichen Risikozuschlag?
Einige Antragsteller halten die Berücksichtigung einer Marktrisikoprämie generell nicht für angebracht. Langfristig betrachtet wiesen Aktien keine Überrendite gegenüber der Anlage in öffentlichen Anleihen aus. Folgt man dieser These, müsste möglicherweise jedem Risikozuschlag grundsätzlich die Berechtigung abgesprochen werden. Das aber hieße, dass Aktienanleger letztlich im Durchschnitt keine höhere Renditeerwartung hätten als Anleger, die in relativ sichere öffentliche Anleihen investieren.
Die These, für das unzweifelhaft höhere Risiko der Aktienanlage sei keinerlei Risikozuschlag anzusetzen, verstieße nach Einschätzung der Kammer gegen jegliche Lebenserfahrung. Gegenüber der Anlage in Zerobonds oder festverzinslichen Anleihen „sicherer“ öffentlicher Emittenten bei bestehendem Rückzahlungsanspruch ist die Investition in Aktien eines Unternehmens zweifellos mit höheren Chancen, aber auch Risiken verbunden, die sich aus der unternehmerischen Tätigkeit ergeben (OLG Stuttgart, Beschluss vom 01. April 2014 – 20 W 4/13 –, Rn. 68, juris). Der Aktionär trägt im Umfang seiner Beteiligung nicht nur das Insolvenzrisiko, sondern auch das im Vergleich zum Ausfallrisiko bei festverzinslichen Staatsanleihen „sicherer“ Emittenten tendenziell höhere unternehmerische Risiko mit, dass künftige Erträge nicht einklagbar sind, dass sie bei verfehlten Geschäftsführungsentscheidungen ganz ausbleiben oder durch Verluste in späteren Geschäftsjahren aufgezehrt werden können und dass es auch keine Garantie dafür gibt, dass sie stetig anfallen. Darüber hinaus trägt er anders als bei Staatsanleihen mit festem Rückzahlungsbetrag, der bei Fälligkeit einklagbar wäre, auch noch das Risiko, bei einer in Zukunft getroffenen, freien Deinvestitionsentscheidung letztlich auf die zu diesem Zeitpunkt aktuelle Wertschätzung des Kapitalmarkts angewiesen zu sein. Hieraus ergibt sich das Risiko, dass der Gesamtertrag für den Anleger selbst bei regelmäßigen Überschüssen letztlich infolge von Kursverlusten negativ sein kann. All diese Chancen, aber auch Risiken unterscheiden die Aktienanlage von derjenigen in festverzinslichen Staatsanleihen.
Anleger sind jedoch im Grundsatz risikoavers. Nach aller Lebenserfahrung sollte sich der vernünftig denkende Anleger bei seinen Renditeerwartungen an seiner Bereitschaft orientieren, Risiken zu übernehmen. Ist er bereit, höhere Risiken in Kauf zu nehmen, darf er auch eine höhere Rendite erwarten. Eine geringere Risikobereitschaft korrespondiert mit einer entsprechend geringeren Rendite. Risikoaverse Anleger würden bei einer Marktrisikoprämie von Null mangels vorteilhafter Alternativen ihr gesamtes Vermögen risikofrei anlegen. Je höher die Marktrisikoprämie ist, desto höher auch der Anteil, den Anleger bereit sind, in risikoreiche Anlagen zu investieren. Bei einer unterstellten Marktrisikoprämie von Null für die Aktienanlage wäre nicht plausibel erklärbar, dass ein vernünftig denkender, durchschnittlicher Marktteilnehmer überhaupt in ungesicherte, ggfs. hohen Kursschwankungen unterliegende Aktien investiert. Das spricht dafür, dass man dem Aktienanleger im Vergleich zur risikofreien Anlage zum Basiszins eine Risikoprämie zubilligen muss (OLG Stuttgart, Beschluss vom 17. Oktober 2011 – 20 W 7/11 –, Rn. 287, juris; vgl. auch OLG Düsseldorf, Beschluss vom 04. Juli 2012 – I-26 W 8/10 (AktE) –, Rn. 56, juris; Beschluss vom 29. September 2010 – I-26 W 4/09 (AktE) –, Rn. 62). Die Kammer geht davon aus, dass durch Angebot und Nachfrage in einem Kapitalmarkt, in dem der durchschnittliche Marktakteur risikoavers ist, für gegenüber der risikofreien Anlage riskantere Anlagen automatisch eine positive Marktrisikoprämie entsteht.
Als weiteres Argument für den Risikozuschlag kommt hinzu, dass es sich bei den aufgrund der Planung ermittelten künftigen Überschüsse um Erwartungswerte handelt, deren Realisierung keineswegs sicher ist. Durch den Risikozuschlag wird dieser Unsicherheit der Planung Rechnung getragen.
Nicht nur das OLG Stuttgart, sondern auch andere Gerichte gehen in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass sich der Kapitalisierungszinssatz, zu dem künftig zufließende Erträge zu diskontieren sind, aus einem risikolosen Basiszinssatz und einem Risikozuschlag zusammensetzt (OLG Stuttgart, Beschluss vom 01. April 2014 – 20 W 4/13 –, Rn. 58, juris; OLG Stuttgart, Beschluss vom 17. Oktober 2011 – 20 W 7/11 –, Rn. 287, juris), und nehmen an, dass im Grundsatz von einer Überrendite von Aktien auszugehen ist (OLG Stuttgart, Beschluss vom 04. Mai 2011 – 20 W 11/08 –, Rn. 177, juris).
b. Konkrete Einschätzung der Marktrisikoprämie
Der Bewertungsgutachter hat die bei der Bewertung im vorliegenden Fall angewandte Marktrisikoprämie nach Steuern mit 5,5% festgelegt (BewGA Seite 94). Der sachverständige Prüfer hat eine Marktrisikoprämie von 5,5% nach Steuern ebenfalls als angemessen und zutreffend bezeichnet (PB Seite 51). Nahezu alle Antragsteller kritisieren die zugrunde gelegte Marktrisikoprämie als unrealistisch zu hoch.
Der FAUB hat zu verschiedenen Zeitpunkten Empfehlungen zur Höhe der Marktrisikoprämie ausgesprochen. Sowohl der Bewertungsgutachter als auch der sachverständige Prüfer nehmen hinsichtlich der Marktrisikoprämie Bezug auf die zum Bewertungsstichtag gültige Empfehlung des FAUB vom 19. September 2012, ergänzen diese aber um weitere eigene Überlegungen.
aa. Zugrunde liegende empirische Daten
Die Risikoprämie kann mithilfe von Kapitalmarktpreisbildungsmodellen abgeleitet werden. Nach dem Tax-CAPM werden die erwarteten Renditen nach typisierter Ertragsteuer als Summe aus dem risikolosen Basiszinssatz nach Ertragsteuer und einer Marktrisikoprämie nach Ertragsteuer erklärt, die mittels des unternehmensindividuellen Betafaktors zu einer unternehmensindividuellen Risikoprämie transformiert wird (IDW S1 i.d.F. 2008, Tz. 120). Die Marktrisikoprämie wiederum lässt sich anhand von Marktrenditen im Vergleich zum risikolosen Basiszins ermitteln (Wollny, Der objektivierte Unternehmenswert, a.a.O. Seite 547), wobei es für den Kapitalisierungszins bei der Unternehmensbewertung wiederum um eine Zukunftsprognose, um einen Erwartungswert geht. Da die Marktrisikoprämie nicht direkt beobachtet werden kann (Castedello/Jonas/Schieszl/Lenckner, Wpg 2018, 806 ff., 811), wird sie bislang regelmäßig aus empirischen Daten abgeleitet (Wollny, a.a.O. Seite 552). Trotz mancher Einwände und Bedenken in der Fachwissenschaft ist die Herleitung aus „historischen Marktrisikoprämien“ nach wie vor anerkannt und gebräuchlich (OLG Stuttgart, Beschluss vom 15. Oktober 2013 – 20 W 3/13 –, Rn. 131, juris).
Bei der Herleitung anhand empirischer Daten werden in der Betriebswirtschaftslehre mit jeweils guten Argumenten unterschiedliche Referenzindizes für das „Marktportfolio“
(etwa: DAX, sämtliche deutsche Aktien, CDAX, MSCI, nur Stammaktien aus dem DAX) und unterschiedliche Wege der Durchschnittsbildung zur Verarbeitung empirischer Daten (arithmetisches vs. geometrisches Mittel) vertreten. Während die Verdichtung unter Verwendung des arithmetischen Mittels eine jährliche Anlage und Veräußerung des Aktienportfolios unterstellt, legt die Verwendung des geometrischen Mittels eine Kauf- und Haltestrategie über den gesamten Anlagezeitraum zugrunde (auch dazu Wollny, a.a.O. Seite 548 ff., 552 ff.).
Dementsprechend gibt es weltweit zahlreiche Studien zur Ableitung von Marktrisikoprämien, auch für unterschiedliche Untersuchungszeiträume, die zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen führen (vgl. exemplarisch die bei Wollny, a.a.O. Seite 557 ff. aufgeführten).
Es ist, wie bereits ausgeführt, nicht Aufgabe der Rechtsprechung im Rahmen von Spruchverfahren bei der Beurteilung der Angemessenheit eines rechnerisch im Wege des Ertragswertverfahrens ermittelten Unternehmenswerts, einen Beitrag zur Lösung ungeklärter Streitfragen der Wirtschaftswissenschaft zu leisten und die eine „richtige“ empirisch begründbare Marktrisikoprämie festzulegen, die es – angesichts der Bandbreite vertretbarer Werte – nicht geben kann (vgl. OLG Stuttgart, Beschluss vom 04. Mai 2011 – 20 W 11/08 –, Rn. 176, juris).
Die bereits erwähnten Empfehlungen des FAUB zur Höhe der Marktrisikoprämie sind insbesondere auf empirische Studien von Prof. Stehle zurückzuführen (Wpg 2004, 906 ff.; vgl. Wollny, a.a.O. Seite 556). Einzelne Antragsteller behaupten, Prof. Stehle habe die Ergebnisse seiner Studie von 2004 durch eine neuere Studie von 2010 zurückgenommen und käme nun zu niedrigeren Marktrisikoprämien. Diese These ist bekanntlich bereits in anderen Spruchverfahren u.a. durch das OLG Stuttgart überprüft und widerlegt worden durch die vorgelegte Auskunft des Autors selbst aus dem Jahr 2011, wonach seine Ausführungen von 2004 weiterhin uneingeschränkt gelten (OLG Stuttgart, Beschluss vom 04. Mai 2011 – 20 W 11/08 –, Rn. 244 ff., auch zu weiteren pauschalen Einwänden gegen die „Stehle-Studie“). Dementsprechend wird die Studie von Prof. Stehle von den Gerichten regelmäßig auch weiterhin als eine der empirischen Grundlagen zur Bestimmung der Marktrisikoprämie herangezogen (OLG Stuttgart, Beschluss vom 04. Mai 2011 – 20 W 11/08 –, Rn. 188 ff.; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 12. November 2015 – I-26 W 9/14 (AktE) –, Rn. 54; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17. Dezember 2015 – I-26 W 22/14 (AktE) –, Rn. 50; OLG Zweibrücken, Beschluss vom 02. Oktober 2017 – 9 W 3/14 –, Rn. 36).bb. Weitere Ansätze neben der empirischen Methode Schon seit Jahren werden in der Betriebswirtschaftslehre und Unternehmensbewertung neben der „empirischen Methode“ (Gewinnung der Marktrisikoprämie aus historischen Daten) weitere „zukunftsgerichtete“ Ansätze diskutiert.
Ein solcher Ansatz ist die Ermittlung „impliziter Marktrisikoprämien“ (Kapitalkosten) anhand aktueller Aktienkurse und anhand von Analystenschätzungen bezüglich der künftigen Überschüsse (im Überblick Wollny, Der objektivierte Unternehmenswert, a.a.O. Seite 564 f. mit Hinweis auf verschiedene Studien zu impliziten Marktrisikoprämien von 2001 bis 2014). Ausgehend von bekannten Marktwerten (Börsenkursen) und bekannten, erwarteten Cashflows lassen sich bei dieser Methode in Umstellung der Bewertungsgleichung Gesamtrenditen (also implizite Kapitalkosten) ermitteln (Castedello/Jonas/Schieszl/Lenckner, Wpg 2018, 806 ff., 818 unter Hinweis auf Jäckel/Kaserer/Mühlhäuser, WPg 2013, 365 ff.; Wagner/Mackenstedt/Schieszl/ Lenckner/Willmershausen, WPg 2013, 948 ff., 950 ff.).
Dieser Ansatz ist zwar in der jüngsten Rechtsprechung teilweise auf Ablehnung gestoßen (LG München I, Beschluss vom 30. Mai 2018 – 5 HK O 10044/16 –, Rn. 145). Trotz möglicherweise im Einzelfall berechtigten Misstrauens gegen die Zuverlässigkeit einzelner Analystenschätzungen, trotz deren fehlender intersubjektiver Nachprüfbarkeit, trotz begrenzt möglicher Betrachtungszeiträume (Verfügbarkeit von Analystenschätzungen in der Regel nur für mehrere Jahre, nicht Jahrzehnte) und weiterer Einwände lassen sich für das Modell der „impliziten Kapitalkosten“ grundsätzlich aber verschiedene Argumente anführen:
Veröffentlichte Analystenschätzungen können einen durchaus erheblichen Einfluss auf den Kapitalmarkt und die Kursentwicklung haben, denn sie beeinflussen subjektive Einschätzungen der Anleger und damit auch Anlageentscheidungen. Sie fließen in „fundamentalanalytische“ Kennzahlen wie etwa das Kurs-Gewinn-Verhältnis, in die Gewinnrendite (Kehrwert des KGV) und in Dividendenbarwertmodelle ein (vgl. zur Relevanz bei der Analyse des Kapitalmarkts auch Deutsche Bundesbank, Monatsbericht April 2016, Seite 16 ff., https://www.bundesbank.de).
Gerade eine stärker kapitalmarktorientierte Bewertung von Aktien trägt dem Gedanken Rechnung, dass es um das Ziel der Ermittlung desjenigen Betrages geht, den der Aktionär bei einer „freien Deinvestitionsentscheidung“ tatsächlich zum Bewertungsstichtag hätte erhalten können (für eine stärker kapitalmarktorientierte Bewertung LG Stuttgart, Beschluss vom 03. April 2018 – 31 O 138/15 KfHSpruchG –, Rn. 87 ff., zum KGV als relevante Kennzahl vgl. Rn. 98, juris; Emmerich, in Emmerich/Habersack, Aktien- und GmbH-Konzernrecht 8. Aufl. 2016, § 305 AktG Rn. 41a, 41b, 69b; auch Fleischer, AG 2016, 185, 192 mit der These, ein „marktorientierter Methodenpluralismus“ verspreche gegenüber der Ertragswertmethode „validere Unternehmenswerte“).
Minderheitsaktionäre sind bei der fiktiven „freien Deinvestitionsentscheidung“ typischerweise auf den – wiederum auch von Analystenschätzungen beeinflussten – Kapitalmarkt angewiesen.
Soweit Wirtschaftsprüfer die Gleichsetzung von Börsenpreis und Unternehmenswert als problematisch bezeichnen (vgl. Castedello/Jonas/Schieszl/Lenckner, Wpg 2018, 806 ff., 819), ist ihnen entgegenzuhalten, dass an einem funktionierenden Kapitalmarkt der Markt – aus Sicht des Gesetzgebers - die „richtige“ Unternehmensbewertung liefert (BT-Drucks. 13/9712, S. 13), und dass auch aus verfassungsrechtlicher Sicht der (im Spruchverfahren „gesuchte“) Verkehrswert „regelmäßig mit dem Börsenkurs der Aktie identisch“ ist (BVerfG, Beschluss vom 27. April 1999 – 1 BvR 1613/94 –, juris Rn. 56, 60, 63), während der Kapitalmarkt Informationen regelmäßig nicht reflektiert, die am Bewertungsstichtag Unternehmensinterna sind und auf die zwar ein Wirtschaftsprüfer im Rahmen seiner Bewertungstätigkeit, nicht aber der gewöhnliche Kapitalmarktteilnehmer Zugriff haben mag (vgl. zum Ganzen LG Stuttgart, Beschluss vom 03. April 2018 – 31 O 138/15 KfHSpruchG –, Rn. 68 ff., juris).
Die Ex-ante-Analyse impliziter Kapitalkosten und deren (ergänzende) Berücksichtigung bei der Bestimmung der angemessenen Marktrisikoprämie vermeidet Nachteile, die demgegenüber reine ex-post-Analysen (wie die Ermittlung anhand historischer Werte) haben: den fehlenden Bezug zur aktuellen Kapitalmarktsituation und die geringere Sensitivität gegenüber aktuellen Trends (vgl. Castedello/Jonas/Schieszl/Lenckner, Wpg 2018, 806 ff., 818). Das zeigt sich gerade darin, dass manche Antragsteller an der „empirischen Methode“ kritisieren, dass sie Verhältnisse und Entwicklungen an den Kapitalmärkten vor Jahrzehnten berücksichtige (etwa die „Nachkriegsboom-Jahre“, abhängig vom gewählten Betrachtungszeitraum), dass aber nicht klar sei, inwieweit sich diese Effekte auch künftig bei langfristigem Anlagehorizont wiederholen werden und ob die aus der Historie gewonnenen Parameter heute überhaupt noch relevant sind.
Die von Kritikern angesprochenen „Schätzfehler“ sprechen nicht generell gegen das Modell der „impliziten Kapitalkosten“, denn solche Fehler können zumindest bei Heranziehung einer Vielzahl von Analystenschätzungen nivelliert werden. Berücksichtigt wird der Durchschnitt aller verfügbaren Schätzungen, die sogenannte Consensus- Schätzung, was tendenziell zu einem Ausgleich einzelner Über- oder Untertreibungen führt (Castedello/Jonas/Schieszl/Lenckner, Wpg 2018, 806 ff., 819). Berücksichtigt man zudem, dass in die Schätzungen von Analysten auch Informationen einfließen, die sie vom Management des jeweiligen Unternehmens erhalten, und dass das Management bei der Kommunikation am Kapitalmarkt Anreize hat, eher über den realistischen Erwartungswerte liegende Zahlen zu verwenden (wie bereits in Spruchverfahren erörtert), so wird deutlich, dass derartige Analystenschätzungen nicht zwangsläufig zum Nachteil von Minderheitsaktionären ausfallen.
Auch die Deutsche Bundesbank stellt bei Analysen zum „angemessenen Bewertungsniveau“ an den Aktienmärkten auf implizite Kapitalkosten ab und greift auf aktuelle Kapitalmarktzinsen und Dividendenerwartungen von Analysten zurück (Deutsche Bundesbank, Monatsbericht April 2016, Seite 15 ff., vgl. https://www.bundesbank.de).
In Österreich orientiert sich der Fachsenat für Betriebswirtschaft der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer seit 2017 (Empfehlung KFS/BW 1 E7) an den impliziten Marktrenditen und damit an impliziten Marktrisikoprämien und zieht seine Schlüsse angesichts unterschiedlicher Verfahren (Residualgewinnmodelle, Dividendendiskontierungsmodelle) und unterschiedlicher Gewinnprognosen von Analysten aus einem Bündel von Studien (vgl. Bertl, Wpg 2018, 805).
Die wirtschaftswissenschaftliche Diskussion zur „richtigen“ Methodik der Bestimmung der Marktrisikoprämie ist nicht abgeschlossen (Steinle/Liebert/Katzenstein, in MünchHdB GesR Band 7, 5. Aufl. 2016, § 34 Rn. 144). Bis auf Weiteres spricht deshalb nichts dagegen, im Rahmen eines „pluralistischen“ Ansatzes neben den empirischen Beobachtungen zu historischen Marktrisikoprämien auch andere Ansätze wie etwa das Modell der impliziten Kapitalkosten zu berücksichtigen.
cc. Empfehlungen des FAUB zur Höhe der Marktrisikoprämie im historischen Verlauf
Der FAUB bzw. dessen Vorgänger, der Arbeitskreis Unternehmensbewertung des IDW („AKU“) haben in der Vergangenheit Empfehlungen ausgesprochen und diese abhängig von steuerrechtlichen Änderungen angepasst (zum Ganzen und auch zum Folgenden Wollny, Der objektivierte Unternehmenswert, a.a.O. Seite 568 ff.). Das ist unter Berücksichtigung der Prämissen des Tax-CAPM konsequent.
Bezogen auf das Halbeinkünfteverfahren, gab es eine Empfehlung des Arbeitskreises Unternehmensbewertung des IDW („AKU“), eine Marktrisikoprämie nach Steuern von 5,0% bis 6,0% anzuwenden (IDW-FN 2005, 71). Diese Empfehlung von 2005 stützte sich auf Ergebnisse einer empirischen Untersuchung von Prof. Stehle aus dem Jahr 2004 zu historischen Marktrenditen, übernahm diese Ergebnisse aber nicht pauschal (er hatte bei Abstellen auf den CDAX Nachsteuerwerte zwischen 3,83% und 6,66% ermittelt). Der Empfehlung liegt vielmehr eine eigenständige Auswertung des damaligen Meinungsstandes zur Bestimmung der Marktrisikoprämie zugrunde. Das OLG Stuttgart hat zu dieser Empfehlung entschieden, dass es sich um eine anerkannte Expertenauffassung handele, die als Schätzgrundlage dienen könne (OLG Stuttgart, Beschluss vom 17. Oktober 2011 – 20 W 7/11 –, Rn. 319 ff., juris). Zum 01. Januar 2009 kam es in Deutschland zu grundlegenden Änderungen bei der Besteuerung von Kapitalgesellschaften und ihrer Anteilseigner. An die Stelle des Halbeinkünfteverfahrens trat die Abgeltungsteuer. Stellt man die mit dem Tax-CAPM verbundene Nachsteuerbetrachtung an, so ergibt sich die Aktienrendite aus der Dividendenrendite, der Kursrendite und der Steuerbelastung auf Dividenden und Kursgewinne. Es leuchtet ein, dass die Höhe der Marktrisikoprämie nach Steuern von den jeweils geltenden ertragsteuerrechtlichen Regelungen abhängt. Die Marktrisikoprämie nach Steuern im früheren Halbeinkünfteverfahren ist eine andere als im seit 2009 geltenden System der Abgeltungsteuer. Dies führte im Ergebnis zu der Empfehlung des FAUB, nun abhängig vom Bewertungsstichtag von einer Marktrisikoprämie nach Steuern in einer Bandbreite zwischen 4,0% und 5,0% auszugehen (vgl. Wollny, a.a.O. Seite 570; Wagner/Mackenstedt/Schieszl/Lenckner/Willmershausen, WPg 2013, 948 ff., 957).
Im Zuge der Finanzmarktkrise ab 2008 und der (spätestens) 2011 deutlich werdenden Staatsschuldenkrise sanken die Renditen deutscher Staatsanleihen und die korrespondierende Zinsstrukturkurve auf ein historisch niedriges Niveau. Parallel zum Rückgang der Renditen deutscher Bundesanleihen in der zweiten Jahreshälfte 2011 sanken auch die deutschen Aktienindizes (vgl. Zeidler/Tschöpel/Bertram, Corporate Finance 2012, Seite 70 f.). Nachdem der FAUB im November 2009 zunächst keinen Anlass sah, seine Empfehlung zur Marktrisikoprämie zu ändern (IDW-FN 2009, Seite 696, 697), empfahl er im Januar 2012 seinen Mitgliedern, angesichts der beobachtbaren Unsicherheit am Kapitalmarkt, bei Unternehmensbewertungen zu prüfen, ob eine Marktrisikoprämie am oberen Rand der bislang empfohlenen Bandbreite (also: 5%) anzusetzen sei.
In den Hinweisen vom 19. September 2012 hielt es der FAUB dann für sachgerecht, die Finanzmarktkrise zu berücksichtigen (wie schon der vollständige Titel der „Hinweise“ zeigt) und deshalb nun von einer Bandbreite von 5,0% bis 6,0% nach Steuern auszugehen. An dieser Empfehlung hielt er – über den Bewertungsstichtag im vorliegenden Fall hinaus – bis in jüngster Zeit fest (vgl. auch dazu Wollny, Der objektivierte Unternehmenswert, a.a.O. Seite 572 f.). Unter anderem in der bereits erwähnten Publikation von Castedello/Jonas/Schieszl/Lenckner (Wpg 2018, 806 ff.) finden sich nähere Erläuterungen zu den Gründen der geänderten, seit 19. September 2012 geltenden Empfehlung des FAUB, die nunmehr nicht allein auf empirisch ermittelte historische Marktrisikoprämien gestützt wird, sondern mit einem pluralistischen Ansatz – u.a. auch mit der Verwendung von ex-ante-Analysen impliziter Kapitalkosten sowie der Betrachtung langfristiger realer Aktienrenditen – gerechtfertigt wird.
dd. Meinungsstreit in Bezug auf die Marktrisikoprämie bei anhaltender Niedrigzinsphase
In der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur wird unter Hinweis auf die anhaltende Niedrigzinsphase sowie empirische Untersuchungen die Anwendung einer erhöhten Marktrisikoprämie befürwortet (Wagner u.a.; WPg 2013, 948 ff; Gleißner, WPg 2014, 258 ff; Zeidler/Tschöpel/Bertram, BewPraktiker 2012, 2 ff, zit. nach OLG Frankfurt, Beschluss vom 26. Januar 2017 – 21 W 75/15 –, Rn. 74). Andererseits gibt es in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur durchaus Kritiker, die für eine zumindest inzwischen wieder gesunkene Marktrisikoprämie sprechen und die u.a. auf eine nach dem Kurseinbruch von 2009 signifikant gestiegene Marktkapitalisierung deutscher Aktien sowie auf zahlreiche, in den empirischen Daten bereits berücksichtigte konjunkturelle Krisen der Vergangenheit verweisen (Wollny, Der objektivierte Unternehmenswert 3. Aufl. 2018, Seite 574 ff., 581 ff.). Ob bei sinkendem Basiszins auch die Marktrisikoprämie fallen muss, ist streitig (vgl. LG Frankfurt, Beschluss vom 27. Mai 2014 – 3-05 O 34/13 –, Rn. 56 unter Hinweis auf Knoll/Wenger/Tartler ZSteu 2011, 47; Knoll Bewertungspraktiker März 2012, S. 11 einerseits und Zeidler/Tschöpel/Bertram, Bewertungspraktiker März 2012, S. 2 andererseits).
Die Antragsteller Ziff. 6 bis 8 tragen insoweit unter Verweis auf weitere Beiträge zutreffend vor, dass die Diskussion zur Ermittlung einer sachgerechten Marktrisikoprämie längst noch nicht abgeschlossen sei (Bl. 28-7 d.A.).
Das LG Hannover ist in einem Beschluss von 2015, bezogen auf den 23. November 2012 als Bewertungsstichtag, der Empfehlung des FAUB vom 19. September 2012 gefolgt und hat eine Marktrisikoprämie von 5,5% als angemessen bestätigt (LG Hannover, Beschluss vom 25. Februar 2015 – 23 AktE 7/13, im Verfahren LG Stuttgart 31 O 50/15 KfH SpruchG vorgelegt als Anlage AG 16). Auch das OLG Frankfurt hat sich gerade angesichts des Streits in der Wirtschaftswissenschaft und in Literatur und Rechtsprechung für die weitere Berücksichtigung der Empfehlung des FAUB zur erhöhten Marktrisikoprämie im „Niedrigzinsumfeld“ und für die Angemessenheit der konkreten Verwendung von 5,5% bezogen auf einen Bewertungsstichtag im Jahr 2013 ausgesprochen (OLG Frankfurt, Beschluss vom 26. Januar 2017 – 21 W 75/15 –, Rn. 71).
Hingegen weicht das LG München I in mittlerweile ständiger Rechtsprechung dezidiert von der Empfehlung des FAUB vom 19. September 2012 zur erhöhten Marktrisikoprämie ab (vgl. u.a. LG München I, Beschluss vom 02. Dezember 2016 – 5HK 5781/15 –, Rn. 136, juris). Es legt stattdessen bei Anwendung des Tax-CAPM eine Marktrisikoprämie von 5,0% zugrunde (als im Schnittbereich der Empfehlung des Fachausschusses Unternehmensbewertung des IDW vor 2012 und der angepassten neueren Empfehlung liegend). Auch das LG Dortmund ist der Empfehlung des FAUB vom 19. September 2012 in einer Entscheidung, die den Bewertungsstichtag 23. Mai 2013 betrifft, nicht gefolgt und hat im entschiedenen Fall eine Marktrisikoprämie von 4,5% angesetzt (LG Dortmund, Beschluss vom 04. November 2015 – 18 O 52/13 (AktE) –, Rn. 63, juris). Weitere Gerichtsentscheidungen dazu wurden von einzelnen Beteiligten des vorliegenden Verfahrens vorgelegt (vgl. etwa Bl. 641 f. d.A.).
ee. Beurteilung durch die Kammer
Aus Sicht der Kammer kann es für den hier relevanten Bewertungsstichtag noch bei dem Rückgriff auf die Empfehlung des FAUB bleiben. (1) Der FAUB bzw. Castedello/Jonas/Schieszl/Lenckner (Wpg 2018, 806, 808) sind der Auffassung, dass es aufgrund der im historischen Vergleich ungewöhnlich niedrigen Rendite festverzinslicher Bundeswertpapiere und damit auch des Basiszinssatzes in Kombination mit der Verwendung der bisherigen Empfehlungen des FAUB zur Marktrisikoprämie (vor 2012) insgesamt zu Gesamtrenditeerwartungen käme, die - unter Berücksichtigung von Ausmaß und zeitlicher Dauer der Abweichung – nicht zu empirisch am Kapitalmarkt beobachtbaren Verhältnissen passen. Ob dieser Befund die Kapitalmarktsituation seit Ausbruch der Finanzmarktkrise – anhaltend – im Anwendungsfall der Unternehmensbewertung zu einer besonderen macht, ist unter Wirtschaftswissenschaftlern umstritten, ebenso in welchem Ausmaß und wie lange die anhaltende Niedrigzinsphase noch Einfluss auf die Bemessung der Marktrisikoprämie hat. Selbst Kritiker gehen von einem – wenn auch deutlich geringeren – Anstieg der Marktrisikoprämie bei Einbeziehung der Aktienrenditen 2004 bis 2013 aus (Wollny, Der objektivierte Unternehmenswert a.a.O. Seite 582 d.A.).
(2) Das OLG Stuttgart hat hervorgehoben, dass die Verlautbarungen des IDW trotz aller dagegen im Allgemeinen oder in Einzelfragen vorgebrachten Kritik von dem Berufsstand der Wirtschaftsprüfer anerkannt seien und bei Unternehmensbewertungen in der Praxis ganz überwiegend beachtet würden (OLG Stuttgart, Beschluss vom 15. Oktober 2013 – 20 W 3/13 –, Rn. 80, juris).
Bezogen auf die Marktrisikoprämie teilt die Kammer die Auffassung, dass all diejenigen Werte ohne weiteres akzeptabel sind, die innerhalb der Bandbreite liegen, die bezogen auf den Bewertungszeitpunkt in einschlägigen betriebswirtschaftlichen Untersuchungen wie auch in der Bewertungspraxis herkömmlich anzutreffen sind. Das gilt insbesondere für solche Werte, die sich innerhalb der Spanne halten, die in Verlautbarungen des IDW empfohlen wird. Hält sich der herangezogene Wert innerhalb dieser von § 287 Abs. 2 ZPO gezogenen Grenzen, bedarf es gerichtlicher Auseinandersetzung mit dem in den Wirtschaftswissenschaften vorzufindenden Diskussionsstand grundsätzlich nicht (Steinle/Liebert/Katzenstein, in MünchHdB GesR Band 7, 5. Aufl. 2016, § 34 Rn. 144 f.).
Bezogen auf die im vorliegenden Fall zugrunde gelegte Marktrisikoprämie von 5,5% nach Steuern ist festzuhalten: Dieser Wert liegt innerhalb der Spanne (Mittelwert) der vom FAUB nach wie vor für richtig gehaltenen Empfehlung.
(3)
Die Kammer möchte ihrer Beurteilung im Rahmen der Schätzung nach § 287 Abs. 2 ZPO allerdings auch keine offenkundig „falsche“, d.h. willkürliche und objektiv durch nichts belegbare Auffassung zugrunde legen. Angesichts der Kritik vieler Antragsteller an der Empfehlung des FAUB vom September 2012 zur erhöhten Marktrisikoprämie wegen der anhaltenden Niedrigzinsphase und angesichts des Umstandes, dass manche Gerichte in Spruchverfahren dieser Empfehlung des FAUB in Bezug auf den sich daraus ergebenden Mittelwert von 5,5% nicht (mehr) folgen, hat die Kammer kritisch geprüft, ob sich anhand konkreter Tatsachen echte „Fehler“ der Empfehlung des FAUB aufzeigen lassen (vgl. OLG Stuttgart, Beschluss vom 17. Oktober 2011 – 20 W 7/11 –, Rn. 380, juris). Solche evidenten „Fehler“ sind jedoch nicht festzustellen. Im Gegenteil, kann der FAUB sich nach wie vor auf fachliche Argumente berufen, die für die von ihm ausgesprochene Empfehlung sprechen.
Als ein empirisch belegtes Indiz für die Richtigkeit der These, ein extrem niedriges Basiszinsniveau korreliere mit einer gestiegenen Marktrisikoprämie, könnte die Parallelentwicklung deutscher Aktienindizes und gesunkener Anleihenrenditen in der zweiten Jahreshälfte 2011 gewertet werden (vgl. Zeidler/Tschöpel/Bertram, WPg 2013 71, grafisch aufgezeigt am Beispiel des CDAX und der Rendite 10jähriger Bundesanleihen).
In dem bereits erwähnten Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom April 2016 wird auf fast kontinuierliche Kursgewinne bei Aktien beiderseits des Atlantiks zwischen Mitte 2012 und Mitte 2015 und auf den Kurseinbruch in der zweiten Jahreshälfte 2015 sowie „seither ausgeprägten Schwankungen des Kursniveaus“ und eine seitdem erhöhte implizite Volatilität hingewiesen. Letztere ist ein Indikator für die Unsicherheit der Marktteilnehmer über die weitere Kursentwicklung. Die zurückliegende Phase erhöhter Schwankungen an den internationalen Aktienmärkten werfe aus geld- und finanzstabilitätspolitischer Sicht die Frage nach dem angemessenen Bewertungsniveau auf. Die Deutsche Bundesbank hat festgestellt, dass die impliziten Eigenkapitalkosten und die Aktienrisikoprämie bezogen auf den DAX sich seit 2014 kontinuierlich angenähert hätten und dass sich bei gleichzeitigem Zinsrückgang die Aktienrisikoprämie mit 7,5% „fast 2 Prozentpunkte oberhalb ihres Zehnjahresmittels“ bewege (Deutsche Bundesbank, Monatsbericht April 2016, Seite 16, 22 a.a.O.). Hierauf berufen sich auch Castedello/Jonas/Schieszl/Lenckner (Wpg 2018, 806 ff., 820).
Zumindest für den Zeitraum von Mitte 2009 bis etwa Mitte 2014 – und damit auch für den vorliegenden Bewertungsstichtag – wurde eine deutliche Erhöhung der tatsächlichen Aktienrendite (KGV-Kehrwerte) gegenüber den „Vorkrisenjahren“ 2005 bis 2007 bei zugleich absinkendem Basiszinsniveau festgestellt (grafisch veranschaulicht durch Castedello/Jonas/Schieszl/Lenckner, Wpg 2018, 806 ff., 814).
Auch der österreichische „Fachsenat für Betriebswirtschaft der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer“ empfiehlt seit 2012, eine Marktrisikoprämie vor Steuern von 5,5% bis 7,0% anzusetzen (vgl. Bertl, Wpg 2018, 805). Das entspricht exakt der Empfehlung des FAUB bezogen auf die Vorsteuerbandbreite (vgl. Wollny, Der objektivierte Unternehmenswert, a.a.O. Seite 572).
In dem Bewusstsein, dass es auch für den Bereich der Marktrisikoprämie keinen absolut „richtigen, einzig zutreffenden“ Wert gibt, der einer „endgültigen Gewissheit zugeführt“ werden könnte (vgl. OLG Frankfurt, Beschluss vom 30. August 2012 – 21 W 14/11 –, Rn. 69, juris), sondern allenfalls eine angemessene Bandbreite vertretbarer Schätzwerte, und in dem Bewusstsein, dass sich die aktuelle Empfehlung des FAUB ohnehin auch weiterhin einer kritischen Prüfung unterziehen muss, sieht die Kammer aus vorgenannten Gründen von einer hier nicht erforderlichen und auch nicht leistbaren weiter vertieften Erörterung aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht ab. Die Unangemessenheit des im Bewertungsgutachten zugrunde gelegten und vom sachverständigen Prüfer als angemessen bestätigten Werts von 5,5% nach Steuern vermag die Kammer nicht festzustellen und schließt sich mangels besserer Erkenntnis auch insoweit dem Votum des sachverständigen Prüfers an.
5. Betafaktor
Beim Tax-CAPM wird die Marktrisikoprämie mit einem unternehmensindividuellen Betafaktor zu einer unternehmensindividuellen Risikoprämie transformiert. Der Betafaktor ist – vereinfacht gesagt - ein Gradmesser, der angibt, wie stark die Aktie im Vergleich zum Markt schwankt, wie sich das Risiko des bewerteten Unternehmens zum Marktrisiko bzw. die Rendite der Aktien des zu bewertenden Unternehmens im Vergleich zum Marktportfolio verhält. Er dient der Berücksichtigung der abweichenden Volatilität der Aktie des zu bewertenden Unternehmens (OLG Stuttgart, Beschluss vom 14. Februar 2008 – 20 W 9/06 –, Rn. 81, juris). Er zeigt einen linearen Zusammenhang zwischen der erwarteten Rendite einer risikobehafteten Investition und der erwarteten Rendite des Markt-Portfolios auf. Der unternehmensindividuelle Betafaktor ergibt sich als Kovarianz zwischen den Aktienrenditen des zu bewertenden Unternehmens oder vergleichbarer Unternehmen und der Rendite eines Aktienindex, dividiert durch die Varianz der Renditen des Aktienindex (IDW S1 i.d.F. 2008, Tz. 120, 121).
a. Allgemeine Überlegungen
Der Betafaktor ist kein empirisch feststellbarer Vergangenheitswert, sondern ein durch Schätzung zu ermittelnder Zukunftswert (OLG Stuttgart, Beschluss vom 04. Mai 2011 – 20 W 11/08, Rn. 200; Steinle/Liebert/Katzenstein, MünchHdB GesR a.a.O. § 34 Rn. 146). Gleichwohl werden zur Ermittlung des Betafaktors börsennotierter Gesellschaften Kapitalmarktdaten verwendet. Grundlage für die Schätzung des Betafaktors können der historische Verlauf der Börsenkurse der zu bewertenden Aktie selbst bzw. derjenige einer Peer Group oder auch allgemeine Überlegungen zum individuellen Unternehmensrisiko im Vergleich zum Risiko des Marktportfolios sein. Die unternehmensspezifische Risikostruktur kann berücksichtigt werden (OLG Stuttgart, Beschluss vom 04. Mai 2011 – 20 W 11/08 –, Rn. 200, juris; Beschluss vom 15. Oktober 2013 – 20 W 3/13 –, Rn. 135, juris).
Die Prognoseeignung von Betafaktoren ist dabei im jeweiligen Einzelfall zu würdigen (IDW S1 i.d.F. 2008, Tz. 121), ihre Aussagekraft kann anhand der Liquidität des Aktienhandels, des sogenannten Bestimmtheitsmaßes und des sogenannten T-Tests überprüft werden (vgl. LG München I, Beschluss vom 28. April 2017 – 5 HK O 26513/11 – , Rn. 130, juris). Ob ein aussagekräftiger unternehmenseigener Betafaktor stets Vorrang vor einem mithilfe einer Peer Group ermittelten Betafaktor hat, und unter welchen Voraussetzungen von einer hinreichenden Aussagekraft des unternehmenseigenen Betafaktors ausgegangen werden kann, ist bislang wissenschaftlich nicht geklärt und wird nicht einheitlich beurteilt.
Das OLG Frankfurt spricht sich für den grundsätzlichen Vorrang eines aussagekräftigen unternehmenseigenen Betafaktors aus. In einem entschiedenen Fall beanstandete es nicht, dass die Vorinstanz den Markt als nicht ausreichend liquide angesehen hatte angesichts eines Bid-Ask-Spread von 2,37 %, eines durchschnittlichen Handelsvolumens von 6.283 Aktien, eines durchschnittlichen Handelsumsatzes von 113.244 EUR und mehrerer Kurssprünge von deutlich über 5 %. Auf die Kriterien, nach denen die Aussagekraft des Börsenkurses beurteilt wird, wenn es darum geht, ob der gewichtete durchschnittliche Börsenkurs der letzten drei Monate die „Untergrenze“ der Abfindung bildet, komme es (sinngemäß) nicht an, wenn es um die Aussagekraft des unternehmenseigenen Betafaktors gehe. Entscheidend sei hier, ob die beobachtbaren Kursschwankungen der Vergangenheit das systematische Risiko der Gesellschaft adäquat abbilden (OLG Frankfurt, Beschluss vom 29. Januar 2016 – 21 W 70/15 –, Rn. 69, 70, juris). In einer anderen Entscheidung stellte das OLG Frankfurt auf das Bestimmtheitsmaß R2 ab. Jedenfalls Bestimmtheitsmaße bis 0,01 seien zu niedrig, um auf den gemessenen eigenen Betafaktor der Gesellschaft als geeignete Größe für die Schätzung des individuellen Unternehmensrisikos abstellen zu können (OLG Frankfurt, Beschluss vom 18. Dezember 2014 – 21 W 34/12 –, Rn. 88, juris).
Das OLG Düsseldorf zitiert aus einem Sachverständigengutachten, wonach „auf Basis derzeitiger Erkenntnisse“ bei Bid-Ask Spreads von größer 1,25 % und einem Handelsumsatz von bis zu 115.000 EUR regelmäßig nicht mehr von hinreichender Liquidität für die Bestimmung unverzerrter Betafaktoren ausgegangen werden könne (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 10. März 2014 – I-26 W 16/13 (AktE) –, Rn. 7, juris).
Das LG München I stellt zur Beurteilung des Liquiditätskriteriums insbesondere auf die Entwicklung der relativen Bid-Ask-Spreads, das Handelsvolumen, die Handelsquote (Quotient aus Zahl der gehandelten Aktien und Streubesitz) und die Frage ab, inwiefern der Aktienkurs etwa in erster Linie von einem Übernahmeangebot geprägt ist und folglich nicht mehr hinreichend das eigene Risiko der Gesellschaft widerspiegele. Im entschiedenen Fall, in dem der unternehmenseigene Betafaktor aus verschiedenen Gründen nicht herangezogen wurde, lag der Spread im Durchschnitt bei 1,38% (LG München I, Beschluss vom 28. April 2017 – 5 HK O 26513/11 –, Rn. 133, juris).Das OLG Stuttgart hat ausgeführt, dass der wesentliche Ansatz des CAPM in der Ermittlung des Risikozuschlags anhand von Kapitalmarktdaten liege, dass diese aber „nicht zwingend den eigenen Kursen der Aktien des Bewertungsobjekts entnommen werden“ müssten. Entgegen einer in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur vertretenen Auffassung sei nicht davon auszugehen, dass geringe Betafaktoren typische Folge der faktischen Beherrschung eines Unternehmens sind. Gegen diesen Zusammenhang spreche trotz entsprechender empirischer Studien schon die in diesen Fällen „wegen des geringen Handelsvolumens typischerweise fehlende Aussagekraft der Kursdaten“ (OLG Stuttgart, Beschluss vom 19. Januar 2011 – 20 W 3/09 –, Rn. 214, juris).
b. Annahmen des Bewertungsgutachters und des sachverständigen Prüfers
Der Bewertungsgutachter hat zunächst die unternehmenseigenen, „originären“ Betafaktoren der A AG im Zeitraum zwischen dem 01. April 2009 und dem 31. März 2014 betrachtet und die statistische Güte dieser Werte untersucht. Bei dieser Analyse fiel auf, dass die Aktienkursentwicklung ab Oktober 2013 nicht durch allgemeine Marktentwicklungen beeinflusst, sondern vom Marktgeschehen entkoppelt war. Angesichts der am Kapitalmarkt im Jahr 2013 kommunizierten Übernahmeabsicht von K ist das durchaus nachvollziehbar. Konsequenterweise wurden die unverschuldeten Betafaktoren der „1-Jahresscheibe 2014“ aus der Analyse herausgenommen und der Betafaktor des 5-Jahres-Zeitraums um Entwicklungen ab 2013 bereinigt. Als Mittelwert der durchschnittlichen Betafaktoren der vier Ein-Jahres-Scheiben und des „bereinigten Fünf-Jahres-Zeitraums“ ergab sich ein unverschuldeter Betafaktor von 0,72, den der Bewertungsgutachter seinen weiteren Berechnungen zugrunde gelegt hat. Die Peer- Group-Analyse habe den eigenen Betafaktor der A AG von 0,72 bestätigt (BewGA Seite 94 ff.). Genau diesen Faktor von 0,72 hat der Bewertungsgutachter auch in die Berechnung eingestellt (BewGA Seite 100).
Die Behauptungen etwa der Antragsteller Ziff. 6 bis 8, das unternehmenseigene Beta sei „nicht herangezogen“ worden und es sei ein Betafaktor von 0,74 angesetzt worden (Bl. 28-8), sind danach offensichtlich falsch.
Der sachverständige Prüfer kam anhand eigener Analysen zu einer „Entkoppelung“ des Börsenkurses der A-Aktie von der CDAX-Entwicklung ab dem 08. Oktober 2013, bedingt durch die Übernahmespekulationen und die folgenden beiden Übernahmeangebote sowie durch den immer geringer werdenden „Free-Float“. Er führt im Prüfungsbericht aus, er habe – auch unter Berücksichtigung eigener Peer-Group-Analysen – keine Anhaltspunkte für eine Unangemessenheit des vom Bewertungsgutachter ermittelten Betafaktors (PB Seite 57 ff., 65).
Detailfragen mancher Antragsteller etwa zur rechnerischen Ermittlung und zur statistischen Signifikanz der Peer Group sind als durch die Angaben der Antragsgegnerin in der Erwiderungsschrift hinreichend beantwortet anzusehen (Bl. 562 ff. d.A.) und bedürfen daher an dieser Stelle keiner weiteren Erörterung.
Da bei der Ermittlung von Betafaktoren in der praktischen Umsetzung eine Vielzahl – in der Wirtschaftswissenschaft teilweise kontrovers diskutierter – methodischer Einzelfallentscheidungen zu treffen sind, sind die von den Bewertern insoweit getroffenen methodischen Einzelentscheidungen nach § 287 Abs. 2 ZPO taugliche Schätzungsgrundlage, wenn sie – wie hier - nachvollziehbar begründet sind und sich auf dem Boden gängiger Praxis bewegen, also anerkanntem und gebräuchlichem Vorgehen entsprechen, selbst wenn dieses in den Wirtschaftswissenschaften nicht unumstritten ist (Steinle/Liebert/Katzenstein, MünchHdB GesR a.a.O. § 34 Rn. 147, 148). Die Ermittlung eines ebenfalls vertretbaren anderen Schätzwerts für den Betafaktor bringt insoweit keinen zusätzlichen, für die Entscheidung erforderlichen Erkenntnisgewinn. Die (beantragte) Einholung eines Obergutachtens war angesichts des Charakters des Betafaktors als im Wege der Schätzung hier sachgerecht ermittelten Parameters nicht angezeigt.
6. Wachstumsabschlag
Der Wertbeitrag der unternehmerischen Zahlungsüberschüsse, die zeitlich nach der Detailplanungsphase anfallen, wird im Rahmen der Bewertung nach dem Tax-CAPM vereinfachend über den Barwert einer „ewigen Rente“ erfasst.
Der Wachstumsabschlag dient insbesondere dazu, im Falle einer Nominalplanung die durch die Inflation bedingten Steigerungen der Nettozuflüsse zugunsten der Anteilseigner in der Phase der „ewigen Rente“ abzubilden. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Wachstumsabschlag notwendig der erwarteten Inflationsrate entsprechen müsste. Stattdessen richtet sich der Wachstumsabschlag danach, ob das Unternehmen nachhaltig in der Lage sein wird, die in seinem Fall erwarteten, nicht notwendig mit der Inflationsrate identischen Preissteigerungen auf der Beschaffungsseite (z.B. Materialkosten und Personalkosten) durch entsprechende eigene Preissteigerungen an seine Kunden weiter zu geben. Trifft dies zu oder kann das Unternehmen sogar die Kostensteigerungen übertreffende Preiserhöhungen durchsetzen, ist der Wachstumsabschlag in Höhe der nachhaltig erwarteten Kostensteigerungen oder sogar darüber anzusetzen. Ist das Unternehmen nicht oder nicht vollständig in der Lage, nachhaltig erwartete Kostensteigerungen durch Preiserhöhungen auf seine Kunden abzuwälzen, ist der Wachstumsabschlag unterhalb der nachhaltig erwarteten. Kostensteigerungen zu verorten. Entscheidend für die Festlegung des Wachstumsabschlags ist nicht die Prognose für den Detailplanungszeitraum, sondern für die Phase der „ewigen Rente“ (vgl. Wollny, Der objektivierte Unternehmenswert, a.a.O. Seite 659 ff.; OLG Stuttgart, Beschluss vom 17. März 2010 – 20 W 9/08 –, Rn. 189 ff.192). Eine Wachstumsrate in Höhe der Inflationsrate ist eher die Ausnahme und nicht die Regel (Wollny, a.a.O. Seite 666).
Für den Bereich der „ewigen Rente“ hat der Bewertungsgutachter im vorliegenden Fall vom Kapitalisierungszins nach Steuern einen Wachstumsabschlag von 1,00% abgezogen (BewGA Seite 99). Wie aus dem Bewertungsgutachten ersichtlich, wurde eine auch der Abschätzung des Wachstumsabschlags dienende Branchen- und Vergangenheitsanalyse durchgeführt (Wollny, a.a.O. Seite 672). Der Bewertungsgutachter hat den Wachstumsabschlag in sich schlüssig zu den Ausführungen zum Marktumfeld und den Wettbewerbsverhältnissen (BewGA Seite 21 ff.) sowie zur Schätzung des nachhaltigen Ergebnisses (BewGA Seite 85) begründet. Demnach können infolge der bekannten starken Regulierung der Märkte und des bereits bestehenden Preisdrucks inflationsbedingte Kostensteigerungen nur sehr eingeschränkt auf die Preise übergewälzt werden (BewGA Seite 99). Der sachverständige Prüfer hat diese Einschätzung bestätigt (PB Seite 68). Das spricht im vorliegenden Fall für einen Wachstumsabschlag unterhalb der langfristig zu erwartenden Inflationsrate. Letzteres ist auch allgemein nicht zu beanstanden (vgl. OLG Stuttgart, Beschluss vom 17. Juli 2014 – 20 W 3/12 –, Rn. 155, juris; Steinle/Liebert/Katzenstein, MünchHdbGesR a.a.O. § 34 Rn.150).
Hinzu kommt, dass der angenommene Wachstumsabschlag auch innerhalb der in der Bewertungspraxis üblicherweise angesetzten Bandbreite liegt (Steinle/Liebert/Katzenstein, MünchHdBGesR a.a.O. § 34 Rn. 152).
Die vom sachverständigen Prüfer in den Prüfungsbericht einbezogene Entwicklung des Verbraucherpreisindexes im Verhältnis zu den Preissteigerungsraten pharmazeutischer Erzeugnisse für Verbraucher sowie den Großhandelsverkaufspreisen im Zeitraum 2004 bis 2013 (PB Seite 68) dürfte die These des Bewertungsgutachters untermauern.
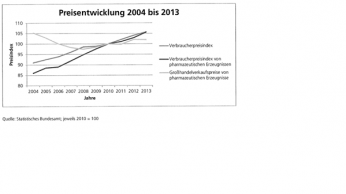
Denn eine Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung in die Zukunft könnte dafür sprechen, dass sich der (vom Verbraucher an die Apotheke bezahlte) Preis pharmazeutischer Erzeugnisse stärker erhöht als die Inflationsrate. Die Grafik zeigt zugleich für Großhandelverkaufspreise zumindest bis etwa 2010 eine gegenläufige Tendenz zum Verbraucherpreisindex und – bei Langfristbetrachtung des Zeitraums von 2004 bis 2013 – ein Absinken des durchschnittlichen Großhandelsverkaufpreises um rund -0,4% p.a., wie im Prüfungsbericht hervorgehoben (PB Seite 68). Bei Fortschreibung dieser Vergangenheitsentwicklung könnte das bedeuten, dass der Pharmagroßhandel, in dem die A AG am Bewertungsstichtag schwerpunktmäßig tätig war, nicht einmal Preissteigerungen, die Apotheken auf ihre Kunden abwälzen können (und die noch unterhalb der Inflationsrate liegen), absatzseitig in vollem Umfang gegenüber seinen Abnehmern, den Apotheken, durchsetzen kann. Eine nachvollziehbare Erklärung hierfür sind, wie im Bewertungsgutachten ausgeführt, neben wettbewerbsbedingt ansteigenden Großhandelsrabatten an Apotheken die schwindende Bindung an einen bestimmten Großhändler und der zunehmend leichtere Wechsel zu anderen Großhändlern (vgl. BewGA Seite 32, 137 f.). All das spricht für die Richtigkeit der These des Bewertungsgutachters, dass es der A AG voraussichtlich nur gelingen wird, Teile der Kostensteigerungen an die Kunden überzuwälzen.
7. Gesamtergebnis
Die bei der Ertragswertberechnung zugrunde gelegten Parameter sind auch aus Sicht der Kammer angemessen.
V. Ableitung des Ertragswerts des betriebsnotwendigen Vermögens
Anhand der vorstehend erörterten Parameter lässt sich folgender Barwert des betriebsnotwendigen Vermögens errechnen (BewGA Seite 100):
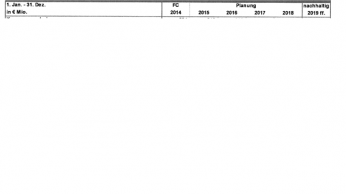
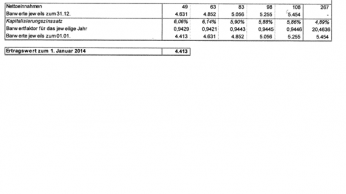
VI. Bewertung von Sonderwerten und des nicht betriebsnotwendigen Vermögens
Als Sonderwerte hat der Bewertungsgutachter eine Reihe von Beteiligungen an nicht konsolidierten Unternehmen berücksichtigt, die im Vergleich untergeordnete Bedeutung für die A AG haben. Sie wurden mit rund 2 Mio. EUR werterhöhend berücksichtigt, so dass sich unter Berücksichtigung von Rundungen ein Unternehmenswert von 4.414 Mio. EUR zum 01. Januar 2014 ergab (BewGA Seite 102). Der sachverständige Prüfer hat die untergeordnete Bedeutung der Beteiligungen, deren fehlenden oder nur geringen Ergebnisbeitrag und die Angemessenheit des angesetzten Werts bestätigt (PB Seite 72).
Angesichts der geringen Auswirkungen möglicher Schätzungenauigkeiten im Bereich der Sonderwerte, für die zudem von Antragstellerseite keine hinreichend konkreten tatsächlichen Anhaltspunkte genannt wurden, ist die gewählte Vorgehensweise nicht zu beanstanden. Zur (beantragten) Einholung eines Gutachtens zu den Sonderwerten besteht kein Anlass.
Angesichts dessen, dass die zinstragenden Verbindlichkeiten den Bestand an liquiden Mitteln prognostisch übersteigen (vgl. BewGA Seite 84), kann konsequenterweise auch keine nicht betriebsnotwendige Liquidität festgestellt werden, die als Sonderwert hinzukäme.
Die Marke „A“ gehört offenkundig zum betriebsnotwendigen Vermögen der Gesellschaft, weshalb entgegen der Auffassung mancher Antragsteller (vgl. u.a. Antragsteller Ziff. 13, Bl. 73 d.A.) hierfür kein gesonderter Wert anzusetzen ist.
Der gemeinsame Vertreter hat künftig freiwerdende Immobilien in … als mögliches nicht betriebsnotwendiges Vermögen angesprochen (Bl. 701 d.A.). Es soll sich um einen nach dem Bewertungsstichtag erfolgenden, konkret: laut Presseartikeln vom Mai 2015 geplanten Umzug handeln. Hierzu konnte in der mündlichen Verhandlung vom 22. November 2016 geklärt werden, dass es um von H angemietete Immobilien geht, dass der Mietvertrag noch einmal verlängert worden war und dass ein möglicher Umzug am Bewertungsstichtag nicht erkennbar war (Bl. 805 d.A.).
VII. Berechnung des anteiligen Unternehmenswerts
Der Bewertungsgutachter hat unter Berücksichtigung der Aufzinsung bis zum Bewertungsstichtag 15. Juli 2014 einen Unternehmenswert von 4.556 Mio. EUR nach Ertragswertgesichtspunkten abgeleitet, woraus sich anhand der Zahl der zum Bewertungsstichtag ausgegebenen Aktien ein anteiliger Ertragswert pro Aktie von 22,42 EUR ergibt (BewGA Seite 102). Der sachverständige Prüfer hat die Richtigkeit der Berechnungen bestätigt (PB Seite 72).
Auf die Einwände gegen die Herleitung und die Ergebnisse des Multiplikatorenverfahrens (BewGA Seite 103 ff.) muss hier nicht eingegangen werden, denn es bestand schon keine Verpflichtung, den Unternehmenswert nach allen erdenklichen Bewertungsverfahren zu ermitteln und sodann nach der „Meistbegünstigung“ festzulegen (wie hier Steinle/Liebert/Katzenstein, in MünchHdB GesR a.a.O. § 34 Rn. 158 f.), und die vorgenommene Überprüfung anhand von Multiplikatoren diente allein der (zusätzlichen) Plausibilisierung des beim Ertragswertverfahren gewonnenen Ergebnisses.
VIII. Börsenkurs
Aus dem Bewertungsgutachten ergibt sich, dass die BaFin für den dreimonatigen Referenzzeitraum vom 23. Oktober 2013 bis zum 22. Januar 2014 – endend einen Tag vor der Bekanntgabe der Absicht zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages – einen umsatzgewichteten durchschnittlichen Börsenkurs von 22,99 EUR pro A-Aktie mitgeteilt hat (BewGA Seite 111). Der betrachtete Referenzzeitraum entspricht den Vorgaben der höchstrichterlichen Rechtsprechung (BGH, Beschluss vom 19. Juli 2010 – II ZB 18/09 –, BGHZ 186, 229 ff., „Stollwerck“, Rn. 21, 22). Er ist grundsätzlich auch hier sachgerecht, weil der Börsenkurs ab dem 23. Januar 2014 bis zum Bewertungsstichtag 15. Juli 2014 maßgeblich durch das Zweite Übernahmeangebot (zumindest während der Angebotsphase vom 28. Februar 2014 bis 22. April 2014) und durch Abfindungsspekulationen in Bezug auf den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geprägt war (vgl. dazu LG Stuttgart, Beschluss vom 03. April 2018 – 31 O 138/15 KfHSpruchG –, Rn. 168, juris).
Berücksichtigt man, dass in den herangezogenen dreimonatigen Referenzzeitraum zur Bestimmung des durchschnittlichen Börsenkurses hier auch das erste, gescheiterte Übernahmeangebot fällt, und betrachtet man unter diesem Blickwinkel die Kursentwicklung (vgl. BewGA Seite 111)
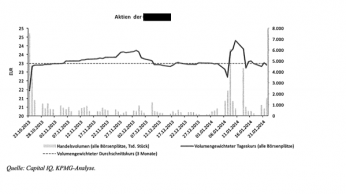
im Vergleich zur langfristigen Kursentwicklung seit 2009 (BewGA Seite 110),

so wird deutlich, dass der Börsenkurs im herangezogenen Dreimonatszeitraum bereits maßgeblich vom (ersten) Übernahmeangebot geprägt war, das sich auf zunächst 23,00
EUR und dann auf 23,50 EUR pro A-Aktie belief. Ob das vorliegende (erste) Übernahmeangebot ein Grund sein könnte, auf noch frühere Zeiträume abzustellen, kann hier dahingestellt bleiben, weil angesichts des zuvor deutlich niedrigeren langfristigen Kursniveaus den Minderheitsaktionäre durch die Berücksichtigung der umsatzgewichteten Durchschnittskurse im hier gewählten Zeitraum 23. Oktober 2013 bis zum 22. Januar 2014 jedenfalls kein Nachteil entstanden ist.
Wie bereits ausgeführt, ergibt sich allerdings aufgrund der Besonderheiten des vorliegenden Falles, d.h. der BGH-Entscheidung vom November 2017 und den daraus zu ziehenden Konsequenzen (vgl. oben II.), eine (Mindest-)Abfindung von 23,50 EUR pro Aktie, die den umsatzgewichteten Börsenkurs des herangezogenen Referenzzeitraums übersteigt.
Die Kammer hat darüber hinaus geprüft, ob die Besonderheiten des vorliegenden Falles es rechtfertigen, auch die weitere tatsächliche Kursentwicklung ab dem 23. Januar 2014 zu berücksichtigen und etwa den über der tatsächlich angebotenen Gegenleistung liegenden tatsächlichen umsatzgewichteten Durchschnittskurs während der Angebotsphase des Zweiten Übernahmeangebots heranzuziehen. Insoweit lässt sich jedoch nicht unterscheiden, welcher Anteil des Differenzbetrages zu den 23,50 EUR pro Aktie auf Spekulationen über mögliche (inzwischen auch vom BGH zuerkannte) ergänzende Zahlungsansprüche nach § 31 Abs. 1, 4 WpÜG, welcher Anteil auf Abfindungsspekulationen wegen des zuvor angekündigten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages und welcher Anteil schließlich auf allgemeine Erwartungen des Kapitalmarkts hinsichtlich der weiteren unternehmerischen Entwicklung der A AG zurückzuführen ist. Sicher feststellbar ist nur, dass der Börsenkurs während der Dauer des Zweiten Übernahmeangebots „nach unten“ durch die angebotenen 23,50 EUR pro Aktie „abgesichert“ war.
Einzelne Antragsteller stellen auf Börsenkurse nach dem hier maßgeblichen Bewertungsstichtag ab (etwa die Antragsteller Ziff. 6 bis 8, Bl. 29-11 d.A.: 21. Januar 2015; Ziff. 9: grafisch bis über den 01. Januar 2015 hinaus, Bl. 30-3 d.A.; Ziff. 18 bis 23, Börsenkurs von ca. 27 EUR bei Antragstellung im Februar 2015, Bl. 117 d.A.; dahingehend auch Ziff. 24, Bl. 142 d.A.; Ziff. 27, Bl. 164 d.A.; Ziff. 28, Bl. 174 d.A.; Ziff. 29, Bl. 188 d.A.). Diese Kurse sind wegen des Stichtagsprinzips für die Entscheidung ohne Bedeutung.
Dass der Börsenkurs der A-Aktie zwischen 2006 und 2008 bei teilweise deutlich über 30,00 EUR lag (worauf etwa die Antragsteller Ziff. 18 bis 23 und die Antragstellerin Ziff. 28 hinweisen, Bl. 113, 172 d.A.), ist angesichts des langen Zeitraums zwischen diesen Jahren und dem hier maßgeblichen Bewertungsstichtag für die Bewertung ebenfalls nicht relevant.
Der vorstehend aufgezeigte, mehrjährige langfristige Kursverlauf bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Kurs maßgeblich durch „Übernahmephantasien“ geprägt wurde (genauer: der Kursverlauf von Januar 2009 bis Oktober 2013), plausibilisiert im Übrigen aus Sicht der Kammer das gefundene Ergebnis. Dieser Kursverlauf zeigt, dass eine Abfindung von deutlich über 23,50 EUR pro Aktie ohne die beiden Übernahmeangebote von K nicht mehr als angemessen angesehen werden könnte, selbst wenn man bei einer Ertragswertberechnung, sofern man entsprechende Veränderungen der Parameter vornimmt (wie im Z-Gutachten geschehen), rechnerisch zu noch höheren Werten gelangen könnte. Die Kammer nimmt insoweit Bezug auf die Ausführungen im Beschluss vom 03. April 2018 (LG Stuttgart, Beschluss vom 03. April 2018 – 31 O 138/15 KfHSpruchG –, Rn. 69 ff., 90 ff. juris).
IX. Zwischenergebnis für die Angemessenheit der Abfindung
Der bezogen auf den Bewertungsstichtag 15. Juli 2014 zutreffend ermittelte Ertragswert liegt bei 22,42 EUR pro A-Aktie (vgl. oben III. bis VII.). Der umsatzgewichtete durchschnittliche Börsenkurs bezogen auf den unmittelbar vor der Bekanntgabe der geplanten Strukturmaßnahme am 23. Januar 2014 endenden dreimonatigen Referenzzeitraum beläuft sich auf 22,99 EUR pro Aktie (oben VIII.). Da er über dem nach dem Ertragswertverfahren ermittelten Schätzwert liegt und es keine Anhaltspunkte für eine im Referenzzeitraum bestehende Marktenge gibt, wäre der letztgenannte Betrag grundsätzlich auch als (Mindest-)Abfindung zu zahlen (vgl. BGH, Beschluss vom 19. Juli 2010 – II ZB 18/09 –, BGHZ 186, 229-242, Rn. 10), wenn man die Besonderheit des vorliegenden Falles außer Betracht ließe.
Die Besonderheit liegt, wie oben ausführlich dargestellt, aus Sicht der Kammer darin, dass wegen des Zweiten Übernahmeangebots alle außenstehenden Aktionäre kurz vor Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages einen durchsetzbaren Rechtsanspruch auf mindestens die im Rahmen dieses Zweiten Übernahmeangebots von der Antragsgegnerin angebotene Gegenleistung von 23,50 EUR pro A-Aktie hatten und der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag aufgrund der bestehenden Mehrheitsverhältnisse schon während der Angebotsphase des Zweiten Übernahmeangebots hätte geschlossen und ein entsprechender Hauptversammlungsbeschluss hätte herbeigeführt werden können. Deshalb ist die im Rahmen des Zweiten Übernahmeangebots tatsächlich angebotene Gegenleistung von 23,50 EUR pro A-Aktie im vorliegenden Sonderfall wertprägend (vgl. oben II.). Dies führt zu einem auf 23,50 EUR erhöhten Mindestbetrag der angemessenen Abfindung.
X. Berechnung des angemessenen Ausgleichs
Ein Gewinnabführungsvertrag muss gemäß § 304 Abs. 1 Satz 1 AktG einen angemessenen Ausgleich für die außenstehenden Aktionäre durch eine auf die Anteile am Grundkapital bezogene wiederkehrende Geldleistung (Ausgleichszahlung) vorsehen. Als Ausgleichszahlung ist gemäß § 304 Abs. 2 Satz 1 AktG mindestens die jährliche Zahlung des Betrags zuzusichern, der nach der bisherigen Ertragslage der Gesellschaft und ihren künftigen Ertragsaussichten unter Berücksichtigung angemessener Abschreibungen und Wertberichtigungen, jedoch ohne Bildung anderer Gewinnrücklagen, voraussichtlich als durchschnittlicher Gewinnanteil auf die einzelne Aktie verteilt werden könnte.
1. Methodische Vorgehensweise und Basis der Verrentung
Zur Prognose der durchschnittlich verteilungsfähigen Gewinne wird wegen der Volatilität der Ertragslage sowohl in der betriebswirtschaftlichen als auch in der juristischen Literatur überwiegend an den nach der Ertragswertmethode ermittelten Unternehmenswert angeknüpft. Aus diesem wird sodann nach der Rentenformel der Ausgleichsbetrag abgeleitet (Wollny, Der objektivierte Unternehmenswert a.a.O. Seite 859; Emmerich, in Emmerich/Habersack Aktien-/GmbH-KonzernR 8. Aufl. 2016, § 304 Rn. 39; Paulsen, in MüKo AktG 4. Aufl. 2015, § 304 AktG Rn. 75, 77). Nur vereinzelt wird vertreten, der Ausgleich nach § 304 AktG dürfe nicht als verrentete Abfindung angesehen werden und könne daher nicht aus dem „Abfindungswert“ berechnet werden (Paschos, in Henssler/Strohn GesR 3. Aufl. § 304 Rn. 8). Auch nach der Rechtsprechung des OLG Stuttgart und des BGH kann der nach § 304 Abs. 1, 2 AktG geschuldete Ausgleich aus dem Ertragswert durch Verrentung abgeleitet werden, weil auf diesem Wege methodisch der Durchschnitt der künftigen Gewinnerwartungen ermittelt werden kann (OLG Stuttgart, Beschluss vom 14. Februar 2008 – 20 W 9/06 –, Rn. 116, juris unter Hinweis auf Jonas Wpg 2007, 835, 836 f). Nach einer Entscheidung des BGH aus dem Jahre 2003 ist den Minderheitsaktionären der voraussichtlich verteilungsfähige durchschnittliche Bruttogewinnanteil als feste Größe zu gewährleisten, von dem die Körperschaftsteuerbelastung in der jeweils gesetzlich vorgegebenen Höhe abzusetzen ist. Auch der BGH geht hier von den „betriebswirtschaftlichen Eckdaten des Unternehmens“ und davon aus, dass der Bruttowert des Ausgleichs mithilfe eines Kapitalisierungszinssatzes ermittelt wird (BGH, Beschluss vom 21. Juli 2003 – II ZB 17/01 –, Rn. 12, 13). Die gewählte methodische Vorgehensweise ist daher nicht zu beanstanden.
Der BGH hat zwar in der bereits erwähnten Entscheidung von 2003 vertreten, dass bei der Bestimmung des Ausgleichs das gesondert bewertete (nicht betriebsnotwendige) Vermögen „abgesetzt“ werden könne, also nicht berücksichtigt werden müsse, weil sich der Ausgleichsanspruch danach bemesse, „welchen Dividendenanspruch der Aktionär ohne den Unternehmensvertrag zu erwarten gehabt hätte“. Er ging davon aus, dass es sich bei nicht betriebsnotwendigem Vermögen um Vermögenswerte handelt, die „auf den Ertrag keinen Einfluss haben“ (BGH, Beschluss vom 21. Juli 2003 – II ZB 17/01 –, Rn. 14, juris; wie BGH auch Paulsen, in MüKo AktG a.a.O. § 304 Rn. 77). Allerdings dürften zumindest aus den bei Veräußerung des nicht betriebsnotwendigen Vermögens generierten Mitteln weitere Erträge zu erzielen sein, deren Berücksichtigung bei § 304 Abs. 1, 2, AktG die Kammer für sachgerecht hält. Dementsprechend hält auch der Bewertungsgutachter in Abgrenzung zu der erwähnten BGH-Entscheidung es für sachgerecht, das nicht betriebsnotwendige Vermögen in die Berechnung mit einzubeziehen, um den außenstehenden Aktionären keine Vermögensbestandteile vorzuenthalten (BewGA Seite 114).
Letztlich kann die aufgeworfene Frage hier dahingestellt bleiben, weil der Bewertungsgutachter das nicht betriebsnotwendige Vermögen in den zu verrentenden Barwert von 4.556 Mio. EUR mit einbezogen hat und stille Reserven insoweit nicht ersichtlich sind (BewGA Seite 116, 102). Das wirkt sich zugunsten der Minderheitsaktionäre aus.
Der Ertragswert ist selbst dann der maßgebliche Ausgangswert für die Verrentung zur Ermittlung des angemessenen Ausgleichs, wenn dieser unter dem Börsenwert liegt (BGH, Urteil vom 13. Februar 2006 – II ZR 392/03 –, BGHZ 166, 195-203, Rn. 13; OLG Stuttgart, Beschluss vom 17. Oktober 2011 – 20 W 7/11 –, Rn. 481, juris). Dementsprechend bleiben im vorliegenden Fall für die Ermittlung des Ausgleichs nach § 304 AktG sowohl der gegenüber dem Ertragswert etwas höhere umsatzgewichtete durchschnittliche Börsenkurs von 22,99 EUR als auch der von der Kammer wegen der Besonderheiten des vorliegenden Falles bei der Abfindung als angemessen erachtete Betrag von 23,50 EUR pro Aktie außer Betracht.
2. Kapitalisierungszinssatz
Der BGH hat in der erwähnten Entscheidung von 2003 erwähnt, der Unternehmenswert (Ertragswert) müsse zur Ermittlung des Ausgleichs nach § 304 AktG mit dem „inflationsbereinigten Kapitalisierungszinssatz“ verzinst werden (BGH, Beschluss vom 21. Juli 2003 – II ZB 17/01 –, Rn. 14, juris). Der vom BGH in der Entscheidung erwähnte Zinssatz von 9,5% entspricht in etwa der Summe des im entschiedenen Falls angewendeten Basiszinssatzes von 7,5% und des angenommenen Risikozuschlags von 2-3% (vgl. erstinstanzlicher Beschluss des LG München I, 5 HKO 14889/92, AG 1999, 476). Demgegenüber hat sich inzwischen in der betriebswirtschaftlichen und juristischen Literatur die Auffassung durchgesetzt, dass für die Zwecke der Ausgleichsberechnung nach § 304 AktG nicht der zur Ermittlung des Ertragswerts herangezogene Kapitalisierungszinssatz, sondern ein modifizierter Kapitalisierungszinssatz zu verwenden ist, insbesondere weil die Ausgleichszahlungen zumindest während der Laufzeit des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages anders als die unregelmäßigen vorvertraglichen Gewinne quasi sicher sind, so dass eine Verrentung mit dem vollen risikoadjustierten Kapitalisierungszinssatz nicht sachgerecht ist. Überwiegend wird deshalb für die Ermittlung des Ausgleichs ein Mischzinssatz aus risikofreiem Basiszinssatz und risikoadjustiertem Kapitalisierungszinssatz angenommen (Wollny, Der objektivierte Unternehmenswert, Seite 859 f.; Paulsen, in MüKo AktG a.a.O. § 304 Rn. 77). Diese Auffassung teilt auch das OLG Stuttgart (OLG Stuttgart, Beschluss vom 05. November 2013 – 20 W 4/12 –, Rn. 134, juris).
Hinzu kommt im vorliegenden Fall, dass gemäß § 5 Abs. 6 des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages der Abfindungsanspruch der außenstehenden Aktionäre im Falle der späteren Kündigung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages wieder auflebt („Abfindungsklausel“). Dadurch sind die Minderheitsaktionäre wirtschaftlich hinreichend vor der während des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zu befürchtenden „Auszehrung“ der Gesellschaft geschützt (OLG Stuttgart, Beschluss vom 05. Juni 2013 – 20 W 6/10 –, Rn. 263, juris). Letztlich tragen sie nur noch das Risiko des Zahlungsausfalls der Antragsgegnerin als Schuldnerin der Ausgleichszahlung.
Es ist angemessen, in einem solchen Fall zur Berücksichtigung des verbleibenden, vom Minderheitsaktionär mitgetragenen (Bonitäts-)Risikos auf einen Kapitalisierungszinssatz in Höhe der Summe aus quasi-risikolosem Basiszinssatz und einem angemessenen Risikoaufschlag für das Ausfallrisiko abzustellen, insoweit also – soweit möglich – den „Spread“ zwischen einer entsprechenden Unternehmensanleihe des Schuldners der Ausgleichszahlung bzw. des Garanten der Patronatserklärung gegenüber einer fristenkongruenten landesspezifischen Staatsanleihe abzustellen (wie hier OLG Frankfurt, Beschluss vom 24. November 2011 – 21 W 7/11 –, Rn. 203, juris, das bei einer in Deutschland ansässigen Muttergesellschaft der Schuldnerin der Ausgleichszahlung auf eine entsprechende Bundesanleihe abstellt).
Der Bewertungsgutachter hat dementsprechend den Bonitätszuschlag anhand des Renditespreads zwischen einer von K begebenen Anleihe (Laufzeit bis 2044) und einer auf USD lautenden Staatsanleihe (Laufzeit ebenfalls bis 2044) ermittelt und diesen Renditespread mit 1,20% beziffert. Zuzüglich des quasi-risikolosen Basiszinssatzes von zum Bewertungsstichtag 2,50% (vgl. oben IV. 3.) gelangt er auf diese plausible und nachvollziehbare Weise zu einem Verrentungszinssatz vor Einkommensteuer von 3,7%. Hieraus hat er einen Verrentungszinssatz von 2,724% nach Steuern errechnet (BewGA Seite 115). Unter Berücksichtigung teils nicht der inländischen Körperschaftsteuer unterliegender Erträge der A AG hat er eine jährliche Bruttoausgleichszahlung vor persönlicher Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag von 0,83 EUR pro Aktie ermittelt (BewGA Seite 116).
Der sachverständige Prüfer hat die grundsätzliche Vorgehensweise des Bewertungsgutachters (Heranziehen der Renditedifferenz zu einer K -Anleihe) als sachgerecht bestätigt und die Größenordnung des vom Bewertungsgutachter angegebenen Bonitätszuschlag durch Heranziehung des Bonitätsaufschlags für im Rating vergleichbare amerikanische Industrieanleihen (BBB+) plausibilisiert (er gibt insoweit einen credit spread von 1,1% an). Auch er kommt – unter der Prämisse eines unveränderten Körperschaftsteuersatzes von 15% und eines Solidaritätszuschlags von 5,5% - zu einer Ausgleichszahlung von 0,83 EUR pro Aktie (PB Seite 88 ff.).
Auf die von einigen Antragstellern angesprochene mögliche Verschlechterung der künftigen Bonität von K im Zeitablauf (vgl. etwa Antragsteller Ziff. 30, 31 – Bl. 221 d.A.) kommt es nicht an, denn maßgeblich sind nach dem Stichtagsprinzip die damaligen Einschätzungen der Kapitalmarktteilnehmer zur Bonität von K , nicht spekulative Erwägungen zu deren weiterer künftiger Entwicklung.
Ein Währungsrisiko tragen die außenstehenden Aktionäre als Gläubiger der Ausgleichszahlung ebenfalls nicht, weil sich aus § 4 Abs. 3 des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages ergibt, dass die Ausgleichszahlung in Euro zu leisten ist.
3. Ergebnis
Die im Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vorgesehene jährliche Ausgleichszahlung ist angemessen und bedarf keiner gerichtlichen Korrektur.
XI. Gesamtergebnis
Die Kammer hat sich umfassend mit sämtlichen Einwendungen der Antragsteller auseinandergesetzt, auch wenn im Interesse einer Straffung der Darstellung im vorliegenden Beschluss nicht auf sämtliche Kritikpunkte eingegangen werden konnte.
Während die im Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vorgesehene Ausgleichszahlung nach § 304 AktG angemessen ist, war die Abfindung gemäß § 305 AktG wegen der Besonderheiten des vorliegenden Falles auf 23,50 EUR pro Aktie zu erhöhen. Der Anspruch auf Verzinsung ab dem Ablauf des Tages, an dem der Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag wirksam geworden ist, ergibt sich aus § 305 Abs. 3 Satz 3 AktG.
D. Verfahrensanträge, Nebenentscheidungen
I. Verfahrensanträge
Soweit einige Antragsteller die Anordnung einer Vorlage weiterer Unterlagen (wie etwa von Arbeitspapieren der Wirtschaftsprüfer aus Bewertungsarbeiten) gefordert haben, setzt eine solche Anordnung gemäß § 7 Abs. 7 SpruchG die hier nicht gegebene Entscheidungserheblichkeit der entsprechenden Unterlagen voraus.
Ein Sachverständigengutachten ist auch unter Beachtung des Amtsermittlungsgrundsatzes im Spruchverfahren nur bei Bedarf einzuholen. In § 8 Abs. 2 SpruchG kommt die zentrale Rolle zum Ausdruck, die der Gesetzgeber dem sachverständigen Prüfer und dessen hier durchgeführter Anhörung verleiht (OLG Stuttgart, Beschluss vom 27. Juli 2015 – 20 W 5/14 –, juris; OLG Zweibrücken, Beschluss vom 02. Oktober 2017 – 9 W 3/14 –, Rn. 19, juris). Der Rechtsstreit ist entscheidungsreif, ohne dass es der Heranziehung eines (weiteren) Sachverständigen bedurfte.
II. Kostenentscheidung, Geschäftswertfestsetzung, Beschwerdezulassung
1. Kostenentscheidung
Die Kostenentscheidung beruht auf § 15 SpruchG. Die Gerichtskosten können ganz oder zum Teil den Antragstellern auferlegt werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Bloßes Unterliegen genügt, anders als bei § 91 ZPO, nicht, um unter Billigkeitsgesichtspunkten, die positiv festzustellen sind (etwa Rechtsmissbräuchlichkeit, offensichtliche Unzulässigkeit oder offensichtliche Unbegründetheit des Antrags), eine Kostentragungspflicht der Antragsteller hinsichtlich der Gerichtskosten und der Kosten der Antragsgegnerin zu begründen (Rosskopf, in Kölner Kommentar a.a.O. §15 SpruchG Rn. 43).
Gemäß § 15 Abs. 2 SpruchG in der seit 2013 geltenden Fassung kann das Gericht anordnen, dass der Antragsgegner des Spruchverfahrens die notwendigen Kosten der Antragsteller trägt, wenn dies unter Berücksichtigung des Ausgangs des Verfahrens der Billigkeit entspricht. Im Falle der Zurückweisung der Anträge der Antragsteller ist dafür kein Raum (Drescher, in Spindler/Stilz, a.a.O. § 15 SpruchG Rn. 24).
Dies führte im vorliegenden Fall dazu, dass diejenigen Antragsteller, deren Anträge unzulässig sind, ihre außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben, während die übrigen, in Bezug auf die Höhe der Abfindung erfolgreichen Antragsteller ihre zur zweckentsprechenden Erledigung der Angelegenheit notwendigen Auslagen von der Antragsgegnerin ersetzt bekommen. Denn ihre zulässigen Anträge hatten in Bezug auf die (erhöhte) Abfindung Erfolg.
Der Anspruch des gemeinsamen Vertreters gegen den Antragsgegner auf Ersatz von Auslagen und Vergütung ergibt sich aus § 6 Abs. 2 SpruchG.
2. Geschäftswert für die Gerichtsgebühren
Der Geschäftswert für die Gerichtsgebühren ist von Amts wegen durch Beschluss festzusetzen (§ 79 Abs. 1 GNotKG), der auch in Entscheidung zur Hauptsache aufgenommen werden kann, aber nicht muss. Für die Gerichtsgebühren maßgeblich ist im Falle einer Erhöhung der Abfindung die Differenz zwischen unternehmensvertraglich angebotener und nach der gerichtlichen Entscheidung tatsächlich angemessener Kompensationsleistung je Aktie multipliziert mit der Gesamtzahl der bei Ablauf der Antragsfrist „außenstehenden“ Aktien (§ 74 Satz 2 GNotKG; zum Ganzen vgl. Koch, in Hüffer/Koch SpruchG a.a.O. § 15 Rn. 2, 3 beck-online). Gemäß § 74 Satz 1, Hs. 2 GNotKG ist der Geschäftswert auf höchstens 7,5 Mio. EUR begrenzt.Die Zahl der bei Ablauf der Antragsfrist außenstehenden Aktien ist nicht bekannt. Jedoch hat die Antragsgegnerin vorgetragen, dass es bei Ablauf des Zweiten Übernahmeangebots noch 48.943.046 außenstehende A-Aktien gegeben habe (Bl. 1126 d.A.. Unter Zugrundelegung dieser Zahl ergäbe sich infolge der Erhöhung der Abfindung von 22,99 EUR auf 23,50 EUR pro Aktie eine Gesamtsumme von rund 24.961.000 EUR. Die Begrenzung des Geschäftswerts auf 7,5 Mio. EUR kommt damit zum Tragen.
Der anteilige Gegenstandswert für die Anwaltsvergütung auf Antragstellerseite ist in Spruchverfahren hingegen nach Maßgabe des § 31 RVG zu bestimmen und hängt vom Einzelfall ab. Hier gilt gemäß § 31 Abs. 1 Satz 4 RVG ein Mindestgeschäftswert von 5.000 EUR. Der Gegenstandswert für die anwaltliche Tätigkeit wird gemäß § 33 Abs. 1 RVG nur auf Antrag durch Beschluss selbständig festgesetzt. Von einer Festsetzung im vorliegenden Beschluss wurde daher abgesehen.
3. Beschwerdezulassung
Nach § 12 Abs. 1 Satz 1 SpruchG findet gegen die vorliegende Entscheidung die Beschwerde statt. Spruchverfahren sind vermögensrechtliche Streitigkeiten i.S.d. § 61 FamFG, der gemäß § 17 SpruchG insoweit Anwendung findet. Weil das SpruchG selbst keine Regelung über die Beschwer enthält, gilt grundsätzlich § 61 Abs. 1 Nr. 1 FamFG, wonach der Wert des Beschwerdegegenstandes 600 EUR übersteigen muss (LG Frankfurt, Beschluss vom 27. Mai 2014 – 3-05 O 34/13 –, Rn. 79, juris). Übersteigt die Beschwer diesen Betrag nicht, hängt die Zulässigkeit der Beschwerde von einer Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts nach § 61 Abs. 3 Satz 1 FamFG ab. Das Gericht des ersten Rechtszugs lässt die Beschwerde zu, wenn die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Beschwerdegerichts erfordert und der Beteiligte durch den Beschluss mit nicht mehr als 600 Euro beschwert ist. Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall gegeben, denn die hier relevante Frage, ob und inwieweit ein dem Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages unmittelbar vorausgegangenes öffentliches Übernahmeangebot „wertprägend“ ist und daher bei der Abfindung als Mindestbetrag zu berücksichtigen ist, ist höchstrichterlich noch nicht abschließend geklärt. Dasselbe gilt für die weitere Frage, ob im Falle einer unangemessenen, nicht den Anforderungen des § 31 Abs. 1 WpÜG entsprechenden Gegenleistung im Rahmen eines Übernahmeangebots auch die tatsächlich übernahmerechtlich angemessene Gegenleistung zu berücksichtigen ist. Die Beschwerde wird daher wegen grundsätzlicher Bedeutung und zur Fortbildung des Rechts für alle Antragsteller unabhängig von der Höhe ihrer Beschwer zugelassen.


