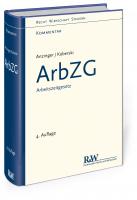LAG Nürnberg: Unzulässige Berufung – fehlende Benennung des Berufungsklägers
LAG Nürnberg, Urteil vom 11.4.2024 – 4 Sa 259/23
Volltext: BB-Online BBL2024-2483-2
Leitsatz
Die in § 519 Abs. 2 Nr. 2 ZPO vorgeschriebene Erklärung, dass gegen ein bestimmtes Urteil Berufung eingelegt werde, muss auch die Angabe enthalten, für wen und gegen wen das Rechtsmittel eingelegt sein solle. Hiernach muss aus der Berufungsschrift entweder schon für sich allein oder jedenfalls mit Hilfe weiterer Unterlagen, wie etwa des ihr beigefügten erstinstanzlichen Urteils – bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist – eindeutig zu erkennen sein, wer Berufungskläger ist und wer Berufungsbeklagter. Bei verständiger Würdigung des gesamten Vorgangs der Rechtsmitteleinlegung muss ein vernünftiger Zweifel an der Person des Rechtsmittelklägers und des Rechtsmittelbeklagten ausgeschlossen sein.
Sachverhalt
Die Parteien streiten über die Wirksamkeit einer Kündigung der Beklagten vom 14.12.2022 während der Probezeit zum 31.01.2023 und über Zahlungsansprüche der Klägerin.
Die Klägerin war bei der Beklagten seit 20.06.2022 auf Grundlage einer arbeitsvertraglich vereinbarten Festvergütung i.H.v. 6.434,00 € brutto (zuzüglich weiterer Vergütungsbestandteile) als Senior Consultant/Account Director beschäftigt.
Im September 2022 erlitt die Klägerin einen Fahrradunfall. Im vorliegenden Rechtsstreit legte sie eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (Erstbescheinigung) vom 09.11.2022 für den Zeitraum vom 09.11.2022 bis 16.11.2022 (Bl. 34 d.A.) sowie eine weitere Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (Erstbescheinigung) vom 18.11.2022 für den Zeitraum vom 18.11.2022 bis 02.12.2022 (Bl. 35 d.A.) vor. Die erstgenannte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung hatte sie bei der Beklagten nicht vorgelegt und ihre Arbeitsleistung in diesem Zeitraum erbracht.
Mit E-Mail vom 18.11.2022 (Bl. 32 d. A.) teilte die Klägerin ihrer Vorgesetzten, Frau H., u.a. mit, dass sie eine Innenohrerschütterung (stumpfes Innenohrtrauma) mit „amtlicher Hörminderung“ inkl. Tinnitus als Folge des Fahrradunfalls erlitten habe und daher arbeitsunfähig erkrankt sei.
Mit Schreiben vom 05.12.2022 (Bl. 114 d. A.) hörte die Beklagte den bei ihr gebildeten Betriebsrat zu der beabsichtigten Kündigung an.
Mit Schreiben vom 14.12.2022, der Klägerin zugegangen am 15.12.2022, kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis innerhalb der Probezeit zum 31.01.2023.
Am 26.01.2023 teilte die Beklagte der Klägerin per E-Mail (Bl. 60 ff. d. A.) u.a. mit, dass der verbleibende Urlaub an ihren letzten Arbeitstagen auf jeden Fall genommen werden müsse. Mit E-Mail vom 27.01.2023 teilte die Klägerin daraufhin der Beklagten mit, dass sie mit der Eintragung ihres Urlaubes nicht einverstanden sei und darum bitte, diesen rückgängig zu machen.
Für den Zeitraum vom 30.01.2023 bis 31.01.2023 legte die Klägerin eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (Folgebescheinigung) vom 06.02.2023 vor (Bl. 53 d. A.).
Mit ihrer Klage vom 03.01.2023 wendet sich die Klägerin gegen die Kündigung und macht Zahlungsansprüche geltend. Sie hat erstinstanzlich vorgetragen, dass die Kündigung rechtsmissbräuchlich sei. Die Beklagte habe gekündigt, da die Klägerin aufgrund eines Fahrradsturzes zwei Wochen arbeitsunfähig gewesen sei. Vor der Krankheitszeit sei mit ihr ausführlich besprochen worden, wo sie im nächsten Jahr eingesetzt werden würde. Es sei auch schon ein Organisationschart erstellt worden, in dem ihr ein Team zugeordnet worden sei. In diesem Chart sei die geplante Struktur der Kundenbetreuung ab März/April 2023 abgebildet gewesen. Die Besprechung der neuen Struktur habe am 15.11.2022 stattgefunden. Das Chart sei ihr nach der Besprechung per E-Mail geschickt worden. Die Klägerin sei darin unterschiedlichen Kundengruppen zugeordnet worden. In einem Gespräch mit Frau H. am 11.10.2022 sei ihr mitgeteilt worden, dass sie sehr zufrieden mit der Klägerin und ihrer Entwicklung und ihrem Einsatz sei und es sei angekündigt worden, dass es im Team Veränderungen geben werde und sie bereits erste Ideen habe, wie sie, Frau H., die Arbeit ab März 2023 („im neuen Jahr“) im Team unter Berücksichtigung der Klägerin verteile. Nach ihrem Fahrradunfall Anfang September 2022 habe sie sich aus Angst, da sie noch in der Probezeit gewesen sei, nicht krankschreiben lassen. Seit dem Fahrradsturz mit einer Gehirnerschütterung und einem Ohrtrauma habe sich ein Tinnitusleiden entwickelt. Anfang November sei dies immer stärker geworden. Daher habe sie ihre Ärztin krankgeschrieben. Aufgrund der Probezeit und der hohen Arbeitsauslastung des Teams habe sich die Klägerin allerdings nicht getraut, in den Krankenstand zu gehen. Sie habe weiterhin gearbeitet und sei am 15.11.2022 mit neuen Projekten betraut worden. Am 17.11.2022 sei nach einem Kundentermin das Pfeifen im Ohr so laut gewesen, dass sie dem nicht mehr habe standhalten können und sich gegenüber ihrer Vorgesetzten offen geäußert habe. Diese sei aufgrund des bestehenden Termindruckes des Teams nicht erfreut und nahezu erbost über die Klägerin gewesen. Die Klägerin habe noch am 17.11.2022 ihre Ärztin aufgesucht, welche festgestellt habe, dass sie für jedenfalls zwei Wochen arbeitsunfähig sei. Aufgrund der Aussichten, dass das Tinnitusleiden sich andernfalls auf dieser Lautstärke chronifizieren würde, sei die Klägerin diesmal auch in den angeordneten Krankenstand gegangen. Dies habe sie sich zu diesem Zeitpunkt allerdings nur getraut, da ihr mehrfach und zuletzt am 15.11.2022 mitgeteilt worden sei, dass man sie langfristig bei der Beklagten behalten wolle. Während der Krankheitszeit habe ihre Vorgesetzte ihre Arbeitsunfähigkeit nicht akzeptieren wollen. Sie habe versucht, die Klägerin zum Arbeiten zu ermuntern. Einen Tag, nachdem sie nach der Krankschreibung wieder arbeitsfähig gewesen sei, sei ihr mitgeteilt worden, dass in dem Team kein Platz für sie sei und der Vertrag in der Probezeit beendet werde. Ihre Stelle sei auch unmittelbar neu ausgeschrieben worden. Am 09.12.2022 sei ihr ein Aufhebungsvertrag angeboten worden. Da sie diesen nicht angenommen habe, sei ihr am 15.12.2022 die Kündigung überreicht worden.
Es lägen Indizien vor, dass ihre Vorgesetzte aufgrund der Tinnituserkrankung den Entschluss gefasst habe, ihr in der Probezeit zu kündigen. Sie habe wohl Bedenken gehabt, dass die Klägerin dauerhaft die von dem Team erwartete Leistung von ca. 120% Arbeitsauslastung nicht erbringen würde. So habe die Klägerin seit Beginn Ihrer Tätigkeit bereits 80 Überstunden angesammelt, mit zunehmender Tendenz.
Die Kündigung vom 14.12.2022 erfülle gleichzeitig den Tatbestand der Diskriminierung aufgrund eines Diskriminierungsmerkmals nach § 1 AGG, hier aufgrund einer Behinderung. Die Vorgesetzte der Klägerin habe detaillierte Kenntnis von dem Gesundheitszustand der Klägerin und auch davon gehabt, dass aufgrund der Tinnituserkrankung eine dauerhafte Beeinträchtigung vorliege. Die Klägerin leide unter bleibenden Schäden, sie habe einen dauerhaften Hörverlust und eine daraus folgende Schwerhörigkeit. Die Erkrankung habe eine erhebliche Steigerung der Stressempfindsamkeit zur Folge und schränke die Belastbarkeit erheblich ein. Die Behinderung sei für die Kündigung kausal gewesen. Der zeitliche Zusammenhang zwischen der Mitteilung der Erkrankung und dem Kündigungsentschluss sei nach der Beweiserleichterung des § 22 AGG das kausalitätsbegründende Indiz. Insbesondere, da der Klägerin bevor sie ihre Krankheit mitgeteilt habe, bereits ihre Übernahme durch die Beklagte nach der Probezeit zugesichert worden sei. Nach dem eigenen Sachvortrag der Beklagten habe diese bis zum 17.11.2022 einen Kündigungsentschluss nicht gefasst gehabt.
Die Probezeit sei noch bis zum 31.01.2023 gelaufen. Es habe daher keine Eile bestanden, die Entscheidung über die Weiterführung des Arbeitsverhältnisses zu treffen. Man hätte die Klägerin nach der erstmaligen Arbeitsunfähigkeit innerhalb der Probezeit erstmals wieder zurückkehren lassen und sich dann in Ruhe ein Bild verschaffen können. Diese Option habe man nicht gewählt, da man aufgrund der E-Mail vom 18.11.2022 fest entschlossen gewesen sei, der Klägerin zu kündigen. Man habe während ihrer behinderungsbedingten Abwesenheitszeit entschieden, das Arbeitsverhältnis zu beenden. Dies könne denklogisch nur auf die E-Mail vom 18.11.2022 zurückzuführen sein.
Außerdem liege eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts vor. Die Art und Weise, wie der Klägerin ihre Arbeitsweise und die Inanspruchnahme anderer Mitarbeiter zur Last gelegt werde, würde man einem männlichen Arbeitnehmer niemals zur Last legen. Es sei üblich, dass männliche Führungskräfte die Arbeitskraft ihnen zuarbeitender Personen in Anspruch nähmen. Allerdings scheine das gleiche Verhalten von einer weiblichen Arbeitnehmerin Aversionen hervorzurufen. Auch die Personen, die der Klägerin einen unangemessenen Ton vorwerfen würden, seien allesamt männlich und auf der Ebene der Klägerin nicht übergeordnet gewesen. Es habe einen Konflikt mit Herrn I. gegeben. Dieser sei seit 18 Jahren bei der Beklagten beschäftigt und bemüht, seinen Status gegenüber studierten Mitarbeiterinnen zu behaupten. Er habe ausschließlich weibliche Mitarbeiterinnen, die ihm nicht zu widersprechen wagten. Dies sei im Unternehmen bekannt. So habe auch die Vorgesetze Frau H. zu der Klägerin gesagt: „Alle starken Frauen geraten mit Herrn I. aneinander. Nimm das nicht Ernst, das hat keinen Einfluss auf deine Position.“ Allerdings habe Frau H. die Beschwerde der Klägerin über Herrn I. nicht nach oben eskalieren wollen, da dies der Mühe nicht wert sei. Dass daher der Ton der Klägerin als „falsch“ empfunden worden sei, sei ausschließlich dem Umstand geschuldet, dass sie eine Frau sei. Die ordnungsgemäße Anhörung des Betriebsrates werde mit Nichtwissen bestritten.
Der Klägerin stehe ein Schmerzensgeldanspruch zu, der sich der Höhe nach an § 15 Abs. 2 AGG orientiere. Sie habe aufgrund der rechtsmissbräuchlichen Kündigung der Beklagten einen erheblichen Schaden erlitten, gerade weil das Arbeitsverhältnis nach so kurzer Zeit gekündigt worden sei. Sie habe für diese neue Anstellung eine gute Stelle gekündigt, auf der sie sich auch wohl gefühlt habe. Der Schaden sei besonders groß, da der berufliche Lebenslauf hierdurch erheblich beeinträchtigt worden sei. Eine Anstellung von sechs Monaten falle in jeder Personalabteilung negativ ins Gewicht und schüre den Verdacht, dass eine Probezeitkündigung zu Grunde liege.
Die Klägerin habe einen Anspruch auf Zahlung von Urlaubsabgeltung in Höhe von 342,50 € brutto. Sie habe für das Jahr 2023 noch drei Tage Urlaub gehabt. Nach Abgeltung von zwei Urlaubstagen durch die Beklagte sei noch ein Urlaubstag abzugelten. Die Klägerin sei am 27.01.2023 zwar buchstäblich gegen ihren Willen gezwungen worden, an den letzten drei Tagen des Arbeitsverhältnisses diesen Urlaub zu nehmen und zu verbrauchen; sie habe hiergegen allerdings mehrfach widersprochen. Sie habe das Arbeitsverhältnis bis zum Ende, nämlich bis zum 31.01.2023, bestreiten wollen. Anstatt eine Freistellung auszusprechen, sei ihr trotz ihrer ausdrücklichen Mitteilung, dass sie keinen Urlaub nehmen werde, am Freitag, den 27.01.2023 mittags, nachdem sie bereits ein paar Stunden gearbeitet habe, der Zugang zu dem Computersystem ausgeschaltet und es sei ihr mitgeteilt worden, dass sie nun im Urlaub sei. Eine Freistellung sei nicht erfolgt, vielmehr habe der Arbeitgeber einseitig und eigenmächtig angeordnet, sie sei nun im Urlaub.
Die Klägerin hat erstinstanzlich beantragt,
1. Festzustellen, dass das zwischen den Parteien bestehende Arbeitsverhältnis durch die Kündigung der Beklagten zugegangen am 15.12.2022 nicht aufgelöst wurde.
2. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin ein in das Ermessen des Gerichtes gestelltes Schmerzensgeld zuzüglich Zinsen ab dem 27.2.2023 zu bezahlen.
3. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin 342,50 Euro brutto Urlaubsabgeltung zu bezahlen.
Die Beklagte hat erstinstanzlich beantragt,
die Klage abzuweisen.
Die Beklagte hat erstinstanzlich vorgetragen, die innerhalb der vereinbarten Probezeit ausgesprochene Kündigung habe das Arbeitsverhältnis zum 31.01.2023 aufgelöst. Sie sei keine Reaktion auf die Arbeitsunfähigkeit der Klägerin gewesen. Die Kündigung beruhe nicht auf einer unfallbedingten Arbeitsunfähigkeit bzw. gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Vielmehr seien andere und legitime Gründe für die Entscheidung der Beklagten ausschlaggebend gewesen. Tatsächlich sei die Kündigung aufgrund der Nichteignung der Klägerin für die konkrete Position ausgesprochen worden. Diese habe wesentliche Punkte der Arbeitsaufgabe während ihrer Probezeit trotz Hinweisen und Feedback nicht aufgenommen und bis zur Entscheidung über die Probezeit in Verhalten und Leistung ein nicht akzeptables Arbeitsergebnis erzielt, das die Entscheidung der Arbeitgeberin rechtfertige. Der Kündigungsentscheidung seien mehrere Gespräche der Klägerin mit ihren Führungskräften, Frau H. und Frau J., vorausgegangen, in denen ihr die Mängel ihrer Herangehensweise an ihre Tätigkeit deutlich kommuniziert worden und ihr Hinweise und Empfehlungen mitgegeben worden seien, diese an den Anforderungen auszurichten.
Es sei auch keine Diskriminierung der Klägerin erfolgt, da rein sachliche Kriterien der Aufgabenerfüllung in der konkreten Position der Entscheidung der Beklagten zugrunde gelegen hätten. Das Engagement der Klägerin für ihre Arbeitsaufgabe und ihre guten Vorkenntnisse im Category-Management seien dabei gewürdigt worden, ihre Erkrankung habe dem keinen Abbruch getan. Die Entscheidung zur Kündigung sei bis Mitte Dezember 2022 offen gewesen, da weitere Positionen für die Klägerin geprüft worden seien und der Klägerin auch eine interne Vakanz aufgezeigt worden sei. Die konkrete Aufgabe infolge ihres hohen Projektanteils und ihrer Komplexität beinhalte durchaus Stressoren, mit denen vielleicht nicht jeder Mensch umgehen könne. Diese Merkmale seien aber immanent Teil der Aufgabe in einer solchen projektbezogenen Tätigkeit. Die Behauptung der Klägerin, sie sei durch die Beklagte während einer Arbeitsunfähigkeit zur Arbeit gedrängt worden, sei unzutreffend. lm Gegenteil sei die Klägerin durch ihre Führungskraft zur Ruhe und Abstand von Mails angehalten worden. Der Hinweis auf die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und die Mitteilung zur Dauer der Erkrankung sei ein gesetzlicher Anspruch des Arbeitgebers, dem die Klägerin genügen müsse.
Die Stelle sei durch analytische Aufgaben und Projektmanagement gekennzeichnet. Sie verlange einen hohen Grad an Selbstorganisation und Effizienz und die Fähigkeit, mit hohem Termindruck und vielen wechselnden Aufgaben durch die gleichzeitig zu betreuenden Kundenaufträge umzugehen. Der Klägerin habe die Verantwortung für die vertragsgerechte Lieferung der Marktforschungsleistungen an den Kunden oblegen, wie auch die Sicherstellung einer internen effizienten Koordination der Projekte unter Einsatz der Ressourcen und Einhaltung der Budgets. Nachdem sie ihre Tätigkeit aufgenommen habe, habe sich nach einigen Monaten gezeigt, dass ihre Einarbeitung nicht den Anforderungen der Tätigkeit entsprochen habe. Es sei aufgefallen, dass der zeitliche Aufwand für die von ihr verantworteten Lieferungen an die Kunden sowohl bei ihr selbst wie auch bei zuarbeitenden Kollegen auffällig hoch gewesen sei. Sie habe sehr großen Wert auf die Detailtiefe der Datenauswertungen gelegt und in diese Aufgabe auch häufig Kollegen zu ihrer Unterstützung eingespannt. Hierzu sei ihr verschiedentlich Rückmeldung verbunden mit Empfehlungen für eine Veränderung gegeben worden. Am 11.10.2022 seien ihr als kritische Punkte von Frau H. die zu große Detailorientierung und die durch den großen benötigten Arbeitseinsatz gefährdete Marge ihrer Projekte genannt worden. Die von der Klägerin im Rechtsstreit vorgelegte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom 09.11.2022 bis 16.11.2022 sei der Beklagten nicht bekannt gewesen. Der entscheidende Meilenstein für die Beurteilung der Probezeit sei eine Präsentation am 17.11.2022 gewesen. Feedback noch vor Abschluss der Vorbereitungen an die Klägerin sei gewesen, dass im Entwurf der Klägerin für die Präsentation ein wesentlicher Teil, nämlich die Empfehlungen an den Kunden, fehlten und unbedingt aufgenommen werden müssten. Außerdem sei an diesem Tag bemängelt worden, dass die Zusammenfassung am Ende zu unkonkret sei und daher auch hier nachgebessert werden müsse. Es sei ihr auch mitgeteilt worden, dass sie die Budgets ihrer Projekte im Auge behalten müsse, da sie auffällig häufig und in übergroßem Umfang Kollegen als zusätzliche Unterstützung für ihre Projekte eingespannt habe. Es sei dann Aufgabe der Klägerin gewesen, selbst die Mängel des Präsentationsentwurfs zu korrigieren. Stattdessen habe sie für deren Behebung am 16.11.2022 eine Teamkonferenz mit einigen Kollegen angesetzt, die allesamt dafür eingespannt worden seien, die noch fehlenden Teile beizubringen. Diese Konferenz sei ursprünglich für eine Stunde angesetzt worden, dann aber über die Mittagspause hinweg auf 2,5 Stunden ausgedehnt worden und habe in weitere Arbeit für die Kollegen gemündet. In den Folgetagen sei zusammen mit HR intern geprüft worden, ob die Klägerin eventuell in anderen offenen Positionen in Consumer Panel eingesetzt werden könnte. Hier habe sich jedoch – auch aus der ablehnenden Haltung der (im Umkreis intensiv von der Klägerin eingespannten) Kollegen gegenüber der Klägerin – keine Möglichkeit gefunden. Kurz vor Rückkehr der Klägerin aus der Arbeitsunfähigkeit hätten sich Frau H. und Frau J. zur Probezeit-Entscheidung abgestimmt und seien zu dem Entschluss gekommen, dass die Klägerin mit den Anforderungen der Stelle überfordert sei und es nicht schaffe, sich auf die maßgeblichen Faktoren der Aufgabe zu fokussieren. Die Beklagte habe die Klägerin zu keinem Zeitpunkt über die erwartete Arbeitsweise und deren notwendige Veränderung im Unklaren gelassen und auch nie den Eindruck erweckt, sie würde mit der Klägerin eine sichere Zukunft gestalten. Das von der Klägerin vorgelegte Chart sei durch Frau H. ausdrücklich als nicht endgültig bezeichnet und daher der Klägerin auch nicht ausgehändigt oder per Mail zur Verfügung gestellt worden. Die Klägerin sei keinem Team fest, also nach der Probezeit, zugeordnet worden. Weder durch Frau H. noch durch Frau J. sei jemals eine solche Zusage gegeben worden. Im Gegenteil habe die Klägerin deutliche Hinweise auf ungenügende Umstände und eine notwendige Verbesserung ihrer Leistungen erhalten, so dass sie habe erkennen müssen, dass die Probezeit eben nicht glatt verlaufe.
Der Betriebsrat sei vor Ausspruch der Kündigung ordnungsgemäß mit Schreiben vom 05.12.2022 angehört worden. Er habe die Widerspruchsfrist verstreichen lassen.
Zum Zeitpunkt der Kündigung sei für die Beklagte eine längerdauernde Erkrankung der Klägerin oder eine sich verschlechternde Entwicklung in keiner Weise erkennbar gewesen. Die Klägerin sei am 05.12.2022 aus ihrer Arbeitsunfähigkeit zurückgekehrt und habe danach ohne Unterbrechung bis Weihnachten gearbeitet. Die Beklagte habe sich nach rein sachlichen Kriterien ein Bild von der Eignung und Leistung der Klägerin gemacht. Unfall und Erkrankung und die weitere gesundheitliche Entwicklung hätten für die Entscheidung der Beklagten zur Trennung von der Klägerin keine Rolle gespielt.
Ein Anspruch auf Schmerzensgeld bestehe nicht. Die Erkrankung der Klägerin stehe in keinem Zusammenhang mit der getroffenen Entscheidung zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Damit sei auch kein Fall einer Benachteiligung nach dem AGG im Ausspruch der Probezeitkündigung erkennbar.
Die Behauptungen der Klägerin zum Auftreten der männlichen Führungskräfte und insbesondere des Kollegen I. seien unzutreffend. Dieser sei eine allgemein geschätzte und anerkannte Führungskraft mit untadeligem Auftreten.
Ein Anspruch auf Urlaubsabgeltung bestehe nicht. Die letzte Möglichkeit der Klägerin, die drei Tage Resturlaub in Natura zu nehmen, seien die drei letzten Arbeitstage der Kündigungsfrist vor ihrem Austritt gewesen, nämlich Freitag, 27.01.2023, Montag, 30.01.2023 und Dienstag, 31.01.2023. An diesen Tagen habe die Beklagte der Klägerin den Resturlaub gewährt. Der Wunsch der Klägerin, diesen Urlaub im letztem noch möglichen Zeitraum nicht zu nehmen, trete gegenüber der Pflicht des Arbeitgebers, Erholung in Natura zu gewähren, zurück. Es stehe der Klägerin nicht frei, nach ihrem Belieben einen Erholungsanspruch in einen Geldanspruch umzuwandeln. Da die Klägerin für den 30. und 31.01.2023 eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorgelegt habe, hätten diese beiden Tage nicht als Urlaub gewährt werden können. Für sie sei mit der Abrechnung im Februar 2023 eine Nachzahlung vorgenommen worden.
Das Arbeitsgericht Nürnberg hat mit Urteil vom 23.08.2023 die Klage abgewiesen. Unwirksamkeitsgründe für die Kündigung lägen nicht vor. Die Kündigung sei nicht wegen einer Erkrankung ausgesprochen worden. Aus § 8 EFZG folge, dass die Arbeitsunfähigkeit der Klägerin eine zulässige Erwägung zum Ausspruch einer Kündigung darstellen könne. Zudem habe die Klägerin nicht nachgewiesen, dass die Kündigung gerade wegen der Arbeitsunfähigkeit der Klägerin ausgesprochen worden sei. Hierfür bestünden keine hinreichenden Anhaltspunkte. Auch verstoße die Kündigung nicht gegen die Vorgaben des AGG. Es lägen keine hinreichenden Indizien vor, dass die Kündigung wegen einer Behinderung oder wegen des Geschlechts erfolgt sei. Folglich stehe der Klägerin auch kein Schadensersatzanspruch zu. Die Klägerin könne darüber hinaus keine Zahlung wegen Urlaubsabgeltung für einen Tag beanspruchen. Die insoweit streitgegenständliche Urlaubsgewährung für den 27.01.2023 sei ordnungsgemäß erfolgt. Zu diesem Zeitpunkt habe die Klägerin einen Resturlaubsanspruch von 3 Tagen beanspruchen können und es hätten noch lediglich 3 Arbeitstage bis zur beabsichtigten Beendigung des Arbeitsverhältnisses vorgelegen. Die mit E-Mail vom 26.01.2023 erfolgte Anordnung von Urlaub, die auch gerade nicht lediglich die Anordnung einer Freistellung beinhaltete, sei folglich trotz des Widerspruchs der Klägerin ordnungsgemäß erfolgt.
Das Urteil des Arbeitsgerichts Nürnberg wurde der Prozessbevollmächtigten der Klägerin am 08.09.2023 zugestellt. Mit Schriftsatz vom 06.10.2023, eingegangen beim Landesarbeitsgericht Nürnberg am 07.10.2023 (Samstag), legte die Prozessbevollmächtigte der Klägerin Berufung ein. Der Schriftsatz vom 06.10.2023, dem keine Anlagen beigefügt waren, hat auszugsweise folgenden Inhalt:
„Aktenzeichen der ersten Instanz:
Az 12 Ca 33/23, Arbeitsgericht Nürnberg Frau A./ C. SE In der bezeichneten Angelegenheit legen wir gegen das Urteil des Arbeitsgericht Nürnberg vom 23.8.2023 zugestellt am 8.9.2023 hiermit Berufung ein.
Die Berufung wird mit gesondertem Schriftsatz begründet werden.“
Die Berufungsschrift wurde dem Vorsitzenden am 10.10.2023 vorgelegt. Die erstinstanzliche Akte ist beim Landesarbeitsgericht Nürnberg am 20.10.2023 eingegangen.
Die Berufungsbegründungsschrift vom 08.12.2023, die keine ausdrücklichen Anträge der Klägerin enthielt, ist – nach erfolgter Fristverlängerung – am selben Tag beim Landesarbeitsgericht Nürnberg eingegangen.
Die Klägerin macht im Berufungsverfahren geltend, dass das Arbeitsgericht § 8 EFZG verkannt habe. Auch sei unzutreffender Weise davon ausgegangen worden, dass die Tinnituserkrankung der Klägerin keine Behinderung darstelle. Das Arbeitsgericht habe den Beweismaßstab und die Beweislastumkehr gemäß § 22 AGG verkannt. Infolge des Verhaltens der Beklagten und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Arbeitsunfähigkeit und der Kündigung der Klägerin habe es nach den Grundsätzen der sekundären Beweislast bzw. den Vorgaben aus § 22 AGG der Beklagten oblegen, nachzuweisen, dass die Kündigung nicht aus missbräuchlichen, diskriminierenden Gründen ausgesprochen worden sei. Auch sei nicht hinreichend gewürdigt worden, dass die Kündigung eine Benachteiligung wegen des Geschlechts darstelle. Infolge einer Verletzung des rechtlichen Gehörs sei auch nicht berücksichtigt worden, dass die Beklagte bis zum 15.11.2022 fest mit der Klägerin geplant habe. Dies ergebe sich unter anderem aus Organisationscharts. Die Beklagte habe der Klägerin mitgeteilt, dass sie die Probezeit bestanden habe. Hierzu hätte dem angebotenen Zeugenbeweis nachgegangen werden müssen. Erst infolge der Mitteilung der Arbeitsunfähigkeit am 18.11.2022 habe sich die Beklagte – in Widerspruch zu ihrem bisherigen Verhalten – zur Kündigung entschieden.
Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Klägerin wird auf den Berufungsbegründungsschriftsatz vom 08.12.2023 sowie auf den weiteren – ergänzenden – Vortrag der Klägerin mit Schriftsatz vom 03.04.2024 (ohne Anlagen) sowie die am 07.04.2024 übermittelten – ohne gesonderten Vortrag erfolgenden – Anlagen Bezug genommen.
Die Klägerin und Berufungsklägerin beantragt im Berufungsverfahren die Aufhebung der erstinstanzlichen Entscheidung und stellt die erstinstanzlich gestellten Anträge zu 1) und 2) sowie hilfsweise den Antrag zu 3) (Urlaubsabgeltung) für den Fall, dass der Antrag zu 1) abgewiesen wird.
Die Beklagte und Berufungsbeklagte beantragt,
Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Arbeitsgerichts Nürnberg vom 23. August 2023, Az. 12 Ca 33/23, wird zurückgewiesen.
Die Beklagte hat im Rahmen des Berufungsverfahrens geltend gemacht, dass die Berufung unzulässig sei. Aus der Berufungseinlegungsschrift sei nicht zu entnehmen, für wen und gegen wen das Rechtsmittel eingelegt worden sei. Auch habe die Klägerin in der Berufungsbegründung nicht hinreichend deutlich gemacht, inwieweit sie die erstinstanzliche Entscheidung angreife. Auch dies führe zur Unzulässigkeit der Berufung. Der mit Schriftsatz vom 03.04.2024, dem Prozessbevollmächtigten der Beklagten am 05.04.2024 zugegangen, erfolgte Vortrag sei als verspätet zurückzuweisen. Die am 07.04.2024 (Sonntag) gegenüber dem Gericht erfolgte Nachreichung von Anlagen sei ebenfalls verspätet und in Gänze nicht berücksichtigungsfähig, da ohne jeglichen Vortrag erfolgt. Es sei nicht die Aufgabe des Gerichts und der Beklagten, sich Sachvortrag der Klägerin aus den Anlagen zusammenzureimen. Der Klägerin sei zu keinem Zeitpunkt eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nach der Probezeit zugesichert worden. Die diesbezügliche Behauptung der Klägerin sei in keiner Weise hinreichend konkretisiert worden. Auch verstoße die Kündigung nicht gegen § 242 BGB und gegen das AGG. Eine Kündigung wegen Krankheit liege nicht vor und sei durch die Klägerin in keiner Weise hinreichend nachgewiesen worden. Das Vorliegen einer Behinderung werde bestritten. Eine solche sei der Beklagten jedenfalls zu keinem Zeitpunkt bekannt gewesen. Auch liege keine Benachteiligung infolge des Geschlechts vor. Im Kern beschränke sich der Vortrag der Klägerin auf Mutmaßungen und erfolge völlig ins Blaue hinein. Die Anordnung von Urlaub für den 27.01.2023 sei ordnungsgemäß erfolgt. Eine Verletzung rechtlichen Gehörs liege nicht vor.
Hinsichtlich des weiteren Vorbringens wird auf die Berufungserwiderung der Beklagten mit Schriftsatz vom 12.02.2024, den Schriftsatz vom 04.04.2024 und auf den Schriftsatz vom 10.04.2024 Bezug genommen.
Darüber hinaus wird auf die Feststellungen des Sachverhalts im arbeitsgerichtlichen Urteil, auf die von den Parteien eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf die Niederschriften über die mündlichen Verhandlungen vor dem Arbeitsgericht vom 23.08.2023 und dem Landesarbeitsgericht vom 11.04.2024 Bezug genommen.
Aus den Gründen
Die Berufung ist unzulässig und daher zu verwerfen.
I. Die Berufung der Klägerin ist gem. § 522 Abs. 1 Satz 2, § 519 ZPO, § 66 Abs. 1 ArbGG als unzulässig zu verwerfen, weil die Berufungsschrift bis zum Ablauf der Berufungsfrist am 09.10.2023 nicht erkennen ließ, wer Berufungskläger ist.
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des Bundesarbeitsgerichts muss die in § 519 Abs. 2 Nr. 2 ZPO vorgeschriebene Erklärung, dass gegen ein bestimmtes Urteil Berufung eingelegt werde, auch die Angabe enthalten, für wen und gegen wen das Rechtsmittel eingelegt sein solle. Hiernach muss aus der Berufungsschrift entweder schon für sich allein oder jedenfalls mit Hilfe weiterer Unterlagen, wie etwa des ihr beigefügten erstinstanzlichen Urteils – bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist – eindeutig zu erkennen sein, wer Berufungskläger ist und wer Berufungsbeklagter. Die Anforderungen an die zur Kennzeichnung der Rechtsmittelparteien nötigen Angaben richten sich nach dem prozessualen Zweck dieses Erfordernisses. Der zugrunde liegende Zweck besteht darin, dass im Falle einer Berufung, die einen neuen Verfahrensabschnitt vor einem anderen als dem bis dahin mit der Sache befassten Gericht eröffnet, zur Erzielung eines auch weiterhin geordneten Verfahrensablaufs aus Gründen der Rechtssicherheit die Parteien des Rechtsmittelverfahrens, insbesondere die des Rechtsmittelführers, zweifelsfrei erkennbar sein müssen. Bei verständiger Würdigung des gesamten Vorgangs der Rechtsmitteleinlegung muss daher ein vernünftiger Zweifel an der Person des Rechtsmittelklägers ausgeschlossen sein (vgl. BGH v. 09.04.2008 – VIII ZB 58/06; v. 04.06.1997 – VIII ZB 9/97; BAG v. 17.05.2001 – 8 AZB 15/01).
An die Bezeichnung der Parteien sind keine zu formalistischen Anforderungen zu stellen, die zur Erreichung des genannten Zwecks nicht erforderlich sind. Die durch das Grundgesetz gewährleisteten Verfahrensgarantien verbieten es, den Zugang zu den in den Verfahrensordnungen eingerichteten Instanzen in einer aus Sachgründen nicht mehr zu rechtfertigenden Weise zu erschweren. Aus diesem Grund scheitert nach der Rechtsprechung der obersten Bundesgerichte eine Berufung nicht an unvollständigen oder fehlerhaften Bezeichnungen des erstinstanzlichen Gerichts oder der Parteien des Berufungsverfahrens, wenn in Anbetracht der jeweiligen Umstände letztlich kein Zweifel an dem wirklich Gewollten aufkommen kann. Bei verständiger Würdigung des gesamten Vorgangs der Rechtsmitteleinlegung muss aber ein vernünftiger Zweifel an der Person des Rechtsmittelklägers und des Rechtsmittelbeklagten ausgeschlossen sein.
Etwaige ergänzende Angaben müssen sich aus Schriftstücken ergeben, die dem Rechtsmittelgericht innerhalb der Rechtsmittelfristen – wie beispielsweise aus dem der Berufungsschrift beigefügten erstinstanzlichen Urteil oder der vorhandenen Gerichtsakte – vorliegen. Dementsprechend reicht es nicht aus, wenn das Gericht die notwendigen – ergänzenden – Informationen lediglich durch eigene Ermittlungen mündlich zur Kenntnis bekommt. Die Bemühungen des Berufungsgerichts, die Mängel einer Berufungsschrift durch eigene Handlungen auszugleichen, können grundsätzlich nicht zu einer Heilung des formellen Mangels der Berufungsschrift und zur Zulässigkeit des Rechtsmittels führen (vgl. insgesamt BAG v. 26.06.2008 – 2 AZR 23/07).
Unter Berücksichtigung dieses Maßstabs genügt die Berufung der Klägerin den gesetzlichen Anforderungen nicht. Bei Ablauf der Berufungsfrist am 09.10.2023 war für das Berufungsgericht auf Grundlage der ihm zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Schriftstücke in keiner Weise erkennbar, wer Berufungskläger ist.
Die Prozessbevollmächtigte der Klägerin hat im Schriftsatz vom 06.10.2023 gerade nicht erklärt, für wen die Berufung eingelegt werde. Ausreichend war insoweit auch nicht, dass die Klägerin im Rahmen des Kurzrubrums an 1. Stelle genannt wurde. Weitere Schriftstücke waren darüber hinaus der Berufungseinlegungsschrift nicht beigefügt, insbesondere nicht das erstinstanzliche Urteil. Auch kann ergänzend nicht auf die dem Landesarbeitsgericht am 20.10.2023 übermittelte erstinstanzliche Prozessakte abgestellt werden. Zwar war es insoweit im Wege der Auslegung möglich, zu bestimmen, dass die Berufungseinlegungsschrift der Prozessbevollmächtigten der Klägerin vom 06.10.2023 eine Berufungseinlegung für die Klägerin beinhaltete. Allerdings lag die Prozessakte dem Landesarbeitsgericht erst am 20.10.2023 und damit nach Ablauf der Berufungseinlegungsfrist am 09.10.2023 vor.
II. 1. Die Klägerin hat als unterlegene Rechtsmittelführerin die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen, § 97 ZPO.
2. Gründe, die Revision zuzulassen, liegen nicht vor (vgl. § 72 Abs. 2 ArbGG).