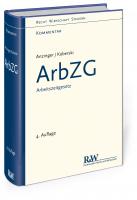LAG Berlin-Brandenburg: Kopftuchverbot einer Lehrerin
LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 27.11.2018 – 7 Sa 963/18
Volltext: BB-ONLINE BBL2019-627-5
unter www.betriebs-berater.de
Amtliche Leitsätze
1. Zu Bindungswirkung nach Art. 31 BverfGG an die Entscheidung des BVerfG vom 27.01.2015 – BvR 1181/10 – BverfGE 138, 296
2. Ein Kopftuchverbot, wie § 2 Ver-fArt29G BE 2005 es vorsieht, kann eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung iSv § 8 AGG nur dann darstellen, wenn eine hinreichend konkrete Gefahr für die staatliche Neutralität oder den Schulfrieden besteht.
3. Das Berliner Neutralitätsgesetz kann verfassungskonform ausgelegt werden (Anschluss an LAG Berlin-Brandenburg vom 09.02.2017 – 14 Sa 1038/16)
Sachverhalt
Die Parteien streiten über die Zahlung einer Entschädigung wegen einer Benachteiligung aufgrund der Religion.
Die Klägerin ist Diplom-Informatikerin; sie ist Muslima und trägt ein Kopftuch. Sie bewarb sich beim beklagten Land im Rahmen eines Quereinstiegs mit berufsbegleitendem Referendariat für eine Beschäftigung als Lehrerin in den Fächern Informatik und Mathematik in der integrierten Sekundarschule (ISS), dem Gymnasium oder der Beruflichen Schule. Als regionalen Wunscheinsatzort nannte sie in dem Bewerbungsverfahren die Bezirke Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Tempelhof-Schöneberg, Neukölln und Treptow-Köpenick (Bl. 68 – 70 d.A.). In einer anschließenden Regionenabfrage nannte sie als Einsatzort die Region 2, die die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg, Tempelhof-Schöneberg und Neukölln umfasst.
Mit E-Mail vom 3. Januar 2017 (Bl. 29 d.A.) lud das beklagte Land die Klägerin zu einem Bewerbungsgespräch für den 11. Januar 2017 ein. In diesem Schreiben wird u.a. darauf hingewiesen, dass an den Auswahlgesprächen Schulleitungen aller Schularten mit dem Bedarf an allgemeinbildenden Fächern teilnehmen würden und dass die Festlegung einer möglichen Einsatzschule erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfinde.
Die Klägerin trug bei dem Bewerbungsgespräch ein Kopftuch. Beim Verlassen des Raums sprach sie ein Mitarbeiter der regionalen Schulaufsicht auf die Rechtslage nach dem Berliner Neutralitätsgesetz an, wobei der genaue Inhalt dieses Gesprächs zwischen den Parteien streitig ist. Die Klägerin erklärte in diesem Gespräch, sie werde das Kopftuch im Unterricht nicht ablegen.
Nachdem sie vom beklagten Land in der Folgezeit weder eine Zu- noch eine Absage erhalten hatte, machte die Klägerin, die davon ausgeht, dass sie wegen ihres Kopftuchs nicht eingestellt worden ist, mit Schreiben vom 10. März 2017 eine Entschädigung wegen einer Benachteiligung aufgrund ihrer Religion geltend. Für die Einzelheiten der Schreiben wird auf Bl. 31-33 d.A. Bezug genommen. Eine Reaktion seitens des beklagten Landes erfolgte nicht.
Mit der vorliegenden, beim Arbeitsgericht am 9. Juni 2017 eingegangenen und dem beklagten Land am 15.06.2017 zugestellten Klage verfolgt die Klägerin ihren geltend gemachten Anspruch auf Zahlung einer Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG, die nicht unter 3 Monatsgehältern liegen sollte, gerichtlich weiter.
Die Klägerin hat behauptet, sie sei wegen ihres Kopftuchs nicht eingestellt worden. Anlässlich des Vorstellungsgesprächs am 11. Januar 2017 habe sie der Mitarbeiter der zentralen Bewerbungsstelle, Herr M. Sch., ausdrücklich auf ihr Kopftuch angesprochen und gefragt: „Sie wissen, dass das Tragen eines Kopftuchs an einer öffentlichen Schule verboten ist. Die anderen Kolleginnen machen das so, dass sie es ablegen. Wie wollen Sie das machen?“ Sie habe darauf erklärt, dass sie nicht bereit sei, das Kopftuch abzulegen und darauf hingewiesen, dass Referendarinnen im berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst mit Kopftuch unterrichten würden und dies nicht verboten sei. Herr Sch. habe dann erwidert, dass eine Einstellung mit Kopftuch nicht möglich sei.
Die Klägerin hat beantragt,
den Beklagten zu verurteilen, an sie eine angemessene Entschädigung wegen einer Benachteiligung aufgrund der Religion zu zahlen, deren genaue Höhe ins Ermessen des Gerichts gestellt wird.
Das beklagte Land hat beantragt,
die Klage abzuweisen.
Das beklagte Land hat behauptet, die Klägerin sei nicht deshalb nicht eingestellt worden, weil sie ein Kopftuch getragen habe, sondern weil es in der von ihr zuletzt genannten Region 2 für die an den berufsbildenden Schulen zu besetzenden Stellen mit dem Fach Informatik ausreichend Laufbahnbewerber gegeben habe. Zwei mit der Klägerin vergleichbare Quereinsteiger seien für eine andere Region eingestellt worden. Herr Sch. habe die Klägerin neutral und ohne Bezug auf eine konkrete Stelle beim Hinausbegleiten auf die Rechtslage hinsichtlich des Neutralitätsgesetzes im Hinblick auf das Kopftuch hingewiesen, das Wort Kopftuch aber nicht verwendet. Eine Absage habe die Klägerin nicht erhalten, weil die Bewerber und Bewerberinnen, die zunächst nicht ausgewählt worden seien, möglicherweise im Nachrückverfahren berücksichtigt würden. Der Klägerin hätte aber abgesagt werden sollen, was versehentlich unterblieben sei.
Jedenfalls aber wäre eine Nichtberücksichtigung der Klägerin wegen ihres Kopftuchs durch das Neutralitätsgesetz des Landes Berlin auch gerechtfertigt gewesen. Das Neutralitätsgesetz sei ohne Nachweis verfassungsgemäß und auch unionrechtskonform, des Nachweises einer konkreten Gefahr bedürfe es nicht. Angesichts der Vielzahl von Nationen und Religionen, die in der Stadt vertreten seien, sei eine strikte Neutralität im Unterricht aus präventiven Gründen erforderlich. Dies verdeutliche ein Appell der Berliner Schulleiter und Schulleiterinnen sowie der Gewerkschaft, die sich für einen Erhalt des Gesetzes eingesetzt hätten. Empirisches Material über Konfliktsituationen wegen des Kopftuches an Berliner Schulen sei nicht vorhanden. Es lägen nur Zeitungsartikel und Berichte direkt aus den Schulen vor. Aus einzelnen Hilferufen aus Berliner Brennpunktschulen werde deutlich, dass sich dort muslimische Mädchen und Jungen gegenseitig als bessere oder schlechtere Muslime mobbten und bedrohen würden. Gegebenenfalls müsse ein Sachverständigengutachten über die Gefahrenlage eingeholt werden. Würde das Gesetz als nicht verfassungsgemäß erachtet werden, sei eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht erforderlich. Eine verfassungsgemäße Auslegung des Gesetzes komme jedenfalls nicht in Betracht.
Das Arbeitsgericht hat mit Urteil vom 24. Mai 2018, auf dessen Tatbestand wegen der weiteren Einzelheiten des erstinstanzlichen Vorbringens der Parteien Bezug genommen wird (§ 69 Abs. 2 ArbGG), die Klage abgewiesen. Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt, das zwischen der Klägerin und dem Mitarbeiter der Beklagten anlässlich der Vorstellungsrunde geführte Gespräch stelle auch dann ein hinreichendes Indiz für eine Benachteiligung der Klägerin wegen ihrer Religion dar, wenn die Behauptungen des beklagten Landes, der Mitarbeiter habe die Klägerin nur allgemein zur Rechtslage nach dem Neutralitätsgesetz angesprochen, zugrunde gelegt würden. Den dann nach § 22 AGG erforderlichen Gegenbeweis habe das beklagte Land schon deshalb nicht erbracht, weil sich sein Vortrag zu der Auswahlentscheidung allein auf die Bewerbersituation an den berufsbildenden Schulen beschränkt habe, die Situation an den weiteren Schultypen ISS und Gymnasien jedoch nicht dargelegt werde. Der Hinweis auf einen fehlenden Bedarf für Informatik in der Region 2 stehe der Indizwirkung nicht entgegen, da es nahegelegen hätte, die Klägerin nach einer Einsatzbereitschaft in anderen Regionen zu befragen. Die Klägerin habe in ihrer Onlinebewerbung weitere Bezirke ausgewählt. Zudem habe das beklagte Land die Klägerin ja auch in Kenntnis der von ihr präferierten Bezirke zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Die unterbliebene Einstellung der Klägerin wegen des von ihr angekündigten Tragens eines Kopftuchs im Schuldienst erweise sich jedoch nach § 8 Abs. 1 AGG gerechtfertigt. Auf die Einhaltung der Frist nach § 15 Abs. 4 AGG komme es nicht an. Die in § 2 Satz 1 des Gesetzes zu Artikel 29 der Verfassung von Berlin vom 27. Januar 2005 (im Folgenden: Neutralitätsgesetz Berlin) geregelte Verpflichtung von Lehrkräften, im Dienst keine auffallenden religiös geprägten Kleidungsstücke zu tragen, stelle sich als wesentliche und entscheidende beruflichen Anforderung im Sinne dieser Norm dar. Der mit diesem Verbot verfolgte Zweck - Wahrung des verfassungsrechtlichen Gebots zu staatlicher Neutralität - sei rechtmäßig, die Anforderung sei angemessen und insbesondere seien beide mit höherrangigem Recht vereinbar. Der Gesetzgeber des Landes Berlin habe den ihm eingeräumten Einschätzungs- und Beurteilungsspielraum auch nicht deshalb überschritten, weil er sich für ein pauschales Verbot auffallender religiös geprägter Kleidungsstücke entschieden habe, ohne hierfür im Einzelfall das Vorliegen einer konkreten Gefahr für die Schutzgüter des Schulfriedens oder der staatlichen Neutralität zu verlangen, wie dies das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 27. Januar 2015 ( – 1 BvR 471/10, 1 BvR 1181/10 - NJW 2015, 1359 ff.) in Bezug auf das Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen gefordert habe. Die Verhältnisse in einem Stadtstaat wie Berlin seien nicht mit denen des Flächenstaates vergleichbar. Auch sei die Entscheidung auf erhebliche Kritik gestoßen und habe zu zwei abweichenden Meinungen geführt, wonach eine solche Auslegung die gegenläufigen verfassungsmäßig geschützten Rechte der Eltern, der Glaubensfreiheit der Schüler sowie den in weltanschaulich-religiöser Neutralität zu erfüllenden staatlichen Erziehungsauftrag nicht ausreichend berücksichtigt würde. Für die generelle Regelung eines Verbots auffallender religiöser Kleidungsstücke im Schuldienst würden Gründe der Praktikabilität, Handhabbarkeit und Rechtssicherheit sprechen. Die Regelung stehe auch im Einklang mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshof. Wegen der weiteren Einzelheiten der Entscheidungsgründe wird auf das angefochtene Urteil Bezug genommen.
Gegen dieses der Klägerin am 14. Juni 2018 zugestellten Urteil hat die Klägerin mit einem beim Landesarbeitsgericht am 3. Juli 2018 eingegangenen Schriftsatz Berufung eingelegt, die sie mit einem beim Landesarbeitsgericht am 14. August 2018 eingegangenen Schriftsatz begründet hat.
Die Klägerin wendet sich unter Wiederholung ihres erstinstanzlichen Vorbringens mit Rechtsausführungen gegen die Annahme des Arbeitsgerichts, die in § 2 des Berliner Neutralitätsgesetzes geregelte Verpflichtung der Lehrkräfte, im Dienst keine auffallenden religiös geprägten Kleidungsstücke zu tragen, stelle eine wesentliche und entscheidenden berufliche Anforderung nach § 8 AGG dar. Das Berliner Neutralitätsgesetz könne als Rechtfertigungsgrund nicht herangezogen werden, da es mit dem pauschalen Verbot, ein muslimisches Kopftuch zu tragen, gegen Art 4 GG verstoße. Die vom Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 27.01.2015 – 1 BvR 471/10, 1 BvR 1181/10 geforderte hinreichend konkrete Gefahr für den Schulfrieden oder die staatliche Neutralität habe das beklagte Land nicht dargetan. Konkrete Konflikte an den Berliner Schulen seien nicht benannt worden. Solche seien auch nicht im Rahmen der Beschäftigung von Referendarinnen mit Kopftuch aufgetreten. Jedenfalls aber würde sie als Quereinsteigerin mit berufsbegleitendem Referendariat ohnehin unter die Ausnahmeregelung des § 4 Neutralitätsgesetz Berlin gefallen.
Die Klägerin beantragt,
das am 24.05.2018 verkündete Urteil des Arbeitsgerichts Berlin, 58 Ca 7193/17, zugestellt am 14.06.2017, zu ändern und das beklagte Land zu verurteilen, an sie eine angemessene Entschädigung wegen einer Benachteiligung aufgrund der Religion zu zahlen, deren genaue Höhe ins Ermessen des Gerichts gestellt wird.
Das beklagte Land beantragt,
die Berufung der Klägerin und Berufungsklägerin zurückzuweisen.
Das beklagte Land verteidigt das arbeitsgerichtliche Urteil unter Ergänzung und Vertiefung seines erstinstanzlichen Vorbringens. Der Mitarbeiter Sch. habe nach dem Bewerbungsgespräch – unter vier Augen - auf die, nach Auffassung des Landes gültige Rechtslage hingewiesen, also darauf, dass das Tragen eines Kopftuches – außer an beruflichen Schulen – nicht mit dem Neutralitätsgesetz vereinbar sei und habe erwähnt, dass es Kolleginnen gebe, die das Kopftuch im Unterricht ablegen würden. Er habe die Klägerin gefragt, inwieweit das auch für sie in Betracht kommen könne, was diese sofort verneint habe. Bei dem Vorstellungsgespräch am 11.01.2017 seien nur Schulleiter und Schulleiterinnen von berufsbildenden Schulen anwesend gewesen. Es sei auch alleine ein Einsatz der Klägerin für diesen Bereich geprüft worden. Ohnehin würden die Schulleitungen selbst entscheiden, wer in ihre Schule „passen“ würde. Eine erfolgreiche Bewerbung setze daher voraus, dass der Bewerber, die Bewerberin die passende Schule finde. Das beklagte Land sei dabei nicht verpflichtet, in einem bestimmten Bewerbungsverfahren noch weitere Optionen für eine Unterbringung der Bewerber zu prüfen. Die Klägerin habe dann eine Absage für die aktuelle Bewerbung erhalten sollen, und zwar mit dem Hinweis, dass aktuell kein Angebot für die von ihr präferierte Region 2 vorliege. Dies sei versehentlich unterblieben. Die Nichteinstellung der Klägerin verstoße aber auch nicht gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Die Klägerin erfülle mit ihrem Kopftuch nicht die Anforderungen des Neutralitätsgesetzes. Dieses sei verfassungsgemäß. Es diene der Wahrung der staatlichen Neutralität an den Schulen. In den Brennpunktbereichen komme es bereits jetzt zu einer massiven Störung des Schulfriedens dadurch, dass insbesondere Jungen aus strengmuslimischen Familien andere muslimische aber auch alevitische Kinder im Hinblick auf „züchtige“ Kleidung, des Vermeidens eines Umgangs mit „Ungläubigen“ und des „richtigen“ Fastens mobben und einschüchtern würden. Ebenso komme es zum Mobbing gegenüber jüdischen, anders – und nicht gläubigen Mitschülern. In solchen Konflikten würde eine Lehrerin mit Kopftuch in dem bereits vorhandenen Konflikt eine Ermutigung für die strengreligiösen Kinder bedeuten. Durch eine Kopftuch tragende Lehrerin würden Kinder an allgemeinbildenden Schulen, insbesondere an Grundschulen, in ihrer Haltung zum Kopftuch beeinflusst und es würde den Kindern vermittelt, dass eine sittlich-moralisch gute Frau eine Frau mit Kopftuch sei. Mit einer Kopftuchtragenden Lehrerin würde der Druck insbesondere auf die Mädchen verstärkt, selbst ein Kopftuch zu tragen.
Wegen der weiteren Einzelheiten des zweitinstanzlichen Vorbringens der Parteien wird auf den Inhalt der zwischen ihnen gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.
Aus den Gründen
1. Die gemäß §§ 8 Abs. 2, 64 Abs. 1 und 2 ArbGG statthafte Berufung der Klägerin ist von ihr fristgemäß und formgerecht eingelegt und begründet worden (§§ 519, 520 Abs. 1 und 3 ZPO, § 66 Abs. 1 S. 1 und 2 ArbGG).
Die Berufung der Klägerin ist daher zulässig.
2. Die Berufung hat in der Sache teilweise Erfolg. Der Klägerin steht ein Anspruch auf Zahlung einer Entschädigung aus § 15 Abs. 2 AGG in Höhe von eineinhalb potentiellen Monatsgehältern zu.
2.1 Die Klage ist zulässig, insbesondere ist der Klageantrag hinreichend bestimmt iSv. § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Die Klägerin durfte die Höhe der von ihr begehrten Entschädigung in das Ermessen des Gerichts stellen. § 15 Abs. 2 AGG räumt dem Gericht bei der Höhe der Entschädigung einen Beurteilungsspielraum ein, weshalb eine Bezifferung des Zahlungsantrags nicht notwendig ist (BAG Urteil vom 23. November 2017 – 8 AZR 604/16 –, NJW 2018, 1497-1501). Die Klägerin hat auch Tatsachen benannt, die das Gericht bei der Bestimmung der Höhe der Entschädigung heranziehen soll und die Größenordnung der geltend gemachten Forderung angegeben. Sie geht davon aus, dass die Entschädigung mindestens drei nach der Entgeltgruppe 12 TV-L berechnete Monatsverdienste betragen sollte.
2.2 Die Klage ist auch teilweise begründet. Der Klägerin steht ein Anspruch auf Zahlung einer Entschädigung in Höhe von eineinhalb Monatsgehältern aus § 15 Abs. 2 AGG zu, weil sie wegen ihrer Religion vom beklagten Land bei der Bewerbung um eine Stelle als Lehrkraft im Wege des Quereinstiegs benachteiligt wurde.
2.2.1 Der persönliche Anwendungsbereich des AGG ist eröffnet. Die Klägerin hat sich beim beklagten Land auf eine Stelle als Lehrkraft beworben. Als Bewerberin ist sie „Beschäftigte“ im Sinne des AGG (§ 6 Abs. 1 Satz 2 AGG). Das beklagte Land ist Arbeitgeber i.S.v § 6 Abs. 2 Satz 1 AGG.
2.2.2 Die Klägerin hat ihren Anspruch mit Schreiben vom 10.03.2017 form- und fristgerecht geltend gemacht (§ 15 Abs. 4 AGG) und die Entschädigung fristgerecht eingeklagt (§ 61b Abs. 1 ArbGG).
2.2.2.1 Nach § 15 Abs. 4 AGG muss der Entschädigungsanspruch innerhalb einer Frist von zwei Monaten schriftlich geltend gemacht werden, es sei denn, die Tarifvertragsparteien haben etwas anderes vereinbart, was hier nicht der Fall ist. Die Frist beginnt nach § 15 Abs. 4 Satz 2 AGG im Falle einer Bewerbung oder eines beruflichen Aufstiegs mit dem Zugang der Ablehnung und in den sonstigen Fällen einer Benachteiligung zu dem Zeitpunkt, in dem der oder die Beschäftigte von der Benachteiligung Kenntnis erlangt.
Eine „Ablehnung durch den Arbeitgeber“ iSv. § 15 Abs. 4 Satz 2 AGG setzt eine auf den Beschäftigten bezogene ausdrückliche oder konkludente Erklärung des Arbeitgebers voraus, aus der sich für den Beschäftigten aus der Sicht eines objektiven Erklärungsempfängers eindeutig ergibt, dass seine Bewerbung keine Aussicht (mehr) auf Erfolg hat (BAG, Urteil vom 29. Juni 2017 – 8 AZR 402/15 – Rz. 20 - BAGE 159, 334-350). Ein Schweigen oder Untätigbleiben des Arbeitgebers reicht grundsätzlich nicht aus, um die Frist des § 15 Abs. 4 AGG in Gang zu setzen. Ebenso wenig reicht es aus, wenn der Bewerber nicht durch den Arbeitgeber, sondern auf andere Art und Weise erfährt, dass seine Bewerbung erfolglos war (BAG, Urteil vom 29. Juni 2017 – 8 AZR 402/15 – Rz. 20 mwN).
2.2.2.2 Im vorliegenden Fall wurde die Frist des § 15 Abs. 4 AGG schon deshalb nicht in Gang gesetzt, weil die Klägerin eine ausdrückliche oder konkludente Ablehnung seitens des beklagten Landes nicht erhalten hat.
Soweit die Klägerin zunächst in ihrer Klageschrift behauptet hat, sie sei bereits in der Vorstellungsrunde am 11.01.2017 „abgelehnt“ worden, ein Mitarbeiter der Zentralen Bewerbungsstelle habe ihr bereits in dem Vorstellungsgespräch am 11.01.2017 eine mündliche Absage erteilt, fehlt es zum einen schon an der Ablehnung seitens des Arbeitgebers. Der bloße Hinweis des Mitarbeiters der Zentralen Bewerbungsstelle Sch., eine Einstellung mit Kopftuch sei nicht möglich, stellt keine Absage des beklagten Landes dar. Zum anderen hat die Klägerin diesen Vortrag, sie habe bereits im Rahmen des Vorstellungsgesprächs eine Absage erhalten, so nicht mehr aufrechterhalten. Nachdem das beklagte Land darauf hingewiesen hatte, dass zunächst nicht ausgewählte Bewerberinnen und Bewerber keine Absage erhalten würden, weil sie über das Nachrückverfahren weiter im Verfahren bleiben würden, hat sie mit Schriftsatz vom 21.12.2017 ihren Vortrag zum Inhalt ihres Gesprächs mit diesem Mitarbeiter präzisiert und vorgetragen, sie sei von diesem Mitarbeiter darauf angesprochen worden, dass ein Unterrichten mit Kopftuch in einer öffentlichen Schule nicht möglich sei, er habe sie gefragt, wie sie es mit dem Kopftuch im Unterricht handhaben wolle und sie habe auf die Ausnahmeregelung für Referendarinnen und Auszubildende hingewiesen. Nach dieser Sachverhaltsdarstellung liegt eine Ablehnung des beklagten Landes ebenfalls nicht vor.
Hat die Klägerin aber unstreitig kein Ablehnungsschreiben erhalten, hat sie die Frist nach § 15 Abs. 4 AGG mit ihrem Schreiben vom 10.03.2017 gewahrt. Auf den genauen Zeitpunkt des Zugangs des Schreibens beim beklagten Land kam es dann nicht mehr an.
2.2.2.3 Die beim Arbeitsgericht am 09.06.2017 eingegangene Klage, die dem beklagten Land am 15.06.2017 und damit demnächst im Sinne von § 167 ZPO zugestellt wurde, wahrt die Frist des § 61 b Abs. 1 ArbGG, wonach die Klage innerhalb von 3 Monaten, nachdem der Anspruch schriftlich geltend gemacht worden ist, erhoben werden muss.
2.2.3 Die Klägerin wurde unmittelbar benachteiligt iSv § 3 Abs. 1 AGG. Denn sie wurde im Gegensatz zu anderen Bewerbern nicht für eine Einstellung in den Schuldienst des beklagten Landes für den Bereich der Grundschulen, die integrierten Gesamtschulen und Gymnasien in Betracht gezogen und ist auch nicht eingestellt worden. Diese Benachteiligung erfolgte aufgrund des Tragens eines Kopftuches, mithin wegen ihrer Religion. Jedenfalls hat sie für eine solche Benachteiligung hinreichend Indizien nach § 22 AGG vorgetragen, ohne dass das beklagte Land hätte widerlegen können, dass der Gleichbehandlungsgrundsatz nicht verletzt worden ist.
2.2.3.1 Der Anspruch auf Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG setzt einen Verstoß gegen das in § 7 Abs. 1 AGG geregelte Benachteiligungsverbot voraus, wobei § 7 Abs. 1 AGG sowohl unmittelbare als auch mittelbare Benachteiligungen verbietet. Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 AGG liegt eine unmittelbare Benachteiligung vor, wenn eine Person wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes eine weniger günstige Behandlung erfährt als eine andere Person in einer vergleichbaren Situation erfährt, erfahren hat oder erfahren würde. Demgegenüber liegt nach § 3 Abs. 2 AGG eine mittelbare Benachteiligung vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes - was auch eine Benachteiligung wegen mehrerer der in § 1 AGG genannten Gründe einschließt - gegenüber anderen Personen in besonderer Weise benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich.
Das Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 AGG erfasst allerdings nicht jede Ungleichbehandlung, sondern nur eine Ungleichbehandlung wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes. Zwischen der Benachteiligung und einem in § 1 AGG genannten Grund muss demnach ein Kausalzusammenhang bestehen. Soweit es um eine unmittelbare Benachteiligung iSv. § 3 Abs. 1 AGG geht, ist hierfür nicht erforderlich, dass der betreffende Grund iSv. § 1 AGG das ausschließliche oder auch nur ein wesentliches Motiv für das Handeln des Benachteiligenden ist; vielmehr ist der Kausalzusammenhang bereits dann gegeben, wenn die Benachteiligung iSv. § 3 Abs. 1 AGG an einen Grund iSv. § 1 AGG anknüpft oder durch diesen motiviert ist, wobei die bloße Mitursächlichkeit genügt (BAG 15. Dezember 2016 - 8 AZR 454/15 - Rn. 20 mwN, BAGE 157, 296). Geht es hingegen um eine mittelbare Benachteiligung iSv. § 3 Abs. 2 AGG, ist der Kausalzusammenhang dann gegeben, wenn die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 Halbs. 1 AGG erfüllt sind, ohne dass es einer direkten Anknüpfung an einen Grund iSv. § 1 AGG oder eines darauf bezogenen Motivs bedarf (BAG Urteil vom 23. November 2017 – 8 AZR 372/16 –, juris).
§ 22 AGG sieht für den Rechtsschutz bei Diskriminierungen im Hinblick auf den Kausalzusammenhang eine Erleichterung der Darlegungslast, eine Absenkung des Beweismaßes und eine Umkehr der Beweislast vor. Wenn im Streitfall die eine Partei Indizien beweist, die eine Benachteiligung wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes vermuten lassen, trägt die andere Partei die Beweislast dafür, dass kein Verstoß gegen die Bestimmungen zum Schutz vor Benachteiligung vorgelegen hat (vgl. z.B. BAG Urteil vom 23. November 2017 – 8 AZR 372/16 –, juris).
2.2.3.2 Die Klägerin hat hinreichend Indizien dafür vorgetragen, dass sie wegen ihrer Religion bei der Auswahlentscheidung für die Einstellung als Lehrkraft nicht berücksichtigt wurde.
Dabei kann dahinstehen, ob – wie das beklagte Land behauptet und anders als in dem Einladungsschreiben ausgeführt – bei dem Bewerbungsgespräch am 11.01.2017 nur Schulleiter und Schulleiterinnen der berufsbegleitenden Schulen anwesend waren und die Klägerin für die berufsbegleitenden Schulen allein aus fachlichen Gründen nicht ausgewählt wurde, weil es zum damaligen Zeitpunkt hinreichend Laufbahnbewerber gegeben habe. Die Bewerbung der Klägerin war nicht auf die berufsbegleitende Schule beschränkt. Vielmehr hat sie sich auch für einen Einsatz in der Integrierten Gesamtschule und den Gymnasien beworben. Einen solchen Einsatz hat das beklagte Land nicht in Erwägung gezogen, wie sich schon daraus ergibt, dass das beklagte Land selbst einräumt, die Klägerin hätte eine Absage erhalten sollen, dies sei lediglich versehentlich unterblieben.
Ein solcher Einsatz an den integrierten Gesamtschulen und den Gymnasien wurde nicht in Erwägung gezogen, weil die Klägerin im Unterricht ein Kopftuch tragen möchte. Indiz dafür ist das Gespräch zwischen der Klägerin und dem Mitarbeiter der zentralen Bewerbungsstelle anlässlich des Bewerbungsgesprächs über das Kopftuch der Klägerin. Dabei kann dahinstehen, mit welchem genauen Inhalt dieses Gespräch geführt wurde. Denn auch bei Zugrundelegung des vom beklagten Land zuletzt geschilderten Wortlautes, war Gegenstand des Gespräches, ob die Klägerin bereit wäre, das Kopftuch im Unterricht abzulegen, was von dieser abgelehnt wurde. Dies indiziert aber, dass die Klägerin deshalb nicht für eine Einstellung in der integrierten Gesamtschule bzw. dem Gymnasium in Erwägung gezogen wurde, weil sie ein Kopftuch trägt und nicht bereit war, das Kopftuch während des Unterrichts abzulegen. Die für eine Anwendung der Regelungen des § 22 AGG notwendigen Indizwirkungen lagen mithin vor.
War das beklagte Land daraufhin verpflichtet, diese Indizwirkung zu widerlegen, war festzustellen, dass es gerade nicht hat dartun können, dass die Nichtberücksichtigung der Klägerin keinen Bezug zu ihrem Kopftuch hatte. Soweit es sich auf besser qualifizierte Mitbewerber beruft, betreffen seine Ausführungen ausschließlich Bewerber für die berufsbegleitenden Schulen. Soweit es unter Bezug auf die anderen beiden Schultypen darauf verweist, deren Schulleitungen seien in dem Bewerbungsgespräch am 11.01.2017 nicht anwesend gewesen, reicht dies zur Widerlegung der Indizwirkung nicht aus. Denn die Klägerin wurde insgesamt mit ihrer Bewerbung nicht mehr berücksichtigt. Dass für diese beiden anderen Schultypen keine freien Stellen vorhanden gewesen wären, behauptet das beklagte Land selbst nicht. Es verweist in der Berufungserwiderung nur darauf, bei dem Vorstellungstermin am 11.01.2017 seien nur die Schulleitungen der berufsbildenden Schulen anwesend gewesen. Dass es bei den anderen Schultypen keine freien Stellen gegeben haben sollte ist in Anbetracht der Notwendigkeit, überhaupt Quereinsteiger einzustellen, auch nicht naheliegend.
Wurde die Klägerin aber aus dem Bewerbungsverfahren insgesamt ausgegliedert, weil sie im Unterricht ein Kopftuch zu tragen beabsichtigt, liegt eine Benachteiligung wegen ihrer dieser Entscheidung zugrunde liegenden religiösen Überzeugung vor.
Unabhängig davon, ob – wie das beklagte Land ausführt – das von der Klägerin getragene muslimische Kopftuch auch andere, nicht religiöse Hintergründe aufweist, ist es jedenfalls Ausdruck eines von der Klägerin nach dem Koran als verpflichtend empfundenen religiösen Gebots.
2.2.4. Die Nichtberücksichtigung der Klägerin für eine Einstellung in den Schuldienst des beklagten Landes ist nicht nach § 8 Abs. 1 AGG zulässig, weil es eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung wäre, keine auffallenden religiös geprägten Kleidungsstücke im Unterricht und damit auch keine Kopftücher zu tragen. Zwar sieht § 2 des Gesetzes zur Schaffung eines Gesetzes zu Art. 29 Verfassung von Berlin und zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes vom 27.01.2005 (GVBl. 2005, 92), im folgenden Neutralitätsgesetz, ein solches Verbot vor. Dies würde an sich einem Einsatz der Klägerin in der Schule entgegenstehen, da sie das Kopftuch im Unterricht nicht ablegen will.
2.2.4.1 Allerdings ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG 27.01.2015 – 1 BvR 471/10 und 1 BvR 1181/10 – BverfGE 138, 296; BVerfG 18.10.2016 – 1 BvR 354/11 – NZA 2016, 1522 zum Kopftuchverbot für Erzieherinnen an öffentlichen Kindertagesstätten) davon auszugehen, dass ein landesweites gesetzliches Verbot religiöser Bekundungen durch das äußere Erscheinungsbild schon wegen der bloßen abstrakten Eignung zur Begründung einer Gefahr für den Schulfrieden oder die staatliche Neutralität in einer öffentlichen bekenntnisoffenen Gemeinschaftsschule unverhältnismäßig ist, wenn dieses Verhalten nachvollziehbar auf ein als verpflichtend verstandenes religiöses Gebot zurückzuführen ist. Ein angemessener Ausgleich der verfassungsrechtlich verankerten Positionen - der Glaubensfreiheit der Lehrkräfte, der negativen Glaubens- und Bekenntnisfreiheit der Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern, des Elterngrundrechts und des staatlichen Erziehungsauftrags – erfordert eine einschränkende Auslegung der Verbotsnorm, nach der zumindest eine hinreichend konkrete Gefahr für die Schutzgüter vorliegen muss. Ein verfassungsrechtlich anzuerkennendes Bedürfnis, religiöse Bekundungen durch das äußere Erscheinungsbild nicht erst im konkreten Einzelfall, sondern etwa für bestimmte Schulen oder Schulbezirke über eine gewisse Zeit auch allgemeiner zu unterbinden, setzt voraus, dass dort aufgrund substantieller Konfliktlagen über das richtige religiöse Verhalten bereichsspezifisch die Schwelle zu einer hinreichend konkreten Gefährdung oder Störung des Schulfriedens oder der staatlichen Neutralität in einer beachtlichen Zahl von Fällen erreicht wird (BVerfG 27.01.2015 – 1 BvR 471/10 und 1 BvR 1181/10 - Rz. 114).
2.2.4.2 An diese vorgenannten Grundsätze ist die erkennende Kammer nach § 31 Abs. 1 BVerfGG gebunden.
2.2.4.2.1 Nach § 31 BVerfGG binden die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts die Verfassungsorgane des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und Behörden. Die Bindungswirkung soll eine verbindliche einheitliche Auslegung des Grundgesetzes sicherstellen. Daher beansprucht sie über den entschiedenen Fall hinaus Geltung in allen künftigen Fällen. Sie umfasst den Tenor der Entscheidung, d.h. die nach § 95 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG zu treffende Feststellung, welche Vorschrift des Grundgesetzes durch welche Handlung oder Unterlassung verletzt wurde. Darüber hinaus erstreckt sich die Bindungswirkung auf die den Feststellungsausspruch tragenden Gründe, soweit diese Auslegung und Anwendung des Grundgesetzes betreffen. Rechtsätze dieses Inhalts geben Maßstäbe und Grenzen für die Auslegung und Anwendung des einfachen Rechts vor (BVerfG, Beschluss vom 16. März 2005 – 2 BvL 7/00 – Rz. 60, BVerfGE 112, 268-284; BVerwG 21.09.2016 – 6 C 2/15 - NVwZ 2017, 65-69).
2.2.4.2.2 Um solche tragenden Gründe handelt es sich bei den in den Leitsätzen niedergelegten Feststellungen des Bundesverfassungsgerichts über die Unverhältnismäßigkeit des generellen landesweiten gesetzlichen Verbots religiöser Bekundungen im Unterricht an allgemein bildenden Schulen im Lande Nordrhein-Westfalen. Diese Grundsätze müssen mithin auch bei der Prüfung der Verfassungsmäßigkeit des Berliner Neutralitätsgesetzes berücksichtigt werden. Danach steht fest, dass eine nur abstrakte Gefahr für ein generelles Verbot in einer landesrechtlichen Regelung nicht verfassungskonform wäre.
2.2.4.3 Diesen verfassungsrechtlichen Anforderungen wird § 2 NeutrG nicht gerecht. Denn dort wird ein generelles und pauschales Verbot des Tragens religiöser Zeichen im Schulbetrieb angeordnet.
§ 2 NeutrG ist ist jedoch verfassungskonform dahin auszulegen, dass das dort genannte Verbot des Tragens religiöser Zeichen im Schulbetrieb eine konkrete Gefahr im Sinne der Entscheidung des BVerfG voraussetzt.
2.2.4.3.1 Es ist im Grundsatz davon auszugehen, dass nach der Rechtsprechung des BVerfG (vgl. z.B. BVerfG vom 18.10.2016 – 1 BvR 354/11 - NZA 2016, 1522-1527) eine einschränkende Auslegung von grundrechtsbeschränkenden Vorschriften – im konkreten Fall dort das Kopftuchverbot im Kita-Gesetz des Landes Baden-Württemberg - möglich und von Verfassungs wegen geboten ist. Sie dient der Vermeidung einer Normverwerfung und ist damit dem Gesichtspunkt der größtmöglichen Schonung der Gesetzgebung geschuldet. Sie nimmt Rücksicht darauf, dass die Norm auch andere Anwendungsbereiche hat, die sich von der hier vorliegenden Fallgestaltung unterscheiden. Dabei kann es sich etwa um gewichtige verbale Äußerungen und ein offen werbendes Verhalten handeln. Hier kann die Untersagungsvorschrift unter Umständen auch in einer Interpretation, die schon die abstrakte Gefahr erfasst, ihre Bedeutung haben. Der einschränkenden Auslegung steht nicht entgegen, dass dem Gesetzgeber entstehungsgeschichtlich ein Kopftuchverbot als typischer Anwendungsfall der Vorschrift vorgeschwebt hat. Der Norm wird lediglich ein weniger weit reichender Anwendungsbereich zuerkannt (BVerfG vom 18.10.2016 – 1 BvR 354/11- Rz. 71).
Die verfassungskonforme Auslegung von Rechtsnormen gebietet, die Wertentscheidungen der Verfassung zu beachten und die Grundrechte der Beteiligten möglichst weitgehend in praktischer Konkordanz zur Geltung zu bringen. Ist eine Norm verfassungskonform auslegbar, ist für die Annahme ihrer Unwirksamkeit kein Raum mehr (BAG vom 19.9.2012 – 5 AZR 627/11 - BAGE 143, 119-128).
2.2.4.3.2 Eine entsprechende verfassungskonforme Auslegung ist bezüglich § 2 NeutrG möglich und geboten. In Anwendung der Grundsätze des BVerfG ist die Verbotsregelung in § 2 NeutrG dahin einzuschränken, dass von den dort genannten religiösen Bekundungen eine hinreichend konkrete Gefahr für die dort genannten Schutzgüter ausgehen muss und dass das Vorliegen der konkreten Gefahr zu belegen und zu begründen ist. Mit einem solchen Inhalt wird der Norm (lediglich) ein weniger weit reichender Anwendungsbereich zugeschrieben, als es der Berliner Gesetzgeber vorgesehen hat. Diese Einschränkung steht im Übrigen durchaus in einem inneren Zusammenhang mit den in § 3 Satz 2 Neutralitätsgesetz vorgesehenen Ausnahmemöglichkeiten (vgl hierzu bereits LAG Berlin-Brandenburg vom 9.2.2017 – 14 Sa 1038/16 mit Hinweis auf die Gesetzesbegründung). Daraus erhellt, dass der Berliner Gesetzgeber das Verbot gerade nicht um seiner selbst willen, sondern zur Gefahrenabwehr ausgesprochen hat; diese Gefahren wiederum können spezifisch, z.B. nach Schultyp, bestimmt werden. Die hier vorgenommene Auslegung ist insoweit nur ein (weiterer) Baustein für die Bestimmung der Gefahr.
2.2.4.4 Das beklagte Land hat das Vorliegen einer solchen konkreten Gefahr im Bezugspunkt der Klägerin und des in Frage kommenden Einsatzes nicht hinreichend dargelegt.
2.2.4.4.1 Dabei ist im Grundsatz davon auszugehen, dass unter einer konkreten Gefahr eine Situation verstanden werden kann, in der aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls bei vernünftiger Abwägung mit einem nahen Konflikt mit einem Schadenseintritt gerechnet werden kann. Demgegenüber geht es um abstrakte Gefahren, wenn der Gesetzgeber bezweckt, konkrete Gefahren für die Neutralität der Schule oder den Schulfrieden gar nicht erst eintreten zu lassen. Dies kann darin zum Ausdruck kommen, dass entsprechende Verhaltensweisen bereits dann verboten werden, wenn sie nur "geeignet" sind, die genannten Schutzgüter zu gefährden. Eine Betrachtung der konkreten Verhältnisse an einzelnen Schulen und deren Würdigung ist danach nicht vorgesehen (BVerwG vom 24.6.2004 – 2 C 45.03 – BVerwGE 21,140).
2.2.4.4.2 Das BVerfG räumt dem Gesetzgeber in diesem Zusammenhang die Möglichkeit ein, äußere religiöse Bekundungen nicht erst im konkreten Einzelfall, sondern etwa für bestimmte Schulen oder Schulbezirke für eine gewisse Zeit auch allgemeiner zu unterbinden, wenn dort aufgrund substantieller Konfliktlagen über das richtige religiöse Verhalten bereits die Schwelle zu einer hinreichen konkreten Gefährdung des Schulfriedens oder der staatliche Neutralität in einer beachtlichen Zahl von Fällen erreicht ist (BVerfG Beschluss vom 27.01.2015 -1 BvR 471/10, 1 BvR 1181/10 - Rd. 114).
Eine solche Regelung hat das Land allerdings nicht vorgenommen. Solange der Gesetzgeber dazu aber keine differenziertere Regelung trifft, kann eine Verdrängung der Glaubensfreiheit von Lehrkräften nur dann als angemessener Ausgleich der in Rede stehenden Verfassungsgüter in Betracht kommen, wenn wenigstens eine hinreichend konkrete Gefahr für die staatliche Neutralität oder den Schulfrieden belegbar ist.
2.2.4.4.3 Mithin hätte das beklagte Land das Vorliegen einer konkreten Gefahr für die staatliche Neutralität oder den Schulfrieden darlegen müssen. Das BVerfG (Beschluss vom 27.01.2015 -1 BvR 471/10, 1 BvR 1181/10- Rz. 113) sieht eine solche konkrete Gefahr dann als gegeben, wenn etwa das äußere Erscheinungsbild von Lehrkräften unmittelbar dazu führte , dass - insbesondere von älteren Schülern oder Eltern - über die Frage des richtigen religiösen Verhaltens sehr kontroverse Positionen mit Nachdruck vertreten und in einer Weise in die Schule hineingetragen würden, welche die schulischen Abläufe und die Erfüllung des staatlichen Erziehungsauftrags ernsthaft beeinträchtigte, sofern die Sichtbarkeit religiöser Überzeugungen und Bekleidungspraktiken diesen Konflikt erzeugte oder schürte.
Solche Umstände hat das beklagte Land nicht dargetan. Soweit sich das beklagte Land beispielhaft auf diejenigen Umstände berufen hat, die der Entscheidung des OVG Berlin-Brandenburg vom 27.05.2010 – 3 B 29.09 - zugrunde gelegen haben, ist dem Land zuzugestehen, dass die dortigen Verhältnisse eine konkrete Gefahr in dem genannten Sinne nahelegen würden. Allerdings hat das beklagte Land keine Ausführungen dahingehend gemacht, inwieweit die dort zugrunde gelegten Umstände für die Berliner Schulen verallgemeinert werden könnten bzw. dass die dortigen Verhältnisse auf weitere Schultypen und weitere regionale Zusammenhänge (Bezirke) übertragen werden könnten. Der Hinweis darauf, dass Schulleiter solche Probleme geschildert hätten, reichte als entsprechender Sachvortrag ebenfalls nicht aus, da dies nach Ort (betroffene Schule), Zeit und genauem Inhalt unsubstantiiert geblieben ist. Insofern konnte auch nicht festgestellt werden, inwieweit dies die Schulen in der Region 2 insgesamt betrifft. Dem beklagten Land kann im Übrigen durchaus gefolgt werden, wenn es anführt, dass gerade jüngere Mädchen von einer Vorbildfunktion einer kopftuchtragenden Lehrerin beeindruckt werden können. Indes ist zu berücksichtigen, dass nach der Auffassung des BVerfG das Tragen eines islamischen Kopftuches eine hinreichend konkrete Gefahr im Regelfall nicht begründet. Dass die Klägerin über das Tragen des Kopftuches hinaus, etwa durch verbale Bekundungen o.ä., Gefahrenpotentiale begründen könnte, hat das Land nicht dargetan.
Dem Vortrag des beklagten Landes mangelt es insgesamt an der erforderlichen Einzelfallbezogenheit im Hinblick auf eine konkrete Gefahr. Es wird eben nicht dargetan, dass bezogen auf das Land oder aber auf die Region 2 , für die sich die Klägerin beworben hat, in der Vergangenheit Vorfälle festgestellt worden wären, die die vom BVerfG genannten Kriterien erfüllt hätten. Dies hätten beispielsweise Vorfälle sein können, bei denen die jeweilige Schulleitung zur Wahrung und Sicherung des Schulfriedens in konkreter Weise eingeschritten sind. Der Vortrag des beklagten Landes beschreibt demgegenüber – möglicherweise treffend – die Konfliktpotentiale, die durch kopftuchtragende Lehrerinnen abstrakt auftreten können. Der Vortrag des beklagten Landes legitimiert möglicherweise die Fassung des § 2 NeutrG mit der dort als ausreichend definierten „abstrakten Gefahr“. Er erfüllt jedoch nicht die vom BVerfG geforderten Darlegungen einer konkreten Gefahr, deren Vorliegen belegt werden muss.
2.2.5 Auf die Frage, ob das NeutrG europarechtlichen Vorgaben standhält, kam es – entgegen der Auffassung des Landes nicht an. Auch wenn das „Kopftuchverbot“ nach der Rechtsprechung des EuGH nicht gegen europarechtlich ausgestaltete Diskriminierungsverbote verstößt, kann es einer Rechtfertigung nach § 8 AGG nur insoweit zugrunde gelegt werden, als es selbst verfassungsrechtlichen Vorgaben entspricht.
2.2.6 Gemäß § 15 Abs. 2 AGG war der Klägerin eine angemessene Entschädigung zuzusprechen.
2.2.6.1 Bei der Beurteilung der angemessenen Höhe der festzusetzenden Entschädigung gemäß § 15 Abs. 2 AGG sind alle Umstände des Einzelfalles, wie etwa die Art und Schwere der Benachteiligung, ihre Dauer und Folgen, der Anlass und der Beweggrund des Handelns und der Sanktionszweck der Entschädigungsnorm zu berücksichtigen. Die Entschädigung muss einen tatsächlichen und wirksamen rechtlichen Schutz gewährleisten (BAG 19.05.2016 – 8 AZR 470/14 – NZA 2016, 1395).
2.2.6.2 Bei Anwendung dieser Grundsätze waren anderthalb potentielle Monatsgehälter zugrunde zu legen. Dabei war zum einen zu berücksichtigen, dass die Klägerin wegen ihrer Religion benachteiligt wurde. Andererseits hat das beklagte Land damit einer gesetzlichen Regelung, nämlich § 2 NeutrG gerecht werden wollen. Es ging bei der Ablehnung nicht um den konkreten Einzelfall der Klägerin, sondern um die Umsetzung eines generellen Verbots, hinsichtlich dessen die zu der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts abweichenden Meinungen durchaus verfassungsrechtlich legitime Aspekte gesehen haben. In Anbetracht dessen erschien der Berufungskammer die hier festgesetzte Entschädigung angemessen, aber auch ausreichend.
3. Aus diesen Gründen war auf die Berufung der Klägerin das Urteil des Arbeitsgerichts teilweise abzuändern. Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 ZPO. Die Revision war für das beklagte Land nach § 72 Abs. 2 Nr. 1 zuzulassen.