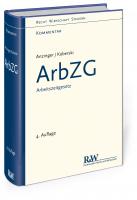LAG Berlin: Darlegungslast bei unterlassenem bEM
LAG Berlin, Urteil vom 18.5.2017 – 5 Sa 1300/16
Volltext: BB-Online BBL2017-1779-6
Leitsätze
1. Bei unterlassener Durchführung eines nach § 84 Abs. 2 Satz 1 SGB IX gebotenen betrieblichen Eingliederungsmanagements vor Ausspruch einer krankheitsbedingten Kündigung hat der Arbeitgeber im Kündigungsschutzprozess umfassend und detailliert vorzutragen, warum weder ein weiterer Einsatz auf dem bisherigen Arbeitsplatz, noch dessen leidensgerechte Anpassung oder Veränderung möglich gewesen seien und der Arbeitnehmer auch nicht auf einem anderen Arbeitsplatz bei geänderter Tätigkeit habe eingesetzt werden können, warum also ein bEM in keinem Fall dazu hätte beitragen können, neuerlichen Krankheitszeiten vorzubeugen und das Arbeitsverhältnis zu erhalten.
2.Beschäftigt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer lediglich infolge der gerichtlichen Verurteilung zur Weiterbeschäftigung bis zum rechtskräftigen Abschluss des Kündigungsschutzprozesses, schuldet er bei Wirksamkeit der Kündigung nach bereicherungsrechtlichen Vorschriften nur Wertersatz für geleistete Arbeit, bei Arbeitsunfähigkeit aber keine Entgeltfortzahlung.
§§ 1 KSchG, 84 Abs. 2 SGB IX
Sachverhalt
Die Parteien streiten über die Wirksamkeit einer krankheitsbedingten Kündigung.
Die am ….1958 geborene Klägerin ist bei dem Beklagten, einem Landkreis mit mehr als zehn Arbeitnehmern, seit dem 01.05.1985 beschäftigt, zuletzt als Sachbearbeiterin für Wohngeldfragen gemäß Stellenbeschreibung vom 18./23.09.2009 (Bl. 229 ff. d. A.) bei einer monatlichen Wochenarbeitszeit von 37 Stunden und einer Bruttomonatsvergütung von ca. 3.800,00 EUR. Mit Wirkung vom 08.08.2014 wurde der Klägerin auf ihren Antrag ein Grad der Behinderung von 50 zuerkannt.
Die Klägerin fehlte aufgrund mehrfacher krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeiten im Jahr 2011 an 102 Arbeitstagen (Entgeltfortzahlungskosten: 16.614,07 EUR), im Jahr 2012 an 175 Arbeitstagen (Entgeltfortzahlungskosten: 8.768,98 EUR), im Jahr 2013 an 56 Arbeitstagen (Entgeltfortzahlungskosten: 8.552,45 EUR), im Jahr 2014 an 84 Arbeitstagen (Entgeltfortzahlungskosten: 12.316,55 EUR) und im Jahr 2015 an 79 Arbeitstagen (Entgeltfortzahlungskosten: 13.577,40 EUR). Ursachen waren u. a. Migräneerkrankungen, chronisch rezidivierende depressive Störungen, Erkrankungen auf urologischem Fachgebiet, ein rezidivierendes HWS/LWS Syndrom mit wiederkehrenden wirbelsäulenabhängigen Schmerzen und ein Reizdarmsyndrom. Aus einer im Februar 2012 endenden Rehabilitationsmaßnahme wurde die Klägerin als nicht arbeitsfähig entlassen und im Zeitraum vom 18.07. bis 17.08.2012 stufenweise wieder eingegliedert. Es kam zu amtsärztlichen Untersuchungen der Klägerin in den Jahren 2010, 2011, 2013, 2014 und 2015. In dem letzten amtsärztlichen Gutachten vom 17.09.2015 (Bl. 33 ff. d. A.) führte ein Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen, Innere Medizin und Betriebsmedizin-Notfallmedizin aus, eine günstige Fehlzeitenprognose könne nicht erstellt werden. Die Klägerin sei aus medizinischer Sicht begrenzt dienstfähig mit 50 Prozent der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit unter Berücksichtigung von Funktionseinschränkungen bei Publikumsverkehr, Termindruck, häufig wechselnden Arbeitsanforderungen, Teamfähigkeit, Heben/Tragen und Mehrarbeit sowie der Erforderlichkeit von Arbeitsunterbrechungen und Arbeitszeitreduzierungen. Die festgestellten Einschränkungen psychophysischer Leistungsfähigkeit in Verbindung mit einer chronischen Depression stünden der Einarbeitung auf einem anderen Arbeitsplatz entgegen. Gesundheitliche und Berufliche Rehabilitationsmaßnahmen seien nicht erfolgversprechend, andere Therapieformen wie eine intensive Psychotherapie könnten nicht genutzt werden/würden nicht genutzt und seien wegen des bisherigen Verlaufs vermutlich auch nicht zielführend. Personalgespräche führte der Beklagte mit der Klägerin am 04.08.2011, 15.05.2012, 17.09.2012 und 10.06.2014 (s. die Protokolle Bl. 100 – 107, 109 – 110 d. A.), mit Schreiben vom 25.09.2013 (Bl. 108 d. A.) wies er die Klägerin auf eine amtsärztliche Empfehlung hin, eine ambulante psychotherapeutische Behandlung in Anspruch zu nehmen.
Mit Schreiben vom 22.10.2015 (Bl. 41 ff. d. A.) beantragte der Beklagte beim Integrationsamt die Zustimmung zur ordentlichen Kündigung. Auf Vorschlag des Integrationsamtes unterbreitete der Beklagte der Klägerin mit Schreiben vom 19.11.2015 das Angebot zur Reduzierung der Arbeitszeit auf 30 Wochenstunden, alternativ auf Auflösung des Arbeitsverhältnisses (Bl. 44 ff. d. A.). Die Klägerin nahm keines der Angebote an. Mit dem Beklagten am 15.12.2015 zugegangenem Bescheid vom 11.12.2015 (Bl. 50 ff. d. A.) erteilte das Integrationsamt die Zustimmung zur ordentlichen Kündigung. Einem Antrag des Beklagten vom 23.12.2015 auf Zustimmung zur ordentlichen personenbedingten Kündigung (Bl. 54 ff. d. A.) stimmte der Personalrat am 30.12.2015 zu.
Im Anschluss hieran kündigte der Beklagte das Arbeitsverhältnis mit der Klägerin am gleichen Tage zugegangenem Schreiben vom 30.12.2015 zum 30.06.2016 (Bl. 9 ff. d. A.).
Am 16.06.2016 gab der Widerspruchsausschuss des Integrationsamtes einem Widerspruch der Klägerin gegen den Bescheid vom 11.12.2015 statt. Den Widerspruchsbescheid focht der Beklagte vor dem Verwaltungsgericht an.
Ab dem 13.09.2016 beschäftigte der Beklagte die Klägerin im Rahmen eines bis zur Verkündung einer Entscheidung durch das erkennende Gericht befristeten Prozessarbeitsverhältnisses weiter, in dessen Verlauf es zu weiteren Arbeitsunfähigkeiten der Klägerin kam.
Mit der am 20.01.2016 beim Arbeitsgericht als Telefax eingegangenen und dem Beklagten am 26.01.2016 zugestellten Klage hat die Klägerin die Unwirksamkeit der Kündigung vom 30.12.2015 sowie für den Fall des Obsiegens die Weiterbeschäftigung während des Rechtsstreites geltend gemacht. Sie hat vorgetragen, dass der Beklagten einen leidensgerechten Arbeitsplatz nie konkret angeboten habe. Bei den amtsärztlichen Untersuchungen sei sie lediglich gewogen, ihr Blut abgenommen und der Blutdruck geprüft worden. Der Amtsarzt habe ihr gegenüber erklärt, er glaube, dass an der Klägerin ein Exempel statuiert werden solle.
Die Klägerin hat beantragt,
1. festzustellen, dass das Arbeitsverhältnis der Klägerin durch die schriftliche Kündigung der beklagten Partei vom 30.12.2015, zugegangen am 30.12.2015, nicht zum 30.06.2016 aufgelöst worden ist,
2. die Beklagte zu verurteilen, die Klägerin für den Fall des Obsiegens mit dem Feststellungsantrag als Sachbearbeiterin für Wohngeldfragen bei einer Wochenarbeitszeit von 38 Stunden und einem monatlichen Bruttogehalt in Höhe von 3.800,00 EUR bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung über den Feststellungsantrag weiter zu beschäftigen.
Der Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.
Der Beklagte hat vorgetragen, dass die anderen Beschäftigten des Wohngeldbereiches aufgrund der Ausfälle der Klägerin erhebliche Mehrleistungen hätten erbringen müssen. Die Versetzung auf einen anderen Arbeitsplatz sei in der Vergangenheit am Widerstand der Klägerin gescheitert und nach dem letzten amtsärztlichen Gutachten nun nicht mehr möglich. Die Landkreisverwaltung verfüge über ein Gesundheitsmanagement, das ein betriebliches Wiedereingliederungsmanagement führe, aufgrund einer Verweigerungshaltung der Klägerin sei dies nicht realisierbar gewesen. Der Weiterbeschäftigungsanspruch bestehe nicht, weil dieser voraussetze, dass die gekündigte Person in der Lage sei, bis zum Abschluss des Kündigungsschutzprozesses eine tatsächliche Arbeitsleistung zu erbringen.
Das Arbeitsgericht hat der Kündigungsschutzklage mit Urteil vom 07.07.2106 stattgegeben, nicht jedoch dem auf Weiterbeschäftigung bis zur rechtskräftigen Entscheidung gerichteten Klageantrag. Zur Begründung hat es ausgeführt, die wegen häufiger Kurzerkrankungen ausgesprochene Kündigung sei unverhältnismäßig, weil das der Klägerin vor Ausspruch der Kündigung unterbreitete Änderungsangebot (30-Stundenwoche) nicht zum Gegenstand einer Änderungskündigung gemacht worden sei. Allerdings habe die Klägerin trotz des Obsiegens mit der Kündigungsschutzklage keinen Anspruch auf Weiterbeschäftigung im beantragten Umfang, da nach den Feststellungen des vertrauensärztlichen Gutachtens in diesem Umfang keine Dienstfähigkeit der Klägerin gegeben sei.
Gegen das dem Beklagten am 25.07.2016 und der Klägerin am 02.08.2016 zugestellte Urteil richten sich die am 05.08.2016 eingegangenen und von dem Beklagten nach Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist bis zum 25.10.2016 am 25.10.2016 sowie von der Klägerin am 08.09.2016 begründeten Berufungen beider Parteien. Der Beklagte trägt vor, das Arbeitsgericht habe bei seiner Annahme, dass die Klägerin noch leistungsfähig sei, die Tatsachengrundlage fehlerhaft erfasst. Die im letzten amtsärztlichen Gutachten festgestellten Funktionseinschränkungen führten dazu, dass eine Wiederherstellung der vollen Leistungsfähigkeit der Klägerin nicht wahrscheinlich sei. Der gutachterliche Hinweis darauf, dass andere Therapieformen wie eine intensive Psychotherapie nicht zielführend seien, belege, dass auch eine Weiterbeschäftigung mit 50 % der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit nicht möglich sei. Die Feststellungen des Gutachtens widersprächen einer begrenzten Dienstfähigkeit von 50 %. Aufgrund der Auswirkungen auf die Ausübung der Tätigkeit könne aus dem Hinweis einer begrenzten Dienstfähigkeit nicht geschlossen werden, dass die Klägerin die Aufgaben gemäß Stellenbeschreibung erfüllen könne. Dies ergebe sich auch aus einer Stellungnahme des Amtsarztes vom 16.06.2016 (Bl. 284 d. A.). Hätte der Beklagte ein Angebot auf entsprechende Absenkung der Arbeitszeit gemacht, hätte sich der Gesamtgesundheitszustand der Klägerin durch Überlastung auf Dauer weiter verschlechtert. Hingegen sei die Weiterbeschäftigungsklage zu Recht zurückgewiesen worden, weil der Beklagte ein überwiegendes Interesse daran habe, die Klägerin nicht zu beschäftigen.
Der Beklagte beantragt,
das Urteil des Arbeitsgerichts Brandenburg an der Havel vom 07.07.2016 – 4 Ca 50/16 – abzuändern und die Klage insgesamt abzuweisen und die Berufung der Klägerin zurückzuweisen.
Die Klägerin beantragt,
unter teilweiser Abänderung der angefochtenen Entscheidung des Arbeitsgerichts Brandenburg vom 07. Juli 2016 wird der beklagte Landkreis verurteilt, die Klägerin als Sachbearbeiterin für Wohngeldfragen bei einer Wochenarbeitszeit von 37 Stunden bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung über den Feststellungsantrag weiter zu beschäftigen und die Berufung des beklagten Landkreises gegen die angefochtene Entscheidung des Arbeitsgerichts Brandenburg an der Havel kostenpflichtig zurückzuweisen.
Die Klägerin trägt vor, die Berufung des Beklagten sei unzulässig, weil diese sich nicht mit der Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes durch das Arbeitsgericht auseinandersetze. Jedenfalls sei die Berufung unbegründet, denn das Arbeitsgericht habe das amtsärztliche Gutachten nicht falsch und zutreffend als Parteivortrag bewertet. Die dem Gutachten widersprechenden Annahmen des Beklagten seien dem angetragenen Sachverständigenbeweis nicht zugänglich. Dass Rehabilitationsmaßnahmen zur Verbesserung oder Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit der Klägerin nicht erfolgversprechend seien, begründe der Beklagte lediglich mit dem Ergebnis einer drei Jahre zurückliegenden Reha-Behandlung. Dass bei der Klägerin Depressionen festgestellt worden seien liege daran, dass der Beklagte ständig erheblichen Druck auf sie ausübe, einen Rentenantrag zu stellen. Die Klägerin sei zur Erbringung ihrer Arbeitsleistung in der Lage, weshalb das Arbeitsgericht die Weiterbeschäftigungsklage nicht habe abweisen und ihr jedenfalls zumindest teilweise habe stattgeben müssen.
Wegen des Vortrages der Parteien in der zweiten Instanz wird im Übrigen auf die Schriftsätze und Anlagen des Beklagten vom 24.10.2016 (Bl. 192 – 237 d. A.), vom 16.11.2016 (Bl. 265 – 275 d. A.), vom 19.12.2016 (Bl. 280 – 284 d. A.), die auf einen Hinweis des Kammervorsitzenden vom 27.01.2017 (Bl. 294 d. A.) folgenden Schriftsätze und Anlagen des Beklagten vom 01.03.2017 (Bl. 300 – 303 d. A.) und vom 07.04.2017 (Bl. 322 – 324 d. A.), die Schriftsätze der Klägerin vom 06.09.2016 (Bl. 179 – 185 d. A.), vom 04.11.2016 (Bl. 249 – 254 d. A.) und vom 23.11.2016 (Bl. 276 – 279 d. A.) sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 18.05.2017 (Bl. 325 – 326 d. A.) verwiesen.
Aus den Gründen
I.
Die Berufung des Beklagten ist zulässig, aber unbegründet und daher zurückzuweisen.
1.
Die Berufung des Beklagten ist gemäß §§ 8 Abs. 2, 64 Abs. 2 lit. c und Abs. 6, 66 Abs. 1 ArbGG, 519 ZPO statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt und gem. §§ 64 Abs. 6 ArbGG, 520 Abs. 3 ZPO ausreichend begründet worden. Soweit die Klägerin rügt, die Berufung des Beklagten setze sich nicht ausreichend mit dem vom Arbeitsgericht angewendeten Verhältnismäßigkeitsgrundsatz auseinander, trifft dies nicht zu. Der Beklagte trägt vor, er habe mit einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes der Klägerin zu rechnen gehabt, wenn er im Wege der Änderungskündigung eine Reduzierung der Arbeitszeit auf wöchentlich 30 Stunden oder auf 50 % angeboten hätte. Mit diesem Vortrag setzt er sich mit der Begründung des Arbeitsgerichts auseinander, ihm sei das mildere Mittel einer Änderungskündigung möglich gewesen. Auf die Schlüssigkeit dieses Vortrages kommt es nicht an.
2.
Die Berufung ist jedoch unbegründet. Das Arbeitsgericht hat zu Recht angenommen, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien durch die angegriffene Kündigung nicht aufgelöst worden ist.
a)
Die Klagefrist der §§ 4, 7 KSchG hat die Klägerin eingehalten. Der Zugang der angegriffenen Kündigung erfolgte am 30.12.2015, der Eingang der Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht in Telekopie am 20.01.2016. Die Klageschrift wurde dem Beklagten dann gem. § 167 ZPO demnächst, nämlich am 26.01.2016, zugestellt.
b)
Die ordentliche Kündigung vom 30.12.2015 ist gem. § 1 Abs. 1 des auf das Arbeitsverhältnis der Parteien anzuwendenden ersten Abschnitts des KSchG (§§ 1 Abs. 1, 23 Abs. 1 und 2 KSchG) sozial ungerechtfertigt und daher unwirksam. Sie ist nicht gem. § 1 Abs. 2 S. 1 KSchG durch in der Person der Klägerin liegende Gründe bedingt.
aa)
Ein zur ordentlichen Kündigung berechtigender, in der Person des Arbeitnehmers liegender Grund kann im Falle häufiger (Kurz-) Erkrankungen des Arbeitnehmers gegeben sein. In diesem Falle ist zunächst - erste Stufe - eine negative Gesundheitsprognose erforderlich. Es müssen, und zwar bezogen auf den Kündigungszeitpunkt, objektive Tatsachen vorliegen, die die Besorgnis weiterer Erkrankungen im bisherigen Umfang befürchten lassen. Häufige Kurzerkrankungen in der Vergangenheit können indiziell für eine entsprechende künftige Entwicklung des Krankheitsbildes sprechen. Dies gilt allerdings nicht, wenn die Krankheiten ausgeheilt sind. Die prognostizierten Fehlzeiten sind nur dann geeignet, eine krankheitsbedingte Kündigung sozial zu rechtfertigen, wenn sie auch zu einer erheblichen Beeinträchtigung der betrieblichen Interessen führen, was als Teil des Kündigungsgrundes - zweite Stufe - festzustellen ist. Dabei können neben Betriebsablaufstörungen auch wirtschaftliche Belastungen, etwa durch zu erwartende, einen Zeitraum von mehr als sechs Wochen pro Jahr übersteigende Entgeltfortzahlungskosten, zu einer derartigen Beeinträchtigung betrieblicher Interessen führen. Liegt eine solche erhebliche Beeinträchtigung der betrieblichen Interessen vor, so ist in einem dritten Prüfungsschritt im Rahmen der nach § 1 Abs. 2 S. 1 KSchG gebotenen Interessenabwägung zu prüfen, ob diese Beeinträchtigungen vom Arbeitgeber billigerweise nicht mehr hingenommen werden müssen. Dabei ist u. a. zu berücksichtigen, ob die Erkrankungen auf betriebliche Ursachen zurückzuführen sind und ob und wie lange das Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien zunächst ungestört verlaufen ist. Ferner sind das Alter, der Familienstand und die Unterhaltspflichten sowie ggf. eine Schwerbehinderung des Arbeitnehmers in die Abwägung einzubeziehen (BAG v. 20.11.2014 – 2 AZR 755/13, Rz. 16; BAG v. 08.11.2007 – 2 AZR 292/06, Rz. 16). Die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses ist daneben auch aus Anlass einer Langzeiterkrankung dann sozial gerechtfertigt, wenn eine negative Prognose hinsichtlich der voraussichtlichen Dauer der Arbeitsunfähigkeit vorliegt - erste Stufe -, eine darauf beruhende erhebliche Beeinträchtigung betrieblicher Interessen festzustellen ist - zweite Stufe - und eine Interessenabwägung ergibt, dass die betrieblichen Beeinträchtigungen zu einer billigerweise nicht mehr hinzunehmenden Belastung des Arbeitgebers führen - dritte Stufe. Bei krankheitsbedingter dauernder Leistungsunfähigkeit ist in aller Regel ohne weiteres von einer erheblichen Beeinträchtigung der betrieblichen Interessen auszugehen. Die Ungewissheit der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit steht einer krankheitsbedingten dauernden Leistungsunfähigkeit dann gleich, wenn in den nächsten 24 Monaten mit einer anderen Prognose nicht gerechnet werden kann (BAG v. 29.04.1999 - 2 AZR 431/98).
bb)
Vorliegend ergibt sich aus dem unstreitigen Sachverhalt, dass die Klägerin in den Jahren 2011 bis 2015 jeweils zwischen knapp 12 Wochen (2013) und gut 20 Wochen (2011) arbeitsunfähig erkrankt war, und zwar im Wesentlichen über verschiedene kürzere Zeiträume hinweg. Es kann aufgrund der vorgetragenen und im amtsärztlichen Gutachten vom 17.09.2015 aufgeführten, nicht ausgeheilten Erkrankungen (Migräne, chronisch rezidivierende depressive Störung, Erkrankungen auf urologischem Fachgebiet, rezidivierendes HWS/LWS Syndrom mit wiederkehrenden wirbelsäulenabhängigen Schmerzen, Reizdarmsyndrom) auch davon ausgegangen werden, dass bei unveränderten Arbeitsbedingungen auch unverändert hohe Fehlzeiten erwartet werden können. Zugunsten des Beklagten kann ferner unterstellt werden, dass – wie sich aus dem amtsärztlichen Gutachten vom 17.09.2015 ergibt, auf Dauer keine Aussicht besteht, die volle arbeitsvertragliche Leistung zu erbringen. Bereits die Belastung mit Lohnfortzahlungskosten in Höhe von mehr als sechs Wochen jährlich, erst Recht aber die dauernde Unmöglichkeit, die vertraglich geschuldete Leistung zu erbringen stellen auch erhebliche betriebliche Beeinträchtigungen dar.
Die Kündigung ist gleichwohl unverhältnismäßig. Im Ergebnis zu Recht hat das Arbeitsgericht angenommen, dass der Beklagte mildere Mittel als die Beendigungskündigung zur Verfügung hatte, um der eingetretenen Vertragsstörung zu begegnen
aaa)
Eine aus Gründen in der Person des Arbeitnehmers ausgesprochene Kündigung ist unverhältnismäßig und damit rechtsunwirksam, wenn sie zur Beseitigung der eingetretenen Vertragsstörung nicht geeignet oder nicht erforderlich ist. Eine Kündigung ist durch Krankheit nicht „bedingt“, wenn es angemessene mildere Mittel zur Vermeidung oder Verringerung künftiger Fehlzeiten gibt. Mildere Mittel können insbesondere die Umgestaltung des bisherigen Arbeitsbereichs oder die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers auf einem anderen - leidensgerechten - Arbeitsplatz sein. Darüber hinaus kann sich aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit die Verpflichtung des Arbeitgebers ergeben, dem Arbeitnehmer vor einer Kündigung die Chance zu bieten, ggf. spezifische Behandlungsmaßnahmen zu ergreifen, um dadurch die Wahrscheinlichkeit künftiger Fehlzeiten auszuschließen. Der Arbeitgeber, der für die Verhältnismäßigkeit der Kündigung nach § 1 Abs. 2 Satz 4 KSchG die Darlegungs- und Beweislast trägt, kann sich - besteht keine Verpflichtung zur Durchführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) - zunächst darauf beschränken zu behaupten, für den Arbeitnehmer bestehe keine alternative Beschäftigungsmöglichkeit. Diese pauschale Erklärung umfasst den Vortrag, Möglichkeiten zur leidensgerechten Anpassung des Arbeitsplatzes seien nicht gegeben. Der Arbeitnehmer muss hierauf erwidern, insbesondere darlegen, wie er sich eine Änderung des bisherigen Arbeitsplatzes oder eine anderweitige Beschäftigung vorstellt, die er trotz seiner gesundheitlichen Beeinträchtigung ausüben könne. Dann ist es Sache des Arbeitgebers, hierauf seinerseits zu erwidern und ggf. darzulegen, warum eine solche Beschäftigung nicht möglich sei. Entsprechend abgestuft ist die Darlegungslast des Arbeitgebers, wenn sich der Arbeitnehmer darauf beruft, die Kündigung sei deshalb unverhältnismäßig, weil eine dem Arbeitgeber bekannte, ihm gleichwohl nicht geboten erscheinende Therapiemöglichkeit bestanden habe. Wurde aber entgegen § 84 Abs. 2 SGB IX ein BEM nicht durchgeführt, darf sich der Arbeitgeber nicht darauf beschränken, pauschal vorzutragen, er kenne keine alternativen Einsatzmöglichkeiten für den erkrankten Arbeitnehmer und es gebe keine leidensgerechten Arbeitsplätze, die dieser trotz seiner Erkrankung ausfüllen könne. Er hat vielmehr von sich aus denkbare oder vom Arbeitnehmer (außergerichtlich) bereits genannte Alternativen zu würdigen und im Einzelnen darzulegen, aus welchen Gründen sowohl eine Anpassung des bisherigen Arbeitsplatzes an dem Arbeitnehmer zuträgliche Arbeitsbedingungen als auch die Beschäftigung auf einem anderen - leidensgerechten - Arbeitsplatz ausscheiden. Erst nach einem solchen Vortrag ist es Sache des Arbeitnehmers, sich hierauf substantiiert einzulassen und darzulegen, wie er sich selbst eine leidensgerechte Beschäftigung vorstellt. Die Durchführung des bEM ist zwar keine formelle Wirksamkeitsvoraussetzung für eine Kündigung. § 84 Abs. 2 SGB IX ist dennoch kein bloßer Programmsatz. Die Norm konkretisiert den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Mit Hilfe des bEM können möglicherweise mildere Mittel als die Kündigung erkannt und entwickelt werden. Möglich ist, dass auch ein tatsächlich durchgeführtes bEM kein positives Ergebnis hätte erbringen können. In einem solchen Fall darf dem Arbeitgeber kein Nachteil daraus entstehen, dass er es unterlassen hat. Will sich der Arbeitgeber hierauf berufen, hat er die objektive Nutzlosigkeit des BEM darzulegen und ggf. zu beweisen. Dazu muss er umfassend und detailliert vortragen, warum weder ein weiterer Einsatz auf dem bisherigen Arbeitsplatz, noch dessen leidensgerechte Anpassung oder Veränderung möglich gewesen seien und der Arbeitnehmer auch nicht auf einem anderen Arbeitsplatz bei geänderter Tätigkeit habe eingesetzt werden können, warum also ein bEM im keinem Fall dazu hätte beitragen können, neuerlichen Krankheitszeiten vorzubeugen und das Arbeitsverhältnis zu erhalten. Ist es dagegen denkbar, dass ein bEM ein positives Ergebnis erbracht, das gemeinsame Suchen nach Maßnahmen zum Abbau der Fehlzeiten also Erfolg gehabt hätte, muss sich der Arbeitgeber regelmäßig vorhalten lassen, er habe „vorschnell“ gekündigt (BAG v. 20.11.2014 – 2 AZR 755/13, Rz. 38 ff.).
bbb)
Es ist Sache des Arbeitgebers, die Initiative zur Durchführung eines gesetzlich gebotenen betrieblichen Eingliederungsmanagements zu ergreifen. Davon kann nur ausgegangen werden, wenn er den Arbeitnehmer zuvor nach § 84 Abs. 2 S. 3 SGB IX auf die Ziele des bEM sowie Art und Umfang der dabei erhobenen Daten hingewiesen hat. Der Hinweis erfordert eine Darstellung der Ziele, die inhaltlich über eine bloße Bezugnahme auf die Vorschrift des § 84 Abs. 2 Satz 1 SGB IX hinausgeht. Zu diesen Zielen rechnet die Klärung, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden, erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und wie das Arbeitsverhältnis erhalten werden kann. Dem Arbeitnehmer muss verdeutlicht werden, dass es um die Grundlagen seiner Weiterbeschäftigung geht und dazu ein ergebnisoffenes Verfahren durchgeführt werden soll, in das auch er Vorschläge einbringen kann. Daneben ist ein Hinweis zur Datenerhebung und Datenverwendung erforderlich, der klarstellt, dass nur solche Daten erhoben werden, deren Kenntnis erforderlich ist, um ein zielführendes, der Gesundung und Gesunderhaltung des Betroffenen dienendes bEM durchführen zu können. Dem Arbeitnehmer muss mitgeteilt werden, welche Krankheitsdaten - als sensible Daten i. S. v. § 3 Abs. 9 BDSG - erhoben und gespeichert und inwieweit und für welche Zwecke sie dem Arbeitgeber zugänglich gemacht werden. Nur bei entsprechender Unterrichtung kann vom Versuch der ordnungsgemäßen Durchführung eines bEM die Rede sein (BAG v. 20.11.2014 – 2 AZR 755/13, Rz. 32).
ccc)
Vorliegend war die Durchführung eines bEM vor Ausspruch der Kündigung vom 30.12.2015 geboten, weil die Klägerin in allen Jahren vor der Kündigung vom 30.12.2015 länger als sechs Wochen arbeitsunfähig war (§ 84 Abs. 2 S. 1 SGB IX). Ein bEM ist nicht nur bei lang andauernden Krankheiten geboten. Es ist auch bei häufigen Kurzerkrankungen des Arbeitnehmers nicht ausgeschlossen oder von vorneherein überflüssig. Nach der gesetzlichen Regelung des § 84 Abs. 2 SGB IX kommt es allein auf den Umfang, nicht auf die Ursache der Erkrankungen an. Auch aus Krankheiten, die auf unterschiedlichen Grundleiden beruhen, kann sich - zumal wenn sie auf eine generelle Krankheitsanfälligkeit des Arbeitnehmers hindeuten - eine Gefährdung des Arbeitsverhältnisses ergeben, der das bEM entgegenwirken soll (BAG v. 20.11.2014 – 2 AZR 755/13, Rz. 42).
ddd)
Zur Durchführung eines bEM hat der Beklagte erstinstanzlich vorgetragen, die Landkreisverwaltung verfüge über eine betriebliche Gesundheitsmanagerin, die in derartigen Krankheitsfällen ein betriebliches Wiedereingliederungsmanagement durchführe, jedoch sei dieses aufgrund der Verweigerungshaltung der Klägerin nicht realisierbar gewesen. Die Hinzuziehung der Sachbearbeiterin für Gesundheitsmanagement habe allerdings eine Änderung der gesundheitlichen Situation der Klägerin nicht ändern oder die Möglichkeit eines anderen Einsatzes bewirken können. Mit der Berufungsbegründung hat der Beklagte vorgetragen, die Klägerin habe das seit 2014 das mitgeteilte Verlangen des Beklagten, ein Verfahren der betrieblichen Wiedereingliederung durchzuführen, mehrfach abgelehnt. Auf Hinweis des Gerichts hat der Beklagte diesen Vortrag dahingehend konkretisiert, dass er die Klägerin mit Schreiben vom 26.09.2016 zu einem persönlichen Informationsgespräch im Sinne des betrieblichen Eingliederungsmanagements eingeladen habe, dass das bEM am 12.10.2016 begonnen habe und auf Wunsch der Klägerin am 28.03.2017 abgebrochen worden sei. Im Übrigen hatte der Beklagte bereits erstinstanzlich auf mehrere Personalgespräche im Zeitraum vom 04.08.2011 bis 10.06.2014 und ein Schreiben an die Klägerin vom 25.09.2013 verwiesen. Ausweislich der vorgelegten Protokolle ist die Klägerin jedoch in keinem der Personalgespräche bzw. im Schreiben vom 25.09.2013 auf die Ziele eines beabsichtigten bEM sowie auf Art und Umfang der hierfür erhobenen und verwendeten Daten hingewiesen worden. Der Beklagte trägt auch nicht vor, dass mit diesen Gesprächen ein BEM im Sinne des § 84 Abs. 2 Satz 1 SGB IX habe durchgeführt werden sollen, vielfach betrafen die Personalgespräche zudem von dem Beklagten vorgeworfene Pflichtverletzungen. Das nach Vortrag des Beklagten am 12.10.2016 begonnene bEM liegt hingegen zeitlich nach Ausspruch der Kündigung und kann keine Berücksichtigung finden.
eee)
Der nach den genannten Grundsätzen mangels eines vor Ausspruch der Kündigung durchgeführten bEM somit entsprechend darlegungspflichtige Beklagte hat nicht schlüssig vorgetragen, dass weder ein weiterer Einsatz der Klägerin auf dem bisherigen Arbeitsplatz, noch dessen leidensgerechte Anpassung oder Veränderung möglich gewesen seien und die Klägerin auch nicht auf einem anderen Arbeitsplatz bei geänderter Tätigkeit habe eingesetzt werden können, dass also ein bEM im keinem Fall dazu hätte beitragen können, neuerlichen Krankheitszeiten vorzubeugen und das Arbeitsverhältnis zu erhalten. Selbst wenn man in diesem Zusammenhang zugunsten des Beklagten unterstellt, er habe unter Bezugnahme auf entsprechende Angaben im amtsärztlichen Gutachten vom 17.09.2015 dargelegt, dass eine Versetzung auf einen anderen Arbeitsplatz unabhängig von dessen Beschaffenheit aufgrund der psychophysischen Leistungsfähigkeit der Klägerin ausscheidet, ein bEM insoweit also nicht zu anderen Ergebnissen geführt hätte, hat er gleichwohl nicht hinreichend dargelegt, dass weder ein weiterer Einsatz der Klägerin auf dem bisherigen Arbeitsplatz noch dessen leidensgerechte Anpassung oder Veränderung möglich gewesen seien, warum also ein bEM in keinem Fall dazu hätte beitragen können, neuerlichen Krankheitszeiten vorzubeugen und das Arbeitsverhältnis zu erhalten. So ergibt sich bereits aus dem amtsärztlichen Gutachten vom 17.09.2015, dass eine weitere Leistungsfähigkeit zu 50 Prozent der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit gegeben ist, ggf. unter weiterer Berücksichtigung der unter IV. 3. des Gutachtens aufgeführten Funktionseinschränkungen. Der Beklagte trägt nicht vor, dass eine derartige Änderung der Arbeitsbedingungen aus betrieblichen Gründen ausgeschlossen war. Aus der vorgelegten Stellenbeschreibung lässt sich nicht herleiten, dass jede hier in Betracht kommende Anpassung der Arbeitsbedingungen an die Leiden der Klägerin ausscheidet und die Antragsbearbeitung und Antragsprüfung der Leistungen nach WoGG (Arbeitsvorgang Nr. 1), die Entscheidung über Aufhebung, Rücknahme , Rückforderung und Stundung, Mahnung und Überwachung der Rückzahlung, Fertigen von Verfügungsentwürfen bei Niederschlagung und Erlass (Arbeitsvorgang Nr. 2), die Zuarbeit zum Widerspruchsverfahren und das Fertigen von Entscheidungsvorschlägen (Arbeitsvorgang Nr. 3), die Durchsetzung von Bußgeldverfahren und die Vollstreckungsüberwachung (Arbeitsvorgang Nr. 4) sowie die Statistik – Datentechnische Überwachung unter Berücksichtigung der im Gutachten vom 17.09.2015 genannten Funktionseinschränkungen nicht ausgeführt werden können. Soweit der Beklagte behauptet, aus dem Gutachten ergebe sich entgegen seiner Aussage, dass die Klägerin nicht einmal mehr in der Lage sei, 3 Stunden täglich zu arbeiten, ist diese Behauptung unschlüssig und lässt sich aus keiner der amtsärztlichen Feststellungen herleiten. Diese beziehen sich jeweils auf die volle tätigkeitsbezogene Leistungsfähigkeit. Allein aus dem Umstand, dass die Klägerin an einer Vielzahl von Erkrankungen leidet, die teilweise auch psychischer Natur sind, kann nicht ohne Weiteres der Schluss gezogen werden, entgegen der ausdrücklichen amtsärztlichen Aussage sei auch eine halbschichtige Leistungsfähigkeit nicht vorhanden. Soweit der Beklagte auf eine ergänzende Stellungnahme des Amtsarztes vom 16.06.2016 verweist, lässt sich auch daraus nichts für die halbschichtige Weiterbeschäftigung herleiten. In dieser Stellungnahme erklärt der Amtsarzt nicht, er habe im Gutachten vom 17.09.2015 fehlerhaft eine 50-prozentige Leistungsfähigkeit bestätigt. Auch soweit der Beklagte auf während der Kündigungsfrist und der Prozessbeschäftigung aufgetretene weitere Fehlzeiten verweist, sind diese bei vollschichtigem Einsatz entstanden und sagen nichts zur Fehlzeitenprognose bei einer Beschäftigung mit 50 % der regelmäßigen Arbeitszeit aus. Im Übrigen hätte ein bEM möglicherweise auch dann zur Weiterbeschäftigung der Klägerin bei verringerter Arbeitszeit führen können, wenn diese – wie der Beklagte behauptet - nur noch für weniger als 3 Stunden täglich leistungsfähig wäre. Unabhängig davon, ob dann die Voraussetzungen des § 33 Abs. 4 TV-L anzunehmen wären, kann nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass eine Weiterbeschäftigung mit weniger als drei Stunden täglich erfolgen und damit die Beendigungskündigung entbehrlich machen konnte.
Ferner nicht dargelegt, dass Therapie- und Rehabilitationsmaßnahmen nicht sogar zu einer Aufrechterhaltung der vollschichtigen Leistungsfähigkeit hätte führen können. Denkbares Ergebnis eines bEM kann es auch sein, den Arbeitnehmer auf eine Maßnahme der Rehabilitation zu verweisen. Dem steht nicht entgegen, dass deren Durchführung von seiner Mitwirkung abhängt und nicht in der alleinigen Macht des Arbeitgebers steht. Ggf. muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine angemessene Frist zur Inanspruchnahme der Leistung setzen. Eine Kündigung kann er dann wirksam erst erklären, wenn die Frist trotz Kündigungsandrohung ergebnislos verstrichen ist. Durch die Berücksichtigung entsprechender, aus dem bEM entwickelter Empfehlungen wird der „ultima-ratio-Grundsatz“ nicht über die gesetzlichen Grenzen hinaus ausgedehnt. Die aus ihm resultierende Verpflichtung des Arbeitgebers, ggf. mildere Mittel zu ergreifen, ist nicht auf arbeitsplatzbezogene Maßnahmen i. S. v. § 1 Abs. 2 Satz 2 KSchG beschränkt. Diese Vorschrift dient der Konkretisierung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes lediglich mit Blick auf ihren eigenen Regelungsbereich. Sie schließt die Berücksichtigung sonstiger Umstände, die eine Kündigung entbehrlich machen könnten, nicht aus. Eine Kündigung muss, damit sie durch Gründe i. S. v. § 1 Abs. 2 Satz 1 KSchG „bedingt“ ist, unter allen Gesichtspunkten verhältnismäßig, d. h. unvermeidbar sein. Daraus kann sich die Verpflichtung des Arbeitgebers ergeben, auf bestehende Therapiemöglichkeiten Bedacht zu nehmen. Wenn er ein bEM unterlassen hat, kann er gegen eine solche Verpflichtung nicht einwenden, ihm seien im Kündigungszeitpunkt - etwa schon mangels Kenntnis der Krankheitsursachen - entsprechende Möglichkeiten weder bekannt gewesen, noch hätten sie ihm bekannt sein können (BAG v. 20.11.2014 – 2 AZR 755/13, Rz. 49). Es kann dabei zugunsten des Beklagten auch unterstellt werden, die Erfolglosigkeit einer fast vier Jahre vor Ausspruch der Kündigung durchgeführten Rehabilitationsmaßnahme belege ausreichend, dass eine erneut Rehabilitationsmaßnahme ähnlicher Natur keinen Erfolg haben werde. Es fehlt aber Vortrag des Beklagten dazu, dass andere Therapieformen, wie die vom Amtsarzt im Gutachten angesprochene intensive Psychothrapie ebenfalls ohne das gewünschte Ergebnis verlaufen werde. Die Feststellungen im Gutachten geben das nicht wieder, sondern sagen nur aus, dass diese Therapie nicht genutzt werden könne bzw. nicht genutzt werde und vermutlich auch nicht zielführend sei. Warum eine solche Therapie nicht genutzt werden konnte ist nicht dargelegt. Dass sie nicht zielführend ist beruht nur auf einer Vermutung. Es kann also jedenfalls nicht ausgeschlossen werden, dass in der Folge eines bEM eine entsprechende Therapie die volle Leistungsfähigkeit auf einem ggf. leidensgerecht angepassten Arbeitsplatz wiederhergestellt hätte.
fff)
Zu Recht hat das Arbeitsgericht darauf hingewiesen, dass daraus, dass die Klägerin vor Ausspruch der Kündigung das Angebot des Beklagten nicht annahm, die Arbeitszeit auf 30 Stunden wöchentlich zu reduzieren, nicht folgt, dass er der Klägerin keine Arbeitszeitverringerungen mehr habe anbieten müssen. Bereits nach dem Ergebnis des Gutachtens vom 17.09.2015, jedenfalls aber unter Berücksichtigung möglicher Ergebnisse eines bEM liegt darin nicht das letzte Mittel, das der Beklagte vor Ausspruch einer Beendigungskündigung ergreifen musste. Er hatte nach den vom Arbeitsgericht ausgeführten höchstrichterlichen Grundsätzen deshalb nicht vom Ausspruch einer gegenüber der Beendigungskündigung weniger schwer in das Arbeitsverhältnis eingreifenden Änderungskündigung absehen dürfen. Selbst wenn man unter Berücksichtigung des Gutachtens vom 17.09.2015 annimmt, eine Beschäftigung mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden sei der Klägerin aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich gewesen, durfte der Beklagte jedenfalls nicht von einer Änderungskündigung zum Zwecke der Reduzierung der Arbeitszeit auf 50 % absehen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass bei entsprechendem Verlauf eines BEM sogar eine Reduzierung der Arbeitszeit schon nicht erforderlich gewesen wäre, da nach einer Therapie und ggf. leidensgerechten Anpassungen der Arbeitsbedingungen sogar eine Weiterbeschäftigung in Vollzeit möglich gewesen wäre. Eine Haltung der Klägerin, wonach jede Änderung der Arbeitsbedingungen, sei es auch im Wege der Änderungskündigung oder als sonstiges Ergebnis eines bEM von ihr vorbehaltlos abgelehnt und damit erfolglos geblieben wäre, ist nicht dargelegt. Allein aus ihrer ausweichenden Reaktion auf das Angebot auf Reduzierung der Arbeitszeit, das ja zugleich auch mit dem Angebot auf Abschluss eines Auflösungsvertrages verbunden war, und der Äußerung, sie wolle ihre bisherige Arbeitstätigkeit weiter ausüben, folgt das nicht.
II.
Die Berufung der Klägerin ist erfolgreich, das Urteil daher entsprechend abzuändern.
1.
Die Berufung der Klägerin ist gemäß §§ 8 Abs. 2, 64 Abs. 2 lit. b und Abs. 6, 66 Abs. 1 ArbGG, 519 ZPO statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt und gem. §§ 64 Abs. 6 ArbGG, 520 Abs. 3 ZPO ausreichend begründet worden. Dass die Klägerin den Weiterbeschäftigungsantrag zunächst als Hilfsantrag und mit der Berufung sodann als unbedingten Klageantrag gestellt hat, stellt keine nachträgliche Klagehäufung (§ 260 ZPO) oder Klageänderung dar, deren Zulässigkeit sich aus den §§ 263, 533 ZPO ergeben müsste. Das Arbeitsgericht hat dem Feststellungsantrag stattgegeben, wodurch entsprechend der Bedingung des erstinstanzlich gestellten Hilfsantrages der Weiterbeschäftigungsantrag rechtshängig wurde und zur Entscheidung anfiel. Dass die Klägerin diesen Antrag zweitinstanzlich nun als Hauptantrag stellt, führt nicht dazu, dass ein neuer, bislang nicht angefallener Streitgegenstand eingeführt wird (vgl. für den umgekehrten Fall: BAG v. 19.08.2010 – 8 AZR 315/09, Rz. 23 ff.)
2.
Die Berufung der Klägerin ist auch begründet. Der Beklagte ist verpflichtet, die Klägerin bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Feststellungsantrag als Sachbearbeiterin für Wohngeldfragen bei einer Wochenarbeitszeit von 37 Stunden zu beschäftigen.
a)
Die auf Weiterbeschäftigung gerichtete Klage ist nicht deshalb mangels Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig, weil der Beklagte die Klägerin ab dem 13.09.2016 im Rahmen eines Prozessarbeitsverhältnisses weiterbeschäftigt hat. Denn dieses Arbeitsverhältnis endet unstreitig mit der Verkündung des vorliegenden Urteils.
b)
Außerhalb der Regelung der § 102 Abs. 5 BetrVG, § 79 Abs. 2 BPersVG hat der gekündigte Arbeitnehmer einen arbeitsvertragsrechtlichen Anspruch auf vertragsgemäße Beschäftigung über den Ablauf der Kündigungsfrist oder bei einer fristlosen Kündigung über deren Zugang hinaus bis zum rechtskräftigen Abschluss des Kündigungsprozesses, wenn die Kündigung unwirksam ist und überwiegende schutzwerte Interessen des Arbeitgebers einer solchen Beschäftigung nicht entgegenstehen. Außer im Falle einer offensichtlich unwirksamen Kündigung begründet die Ungewissheit über den Ausgang des Kündigungsprozesses ein schutzwertes Interesse des Arbeitgebers an der Nichtbeschäftigung des gekündigten Arbeitnehmers für die Dauer des Kündigungsprozesses. Dieses überwiegt in der Regel das Beschäftigungsinteresse des Arbeitnehmers bis zu dem Zeitpunkt, in dem im Kündigungsprozess ein die Unwirksamkeit der Kündigung feststellendes Urteil ergeht. Solange ein solches Urteil besteht, kann die Ungewissheit des Prozessausgangs für sich allein ein überwiegendes Gegeninteresse des Arbeitgebers nicht mehr begründen. Hinzukommen müssen dann vielmehr zusätzliche Umstände, aus denen sich im Einzelfall ein überwiegendes Interesse des Arbeitgebers ergibt, den Arbeitnehmer nicht zu beschäftigen (BAG vom 27.02.1985 – GS 1/84).
Vorliegend liegen derartige zusätzliche Umstände, aus denen sich trotz erst- und zweitinstanzlicher Feststellung der Unwirksamkeit der streitgegenständlichen Kündigung ein überwiegendes Interesse des Beklagten ergibt, die Klägerin nicht zu beschäftigen, nicht vor. Entgegen der Auffassung des Arbeitsgerichts ergeben sie sich auch nicht aus den Feststellungen des amtsärztlichen Gutachtens vom 17.09.2015, wonach bei Erbringung der vollen geschuldeten Arbeitsleistung weiterhin mit Fehlzeiten der Klägerin zu rechnen ist. Dass der Klägerin jegliche Tätigkeit während des Kündigungsschutzprozesses unmöglich ist, ergibt sich nicht aus dem Gutachten und zeigt auch der Umstand, dass es seit dem 13.09.2016 zum Einsatz der Klägerin gekommen ist. Dass die Klägerin bei einer Beschäftigung für die Dauer des Kündigungsschutzprozesses zeitweise wegen Arbeitsunfähigkeit nicht eingesetzt werden kann, begründet kein überwiegendes Interesse des Beklagten. Er ist bei Verurteilung zur vorläufigen Weiterbeschäftigung nicht gehalten, mit der Klägerin ein auflösend bedingtes Arbeitsverhältnis abzuschließen, das ihn im Falle der Arbeitsunfähigkeit zur Lohnfortzahlung verpflichten würde, sondern lediglich verpflichtet, eine Beschäftigung tatsächlich durchzuführen. Beschäftigt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer aber lediglich infolge der gerichtlichen Verurteilung, schuldet er bei Wirksamkeit der Kündigung nach bereicherungsrechtlichen Vorschriften nur Wertersatz für geleistete Arbeit, bei Arbeitsunfähigkeit aber keine Entgeltfortzahlung (APS-Koch, § 102 BetrVG, Rz. 242). Aus hohen Entgeltfortzahlungskosten lässt sich daher ein überwiegendes Nichtbeschäftigungsinteresse nicht herleiten. Allein der Umstand, dass eine vom Arbeitgeber nicht gewünschte und nur aufgrund gerichtlicher Verurteilung erfolgende Beschäftigung zeitweise nicht möglich ist, begründet kein überwiegendes Interesse daran, sie insgesamt nicht durchzuführen.
III.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO.
IV.
Die Voraussetzungen für die Zulassung der Revision liegen nicht vor (§ 72 Abs. 2 ArbGG). Die Kammer folgt der höchstrichterlichen Rechtsprechung, eine durch diese noch nicht geklärte Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung ist nicht betroffen.
Der Beklagte wird auf die Möglichkeit der Nichtzulassungsbeschwerde (§ 72 a ArbGG) hingewiesen.