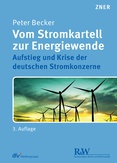VII Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Buch Der Stromstaat entsteht
- 1. Kapitel Zwei geniale Unternehmer: Emil Rathenau und Werner Siemens
- 2. Kapitel Der erste Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Berlin und der „Actiengesellschaft Städtische Elektricitätswerke“
- 3. Kapitel Die Großbanken wittern das große Geschäft
- 4. Kapitel Der Stromkrieg von 1901
- 5. Kapitel Hugo Stinnes: Die Ehe zwischen dem RWE und den Kommunen
- 6. Kapitel Der Staat greift ein
- 7. Kapitel Kein „Gasstaat“
- 8. Kapitel Das Glühlampenkartell Phoebus
- 9. Kapitel Weltwirtschaftskrise: Die Konzerne bleiben ungeschoren
- 10. Kapitel Die NSDAP übernimmt die Macht – aber die Energiekonzerne haben das Sagen
- 2. Buch Der Gesetzgeber greift nach der Energiewirtschaft – allerdings verhalten
- 11. Kapitel Ein Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen – aber nicht für die Energiewirtschaft
- 12. Kapitel Der Stromstreit
- 1. Die Stromverträge
- 2. Das Schicksal der Stadtwerke in der DDR
- 3. Die Rechtslage nach den Volkskammer-Gesetzen
- 4. Die Gegenbewegung: Stromkonzerne und Bundesregierung Hand in Hand
- 5. Der Widerstand im Westen
- 6. Erste Auseinandersetzungen vor Gericht: Die Grundsatzverständigung bleibt
- 7. Der Brief der Oberbürgermeister
- 8. Weiteres Festhalten des Staates am Weg
- 9. Der erste Stadtwerkskongress und die Kommunalverfassungsbeschwerde
- 10. Der Stromvergleich
- 11. Erfolg, Erfolg
- 12. Was blieb den Konzernen?
- 13. Und der Bund legt noch eins drauf
- 13. Kapitel Die Treuhandanstalt und der Stromvergleich: Ein Experiment, das missglückte und eines, das – mit Glück – zum guten Ende kam
- 14. Kapitel Die Liberalisierung der Energiemärkte
- 1. Vorspiel I in Deutschland
- 2. Vorspiel II auf der Brüsseler Bühne
- 3. Die Umsetzung in Deutschland
- 4. Der Wettbewerb bei Strom springt an: Die langfristigen Lieferverträge kippen
- 5. Und die langfristigen Gaslieferverträge?
- 6. Netznutzung: Viel Bürokratie und wenig Wettbewerb
- 7. Das erste Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts
- 8. Rechtsschutz
- 9. Die EnWG-Novelle 2005
- 10. Die Regulierung des Gasnetzzugangs
- 11. Die Problempunkte des Gesetzes
- 15. Kapitel Monopoly – mit staatlichem Segen
- 1. Die Ausgangslage
- 2. Die Fusion Energieversorgung Schwaben (EVS) und Badenwerk zur EnBW
- 3. Die Fusion VEBA/VIAG und ihrer Stromunternehmen PreussenElektra und Bayernwerk zur E.ON
- 4. RWE/VEW
- 5. Die Beteiligungen
- 6. ... und trotzdem kein Verbot der Fusionen
- 7. Die Fusion E.ON/Ruhrgas
- a) Der Deal
- b) Das Objekt der Begierde: die Ruhrgas AG
- c) Die Gesellschafterstruktur
- d) Das Bundeskartellamt sagt Nein
- e) So schnell wird man klüger
- f) Die Ministererlaubnis
- g) Und Dr. Müller?
- h) Der Antrag auf Ministererlaubnis
- i) Das Gutachten der Monopolkommission
- j) Müller zieht sich zurück
- k) David gegen Goliath
- l) Mündliche Verhandlung zur Ministererlaubnis Nr. 2
- m) Frau Holle schüttet den Goldsack aus
- n) „Die Würde des Rechtsstaats“
- 8. Die „vertikale Vorwärtsintegration“ oder: Wie man Stadtwerke auf die andere Seite bekommt
- 9. Traurige Ergebnisse der Fusionskontrolle
- 16. Kapitel Die Strompreisbildung: Der Verbraucher hatte immer das Nachsehen
- 1. Strompreise ohne Kontrolle
- 2. Nach dem Zweiten Weltkrieg: Späte und mühsame Installierung einer Preisaufsicht
- 3. Einer gegen alle: Der hessische Preisaufsichtsreferent Schäfer
- 4. Der Betriebsunfall: Wettbewerb in der Stromwirtschaft
- 5. Das Wunder von Leipzig
- 6. Zahlreiche Indizien für manipulierte Strompreise an der EEX
- a) Die Untersuchungen der Europäischen Kommission
- aa) Die Studie von London Economics
- bb) Die Sondergutachten Strom und Gas 2007 und 2009 der Monopolkommission
- cc) Der Schriftsatz des Bundeskartellamts vom 30.11.2006 im Fusionskontrollverfahren E.ON/Eschwege
- dd) Einheitliche Konzernstrategien gegenüber der EEX
- ee) Der Abschlussbericht der Europäischen Kommission
- b) Die Folien des „Insiders“
- c) Die Resonanz in den Behörden
- d) Schwere Regulierungsmängel bei der EEX
- a) Die Untersuchungen der Europäischen Kommission
- 7. Voraussetzungen „angemessener“ Strompreise I
- 8. Voraussetzungen „angemessener“ Strompreise II
- a) Kartellrechtliche Instrumente der Preiskontrolle
- b) Ein mutiger Schritt: Die Abmahnung gegen die Einpreisung der CO2-Zertifikate
- c) Wie § 29 GWB matt gesetzt wurde
- d) Die Sektoruntersuchung zu den Stromgroßhandelspreisen 2010
- e) REMIT, ACER und Markttransparenzstelle
- f) Preiskontrolle nach § 19 Abs. 4 Nr. 2, § 29 GWB und § 315 BGB
- 17. Kapitel E.ON oder die Liebe zum Risiko
- 1. Die E.ON AG: Der größte private Energiekonzern der Welt – zeitweise
- 2. E.ON fängt ein Bußgeld von 38 Mio. Euro für das „fahrlässige Brechen eines Siegels“
- 3. Der nächste Bußgeldbescheid der Kommission
- 4. Die Absprachen des marktbeherrschenden Duopols von E.ON und RWE
- 5. Das Deutschland-Kartell
- 6. Die Aufteilung von Ost- und Südeuropa
- 7. Das Europakartell der Energieversorger
- 8. Die Sensation: Der E.ON-Konzern wird aufgespalten
- 18. Kapitel Die Atomverstromung: Triumph der Verdrängung
- 1. Die kriegerische Nutzung der Atomkraft
- 2. Der Stromstaat will die „friedliche Nutzung“ der Atomkraft
- 3. „Ich grüße dich, Atomreaktor“: Atomverstromung in der DDR
- 4. Die Entsorgungsfrage
- 5. Das „Staats“kraftwerk Obrigheim: Ein Schwarzbau
- 6. Mülheim-Kärlich: Schwarzbau auf der Erdbebenspalte
- 7. Biblis A: Das Aha-Erlebnis Grüner Atomaufsicht
- 8. Der „ausstiegsorientierte Gesetzesvollzug im Atomrecht“
- 9. Leichen pflastern ihren Weg
- 10. Die Kosten der Atomverstromung
- 11. Der Ausstieg aus dem Ausstieg – aber nicht von Dauer
- 19. Kapitel Fukushima, die Falsifizierung der „Restrisiko“-Theorie und der Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg
- 1. Der GAU in Fukushima
- 2. Aber nach Fukushima: Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg
- 3. Gespaltene Haltungen der Stromkonzerne, nur RWE klagt
- 4. Der endgültige Ausstieg mit dem Energiewende-Gesetzespaket
- 5. Die „Restrisiko“-Theorie – und was die Juristen daraus gemacht haben
- a) Die Entwicklung der deutschen Reaktorsicherheitsforschung
- b) Die verschwiegenen Unfälle
- c) Die Übernahme der Eintrittswahrscheinlichkeiten in die Rechtsprechung
- d) Die Fragwürdigkeit der Wahrscheinlichkeitsabschätzungen
- e) Aber die weltweite Atomverstromung wird wohl erst aus weiteren Schäden klug
- f) Le désastre de la gloire du réacteur français – Der Zusammenbruch der französischen Reaktor-Herrlichkeit
- g) Und eine Rückstellungskommission (KFK)
- h) Die (deutsche) Karawane zieht weiter: Deutschland hat eine „Kommission zur Lagerung hochradioaktiver Abfallstoffe“453
- 20. Kapitel Warum die Stromkonzerne so mächtig waren – und warum ihnen der Staat Grenzen setzen kann
- 21. Kapitel Die Krise der Stromkonzerne
- 22. Kapitel Der Innogy-Deal
- 1. Wer ist Innogy?
- 2. Der E.ON/RWE-Deal
- a) Marktbeherrschung und Shareholder Value-Politik mit behördlicher Zustimmung532
- b) Auswirkungen des E.ON/RWE-Deals auf den Konzessionswettbewerb
- c) Verteilnetze als riesiges Geschäftsfeld mit hervorragenden Zukunftsaussichten
- d) Auswirkungen des E.ON/RWE-Deals auf das Endkundengeschäft mit Strom und Gas
- e) Auswirkungen auf den Zukunftsmarkt E-Mobilität
- f) Zukunftsmarkt Digitalisierung
- g) Auswirkungen auf die Energiewende als gesellschaftliche Gemeinschaftsaufgabe
- h) Public Value statt Shareholder Value
- i) Stadtwerke als wichtiges wettbewerbliches Korrektiv werden durch den Beschluss der Kartellbehörden geschwächt
- j) Change-of-Control-Klauseln als Chance für Kommunen
- k) Shareholder Value-Interessen als Treiber von Mega-Deals
- l) Fazit und Schlussfolgerungen zum E.ON/RWE-Deal
- m) Empfehlungen für Kommunen und Stadtwerke
- 3. Wie ist der Deal einzuschätzen?558
- 3. Buch Die Energiewende: Ein Jahrhundertprojekt
- 23. Kapitel Die Energiewende: Ein Jahrhundertprojekt
- 1. Die Dimensionen
- 2. Die „Klimakatastrophe“
- 3. Der europäische Emissionshandel
- 4. Die hausgemachten Mängel
- 5. Der Klimaschutzvertrag von Paris: Bemerkungen eines Insiders592
- a) Die unterschiedlichen Verursacher und ihre differenzierten Verantwortungen
- b) Entwicklungsschritte: Rio de Janeiro bis Paris
- c) Zur konkreten Vorbereitung der Weltklimakonferenz
- d) Die Bedeutung von Elmau
- e) Was macht den Klimaschutzvertrag so außergewöhnlich?
- f) Die „französische Meisterleistung“
- g) Signale aus Paris
- h) Was bedeutet Paris für Europa und Deutschland?
- i) Konkret: das EU-Emission-Trading-System (ETS)
- j) Wie geht es in der Europäischen Union weiter? Die unterschiedlichen Ziele der Mitgliedstaaten
- k) Das deutsche Aktionsprogramm Klimaschutz 2020
- l) Der Klimaschutzplan 2050: Die Ziele
- m) Die Risiken
- n) Paradigmenwechsel in der Energiepolitik
- 6. Der Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung
- 7. Das Klimaschutzgesetz
- 8. Der deutsche „Sonderweg“ – ein Glück!
- 24. Kapitel Stromeinspeisungsgesetz und EEG: Der Gesetzgeber entscheidet höchst selbst
- 1. Das Stromeinspeisungsgesetz
- 2. Das Erneuerbare Energien-Gesetz 2000
- 3. 100 % Erneuerbare Stromversorgung bis 2050: klimaverträglich, sicher, bezahlbar
- 4. Der aktuelle Stand der installierten Leistung, des Verbrauchs und der Anteil der EE daran
- 5. Die vollständige Umstellung der Stromversorgung auf EE bis 2050 ist möglich
- 6. Aber: massiver Speicherausbau nötig
- 7. Und: Netzausbau nötig
- 8. Die „Sterbelinie“ konventioneller Kraftwerke
- 9. Die Schwächen des SRU in seinen Untersuchungsempfehlungen
- 10. Ein Konfliktfeld: die Industriestrompreise
- 25. Kapitel Der Kampf um die Stromerzeugung – Vereinung des Unvereinbaren im Energiekonzept der Bundesregierung 2010
- 1. Das kommende Jahrzehnt: Zwei Züge rasen aufeinander zu
- 2. Das Energiekonzept der Bundesregierung von 2010, Teil I: EE
- 3. Pfad II: Kernenergie und fossile Kraftwerke
- 4. Das Gesetzespaket zur Energiewende 2011
- 5. Die EEG-Umlage: Ein trojanisches Pferd
- 6. Die gesetzlichen Regeln zur EEG-Umlage 2010; Kritik
- 7. Die Zusammensetzung des Strompreises
- 26. Kapitel Der Pulverdampf der „Dritten Industriellen Revolution“ lichtet sich: Minister Gabriel und seine „Eckpunkte“
- 27. Kapitel Das EEG 2017724: Ein verunglücktes Gesetz – Für und Wider
- 28. Kapitel Die GroKo, der Kohleausstieg und das Klimapaket
- 29. Kapitel Greta Thunberg
- 30. Kapitel Plädoyer für eine wirksame CO2-Bepreisung779
- 1. Zusammenfassung
- 2. Wie müsste ein im Sinne des Pariser Klimaschutzabkommens wirksamer Umbau des Europäischen Stromhandels (ETS) ausgestaltet werden und ist er politisch realistisch durchsetzbar?
- a) Der europäische Emissionshandel in der jetzigen Form führt nicht zum wirksamen Klimaschutz im Sinne des Pariser Klimaschutzabkommens
- b) Emissionshandel versagt auch bei der Reduktion der Stromproduktion aus fossilen Energieträgern
- c) Die Ursachen des Scheiterns des EU-ETS
- d) Ist ein im Sinne des Pariser Klimaschutzabkommens wirksamer Umbau des ETS politisch realistisch durchsetzbar?
- e) Emissionshandel und CO2-Mindestpreise
- 3. Wie kann die weitere Energie- und Klimapolitik im Sinne der Ziele von Paris wirksam, wettbewerbsgerecht, planbar, technologieneutral und kompatibel mit Europa- und Welthandelsrecht gestaltet werden?
- a) Nationale oder europäische Klimaschutzpolitik?
- b) Der Weg zu internationalen CO2-Preisen führt über nationale oder multinationale Initiativen.
- c) Nationale CO2-Preise auf fossile Energieträger lassen sich konform sowohl zum Europa- als auch zum Welthandelsrecht umsetzen.
- e) CO2-Bepreisung fossiler Energien zur Neuausrichtung der bestehenden Umlagen und Steuern auf Energie am Klimaschutz
- 4. Anhang: Beispielrechnungen zu den Auswirkungen der CO2-Abgabe auf die Energiekosten
- 5. Abschließende Thesen
- a) These 1: Die Zeit drängt!
- b) These 2: Deutschland ist führender Klimasünder!
- c) These 3: Weiter so ist keine Option!
- d) These 4: Der europäische Emissionshandel (EU-ETS) ist gescheitert!
- e) These 5: Geringe CO2-Preise (ETS) führen zu niedrigen Strombörsenpreisen, hohen Stromexporten in Deutschland und verzerren den Wettbewerb!
- f) These 6: Preisbasierte Instrumente (CO2-Steuern) sind einfacher, schneller und an die jeweiligen nationalen Randbedingungen angepasst umsetzbar!
- g) These 7: Sektorübergreifende CO2-Bepreisung für Alle ohne Ausnahme sind verursachergerecht!
- h) These 8: Höhe und Anstiegspfad des CO2-Preises sind für die Wirksamkeit entscheidend, schaffen Planungssicherheit und sind technologieoffen!
- i) These 9: CO2-Preise ab 40 Euro pro Tonne ermöglichen eine aufkommensneutrale Einnahmeverwendung für bisherige Umlagen und Steuern auf Energie!
- j) These 10: Nationale CO2-Preise sind rechtlich zulässig und im bestehenden Rechtsrahmen umsetzbar!
- k) These 11: Die Verlagerung von Emissionen und Produktion (Carbon Leakage) kann durch Grenzsteuerausgleich und Stromkennzeichnung vermieden werden!
- l) These 12: Flankierende Maßnahmen können den Ausstieg aus der Braunkohle sozialverträglich gewährleisten!
- m) These 13: CO2-Abgabe wirkt Paragrafenexplosion und Förderdschungel entgegen und trägt zum Bürokratieabbau bei!
- n) These 14: CO2-Bepreisung ist ein Vorbild für die Internalisierung von externen Kosten und eine finanzielle Grundlage für Entzug von CO2 aus der Troposphäre!
- o) These 15: Zur CO2-Bepreisung besteht ein breiter Konsens in Wissenschaft und Wirtschaft!
- 31. Kapitel Der Kampf um die Energiewende
- 1. Befürworter, Gegner – und Halbherzige
- 2. Die Angriffe auf die Energiewende; vor allem: die Kosten
- 3. Mit vollem Rohr dagegen: Die FAZ und die Energiewende
- 4. Speziell: Der Angriff auf die Technologielinie Photovoltaik
- 5. Aber was kostet EE-Strom wirklich?
- 6. Die Verteidiger der Energiewende
- 32. Kapitel Die Paragrafenexplosion im Energierecht und wie man ihr beikommen könnte
- 1. Überlegungen zur Reduzierung der Komplexität964
- a) Die Normenflut im Energierecht
- b) Das Energiewirtschaftsgesetz
- c) Entflechtung des EnWG
- d) Der Verbraucherschutz
- e) Sonderkomplexe
- f) Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
- g) Exkurs: Wie der Gesetzgebungsprozess zum EEG 2009 aus dem Ruder lief
- h) Wie geht man mit diesem neuartigen Gesetzgebungsprozess um?
- i) Die Neuordnung des Energierechts: Vom Europarecht lernen!
- j) Das Internet als Kommunikationsplattform mit den Betroffenen
- 2. Der Normenkontrollrat
- 1. Überlegungen zur Reduzierung der Komplexität964
- 33. Kapitel Wer hilft beim Handling der Energiewende?
- 34. Kapitel Visionen
- 1. Vision I von Dieter Attig: Wo stehen wir?
- a) Die Energiewende in Deutschland kommt langsam – auf dem Stromsektor ist sie schon da1012
- b) Ökonomischer Hintergrund
- c) Langfristspeicher
- d) Kurzfristspeicher
- e) Fossile Kraftwerke
- f) Sonstige Flexibilitätsoptionen
- g) Stromnetze
- h) Wärmemarkt
- i) Verkehr
- j) Was ist los in Deutschland?
- k) Was ist in Deutschland zu tun?
- l) Fazit für die Energiewende
- 2. Vision II: Peter Becker1013
- a) Kein Stein bleibt auf dem anderen
- b) Eigenversorgung
- c) Der „Guerilla“-Speicher
- d) Der Eigenverbraucher und die Allgemeinheit
- e) Unterschiedliche Strompreise
- f) Grund: Die Verteilnetzentgelte
- g) Der nächste Schritt: Die EEG-Umlage wird zu einer Infrastrukturumlage, muss aber bereinigt werden
- h) Netze als staatliche Infrastruktur
- i) Und die Konzerne? Der Steuerzahler wird’s schon richten ...
- 1. Vision I von Dieter Attig: Wo stehen wir?
- 35. Kapitel Die Energiewende wird von der Gesellschaft für die Gesellschaft gemacht: Alles könnte gut werden
- 23. Kapitel Die Energiewende: Ein Jahrhundertprojekt
- Anhang 1
- Anhang 2
- Anhang 3
- Anhang 4
- Anhang 5
- Anhang 6
- Anhang 7