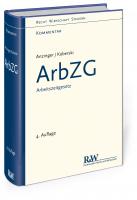ArbG Hamburg: Entschädigung wegen Nichteinstellung einer „Nicht-Christin"
ArbG Hamburg, Urteil vom 4.12.2007 - 20 Ca 105/07
Leitsätze:
Der Ausschluss einer muslimischen Bewerberin aus dem Auswahlverfahren um die Besetzung einer von einer Einrichtung des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland ausgeschriebenen Stelle einer Sozialpädagogin für ein aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds sowie des Bundes finanziertes Projekt zur beruflichen Integration von Migrantinnen und Migranten wegen Nichtzugehörigkeit zur christlichen Religion verstößt in unzulässiger Weise gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 AGG und begründet einen Anspruch auf eine angemessene Entschädigung gemäß § 15 AGG. Die Voraussetzungen für eine zulässige unterschiedliche Behandlung wegen der Religion im Hinblick auf das Selbstbestimmungsrecht der evangelischen Kirche oder auf eine nach der Art der Tätigkeit gerechtfertigte berufliche Anforderung im Sinne von § 9 AGG sind in einem solchen Fall nicht gegeben.
Sachverhalt:
Die Klägerin begehrt Entschädigung wegen religionsbedingter Benachteiligung durch den Beklagten in einem Verfahren zur Besetzung der Stelle einer Sozialpädagogin für ein Teilprojekt der EQUAL-E.N.
Der Beklagte, der für H. zuständige D., ist als solcher Teil der Nordelbischen Evangelisch-lutherischen Kirche (NEK) und damit der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD). Die von dem Beklagten im H. Wirkungsbereich repräsentierte Diakonie versteht sich als unmittelbare Lebens- und Wesensäußerung der christlichen Kirche. Dementsprechend lautet die Satzungspräambel:
"Die Kirche hat den Auftrag, Gottes Liebe zur Welt in Jesus Christus allen Menschen zu bezeugen. Diakonie ist eine Gestalt dieses Zeugnisses und nimmt sich besonders der Menschen in leiblicher Not, in seelischer Bedrängnis und in sozial ungerechten Verhältnissen an. Sie sucht auch die Ursachen dieser Nöte zu beheben. Sie richtet sich in ökumenischer Weite an Einzelne und Gruppen, an Nahe und Ferne, an Christen/Christinnen und Nichtchristen/Nichtchristinnen. Da die Entfremdung von Gott die tiefste Not des Menschen ist und sein Heil und Wohl untrennbar zusammengehören, vollzieht sich Diakonie in Wort und Tat als ganzheitlicher Dienst am Menschen.
Das D. weiß sich diesem Auftrag Jesu Christi verpflichtet."
Für den Bereich der EKD und der NEK hat der Rat der EKD nach Artikel 9 b der Grundordnung über die Anforderungen der privatrechtlichen beruflichen Mitarbeit in der Evangelischen Kirche in Deutschland und des DW der EKD die "Richtlinie des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland" erlassen, die u. a. folgende Bestimmungen enthält:
"§ 2
Grundlagen des Kirchlichen Dienstes
(1) Der Dienst der Kirche ist durch den Auftrag bestimmt, das Evangelium in Wort und Tat zu bezeugen. Alle Frauen und Männer, die in Anstellungsverhältnissen in Kirche und Diakonie tätig sind, tragen in unterschiedlicher Weise dazu bei, dass dieser Auftrag erfüllt werden kann. Dieser Auftrag ist die Grundlage der Rechte und Pflichten von Anstellungsträgern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ...
§ 3
Berufliche Anforderung
bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses
(1) Die Berufliche Mitarbeit in der Evangelischen Kirche und ihrer Diakonie setzt grundsätzlich die Zugehörigkeit zu einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland oder einer Kirche voraus, mit der die Evangelische Kirche in Deutschland in Kirchengemeinschaft verbunden ist.
(2) Für Aufgaben, die nicht der Verkündung, Seelsorge, Unterweisung oder Leitung zuzuordnen sind, kann von Abs. 1 abgewichen werden, wenn andere geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht zu gewinnen sind. In diesem Fall können auch Personen eingestellt werden, die einer anderen Mitgliedskirche der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland oder der Vereinigung Evangelischer Freikirchen angehören sollen. Die Einstellung von Personen, die die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht erfüllen, muss im Einzelfall unter Beachtung der Größe der Dienststelle oder Einrichtung und ihrer sonstigen Mitarbeiterschaft sowie der wahrzunehmenden Aufgaben und des jeweiligen Umfeldes geprüft werden. § 2 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt ...".
Die Kläger ist Deutsche türkischer Herkunft und gehört nicht einer christlichen Kirche an.
Mit Stellenanzeige vom 30. November 2006 (Blatt 17 d. A.) suchte der Beklagte zum 01. Februar 2007 projektbedingt befristet bis zum 31. Dezember 2007 für den Vorstandsbereich Soziales und Ökumene /Fachbereich Migration und Existenzsicherung eine/n Sozialpädagogin/en für das Teilprojekt "Integrationslotse H." der Equal-E.N..
In der Stellenanzeige heißt es u. a.:
"Dieses Projekt ist ein Schulungs- und Informationsangebot für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren im Bereich der beruflichen Integration von erwachsenen Migrantinnen und Migranten.
Zu den Aufgaben dieser Position gehören der inhaltliche Ausbau der Rubrik "Fachinformationen" ..., die Erstellung von Informationsmaterial, die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen sowie die Arbeit in den Strukturen und Gremien des Fachbereichs Migration und Existenzsicherung.
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Sozialwissenschaft/Sozialpädagogik (o. Ä.), Erfahrungen in der Projektarbeit sowie Erfahrungen und Kompetenzen in den Themenbereichen Migration, Arbeitsmarkt und Interkulturalität. Sie besitzen zudem sichere EDV-Anwender- und Internetkenntnisse. Für Sie sind sowohl das eigenständige Arbeiten als auch das konstruktive Arbeiten im Team selbstverständlich.
Als diakonische Einrichtung setzen wir die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche voraus.
..."
Die Klägerin, die nicht über ein abgeschlossenes Hochschulstudium verfügt, bewarb sich mit Schreiben vom 24. Dezember 2006 (Blatt 22 d. A. nebst Anlagen Blatt 18-21 d. A.) um diese Stelle. Auf diese Bewerbung erhielt die Klägerin am 02. Januar 2007 den Anruf einer Mitarbeiterin des Beklagten, die der Klägerin erklärte, deren Bewerbung sei sehr interessant, lasse jedoch die Frage der Religionszugehörigkeit unbeantwortet. Auf die Erklärung der Klägerin, sie praktiziere keine Religion, sei aber als Türkin gebürtige Muslimin, fragte die Mitarbeiterin des Beklagten, ob die Klägerin sich den Eintritt in die Kirche vorstellen könne, da dies unbedingte Voraussetzung für die Stelle sei. Die Klägerin erwiderte, sie halte dies nicht für nötig, da die Stelle keinen religiösen Bezug aufweise.
Mit Schreiben vom 06. Februar 2007 (Blatt 23 d. A.) lehnte der Beklagte die Bewerbung der Klägerin ab.
Mit Schreiben ihres Prozessbevollmächtigten vom 21. Februar 2007 (Blatt 24 bis 26 d. A.) begehrte die Klägerin Entschädigung von dem Beklagten gemäß § 15 AGG im Hinblick auf ihre Benachteiligung wegen ihrer Religion und ihrer ethnischen Herkunft bei der Stellenbesetzung. Dies lehnte die Beklagte mit Schreiben vom 01. März 2007 (Blatt 27 d. A.) ab und erklärte, die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche stelle eine im Sinne des § 9 AGG gerechtfertigte berufliche Anforderung für die Mitarbeit im DW dar.
Die Klägerin ist der Auffassung, sie sei durch den Beklagten im Bewerbungsverfahren unmittelbar wegen ihrer Religion sowie mittelbar wegen ihrer ethnischen Herkunft in unzulässiger Weise benachteiligt worden, so dass ihr gegen den Beklagten ein Entschädigungsanspruch in Höhe von drei Bruttomonatsgehältern zustehe. Der Verdienst der Klägerin auf der ausgeschriebenen Stelle hätte bei ca. EUR 1.300,00 brutto monatlich gelegen.
Im Einzelnen trägt die Klägerin vor:
Das Kriterium der Kirchenmitgliedschaft sei bereits unter vergaberechtlichen Gesichtspunkten unzulässig.
Das EQUAL-Programm der EU setze sich für die berufliche Integration benachteiligter Personengruppen ein und werde aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds kofinanziert.
Die E.N., deren Teil das Projekt Integrationslotse sei, werde durch diese Mittel finanziert. E.N. habe einen Förderungsantrag für die verschiedenen Projekte beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales gestellt, das als nationale Koordinierungsstelle für die Vergabe der EU-Mittel verantwortlich sei. Die Mittelvergabe sei durch einen Zuwendungsbescheid des Ministeriums an die E.N. erfolgt. Dieser Zuwendungsbescheid enthalte folgenden Hinweis an die Zuwendungsempfänger:
"Hinweis:
Der Grundgedanke der Gemeinschaftsinitiative EQUAL sollte auch bei der Einstellungspraxis berücksichtigt werden. Insbesondere wird dringend empfohlen, keine den Bewerberkreis einschränkenden Vorgaben zu machen und auch die Auswahl von Mitarbeitern in dieser Hinsicht neutral durchzuführen."
Anlass für diesen Hinweis sei ein Streit mit einem kirchlichen Träger im Jahr 2002 gewesen, bei dem es ebenfalls um das Religionskriterium bei von EQUAL geförderten Projekten gegangen sei.
Das Bundesministerium sei ebenfalls bei der hier streitigen Stellenausschreibung der Auffassung, dass das Kriterium der Religionszugehörigkeit eine unzulässige Einschränkung des Bewerberkreises darstelle und habe deswegen kürzlich die Finanzierung der Stelle gestoppt sowie die entsprechenden Kosten im Rahmen des E.N.-Zuwendungsbescheides nicht anerkannt.
Das Kriterium der Kirchenmitgliedschaft konterkariere die Ziele des Projekts "Integrationslotse", mit dem ersichtlich alle Migranten unabhängig von ihrer Konfessionszugehörigkeit angesprochen werden sollten. Für diese Zielsetzung sei die Verknüpfung von Integrationsbemühungen mit Missionierungsversuchen hinderlich, da sie für alle, die eine fachliche Beratung ohne Verkündung eines Glaubens wünschten, eine Zugangsbarriere darstellen könne.
Dem Beklagten gehe es in dem Projekt Integrationslotse ausdrücklich nicht um die gezielte Integration christlicher Migranten. Angesprochen seien vielmehr alle Migranten unabhängig von deren Konfessionszugehörigkeit. In der Praxis des Projekts finde sich denn auch keinerlei Bezug zu einer religiösen Tätigkeit.
Der Beklagte habe, indem er staatliche Mittel beantragt habe, um eine reine "weltliche" Zielsetzung zu fördern, jedenfalls insoweit auf sein Selbstbestimmungsrecht verzichtet, als dieses in Widerspruch zu den Zielen und Kriterien des EQUAL -Projektes stehe.
Dem Beklagten stehe auch unabhängig von der Fremdfinanzierung das von ihm in Anspruch genommene Selbstbestimmungsrecht vorliegend nicht zu.
Die europäischen Vorgaben des Diskriminierungsschutzes sowie das Gebot der europarechtskonformen Auslegung beschränkten die Selbstverwaltung der Kirche.
Artikel 4 der Richtlinie 2000/78/EG statuiere keine umfassende Freistellung der Kirche von dem Benachteiligungsverbot. Danach sei eine Ungleichbehandlung nur zulässig, wenn angesichts des Ethos der Organisation die Religion der Person nach der Art der Tätigkeit oder der Umstände ihrer Ausübung eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung darstelle. Danach räume das europäische Recht den Kirchen Tendenzschutz ein, nicht aber eine Position, die dem bisherigen deutschen Verständnis des Selbstbestimmungsrechts entspreche.
Auch nach Auffassung des deutschen Gerichtsgebers solle, wie aus der Gesetzesbegründung zu § 9 AGG ersichtlich, das in § 9 AGG bestätigte Selbstbestimmungsrecht der Kirche nicht über das hinausgehen, was nach Artikel 4 der Richtlinie zulässig sei. Danach sei im Ergebnis eine Benachteiligung wegen der Religion bei der Einstellung auch durch kirchliche Träger nur noch dann zulässig, wenn dies auf Grund der konkreten Funktion der Stelle erforderlich sei.
Davon sei vorliegend nicht auszugehen. Wie aus der Stellenbeschreibung (Anlage B 2 Blatt 110 bis 113 d. A.) ersichtlich, vertrete der Stelleninhaber das DW in keinem Gremium. Darüber hinaus beinhalte die Stelle keinerlei Vollmachten und weise weder Feststellungs- noch Anweisungsbefugnisse auf. Die Mitarbeit in den Gremien beschränke sich auf die Teilnahme an den Gremien der E.N. sowie die Arbeit in den Strukturen und Gremien des Fachbereichs Migration und Existenzsicherung des Beklagten selbst. Tatsächlich sei es dem Beklagten selbst nicht darum gegangen, dass die einzustellende Person bestimmte Werte verkörpere oder sich in bestimmter Weise verhalte, sondern ausschließlich um das formale Kriterium der Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche.
Der Beklagte erfülle mit staatlichen Mitteln einen staatlichen Auftrag, der ebenso gut von einem nicht religiösen Träger wahrgenommen werden könne.
Die DW gehe mit der Ausweitung ihrer Aufgabenbereiche immer mehr dazu über, je nach Verfügbarkeit auf dem Arbeitsmarkt auch Nichtchristen einzustellen. Sie gebe in ihren tariflichen Vorschriften lediglich zwingend vor, dass evangelische Grundlagen der diakonischen Arbeit anerkannt würden und der Beschäftigte sich durch sein Verhalten dazu nicht in Widerspruch setze. Die Mitgliedschaft in einer Kirche sei lediglich als Sollvorschrift ausgestaltet, Ausnahmen seien zulässig.
Die Klägerin beantragt,
die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin eine angemessene Entschädigung gemäß § 15 AGG zu zahlen, deren Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt wird.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Die Beklagte ist der Auffassung, der Klägerin stehe der geltend gemachte Entschädigungsanspruch nicht zu und trägt dazu im Einzelnen vor:
Der Vorwurf der unzulässigen Benachteiligung wegen der ethnischen Herkunft scheide von vornherein aus, da sich der Beklagte weder im Rahmen der veröffentlichten Stellenanzeige noch später bei der Besetzung seine Entscheidung davon habe leiten lassen und letztendlich die fragliche Stelle an eine gebürtige Inderin vergeben habe.
Die Begrenzung der als geeignet angesehenen Bewerber und Bewerberinnen in der Stellenanzeige auf Personen, die die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche aufweisen konnten, sei gemäß § 9 Abs. 1 AGG zulässig gewesen und stelle damit keinen Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot des AGG dar.
Alleiniger Maßstab für die Zulässigkeit des Handelns des Beklagten seien die Vorschriften des AGG, durch die der Gesetzgeber der Bundesrepublik die EG-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt habe. Das selbstverständliche Gebot der richtlinienkonformen Auslegung des nationalen Rechts bedeute nicht, dass das Europäische Recht und damit die in Frage stehende Richtlinie alleinige oder wesentliche Richtschnur für die Auslegung des § 9 AGG sei. In erster Linie habe sich die Auslegung an nationalem Recht, insbesondere der Verfassung mit ihrer besonderen Garantie des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts (Art. 140 GG i.V.m. § 137 WRV) auszurichten.
Auch der europarechtliche Kontext des § 9 AGG führe im Übrigen zu keiner anderen Beurteilung. Durch die Erklärung Nr. 11 im Amsterdamer Vertrag sowie vor allem durch den auf diese Erklärung Bezug nehmenden Erwägungsgrund 24 zu der in Frage stehenden EG - Richtlinie werde klargestellt, dass das Gemeinschaftsrecht den nationalen Status der Kirchen und die sich daran knüpfenden spezifischen Befugnisse gerade nicht in irgendeiner Weise beeinträchtigen, mithin in die den Kirchen nach den nationalen Rechtsordnungen gewährten Autonomien und Entscheidungsfreiheiten in keiner Weise eingreifen wolle.
§ 9 Abs. 1 AGG berechtige den Beklagten, die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche als "berufliche Anforderung" für eine jedwede Tätigkeit in seinem Wirkungskreis zu definieren und damit zur Voraussetzung für eine Einstellung zu machen.
Die Auslegung dieser Vorschrift habe sich ausschließlich daran zu orientieren, inwieweit und in welcher Weise der Beklagte bzw. die NEK und EKD unter Beachtung ihres Selbstverständnisses als christliche Kirche legitimiert seien, Anforderungen an Beschäftigte im kirchlichen Dienst aufzustellen. Im Hinblick auf das verfassungsrechtlich garantierte kirchliche Selbstbestimmungsrecht komme allein der Kirche das Recht zu, für sich näher zu definieren und festzulegen, was in ihrem Wirkungskreis "berufliche Anforderungen" zu sein hätten. Die Gesamtheit der kirchlichen Bediensteten werde als Dienstgemeinschaft verstanden, in der jeder einzelne einen auf das Selbstverständnis der Kirche bezogenen, von diesem nicht trennbaren Dienst wahrnehme, und damit unmittelbar zu den "Wesens- und Lebensäußerungen" der Kirche beitrage. Diese generelle Verknüpfung der Tätigkeit jedes einzelnen kirchlichen Mitarbeiters mit der Wahrnehmung des umfassenden kirchlichen Auftrags dürfe unabhängig von der jeweils konkret erfüllten Aufgabe nicht in Frage gestellt werden. Vielmehr müsse es der Kirche freistehen, für den Bereich der in ihrem Wirkungskreis entfalteten Tätigkeiten autonom Festlegungen zu treffen, die auch innerhalb der weltlichen Rechtsordnung unmittelbar Verbindlichkeit entfalteten. Die diesen Zusammenhängen Rechnung tragenden verbindlichen Vorgaben fänden ihren Niederschlag in der Richtlinie des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. An den dort in § 3 geregelten beruflichen Anforderungen für die Aufnahme einer Tätigkeit im kirchlichen Dienst orientiere sich die Einstellungs- und Beschäftigungspraxis des Beklagten. Bei dem Beklagten einschließlich des ihm angeschlossenen Hilfswerkes der NEK gehörten von 207 Mitarbeitern lediglich 5 nicht der Evangelischen oder Katholischen Kirche an. Diese Ausnahmen seien allein dadurch bedingt, dass im Wirkungskreis des Beklagten die Erfüllung bestimmter Aufgaben gerade nur mit Menschen möglich sein könne, die nicht der christlichen Religion angehörten oder dass die Situation auf dem Arbeitsmarkt es erfordere, einen nicht dem christlichen Glaubensbekenntnis anhängenden Menschen einzustellen.
Auch nach der Art der Tätigkeit der im Streit stehenden Stelle sei die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche als gerechtfertigte berufliche Anforderung anzuerkennen.
Bei dem Projekt "Integrationslotse H." gehe es nicht primär darum, dass der betraute Mitarbeiter auf Grund seiner eigenen Person eine besondere Nähe zu dem angesprochenen Personenkreis der Migranten aufweise. Es sei gerade Anliegen und Ziel des Projektes, eine Integration der Migranten in die hiesige Gesellschaft zu begleiten, was regelmäßig nur von einer Person mit einem Hintergrund, der nicht demjenigen der zu betreuenden Migranten entspreche, geleistet werden könne.
Der Beklagte als Spitzenverband der DW verfolge den kirchlichen Auftrag nicht im Wege der Verkündigung oder Missionierung, sondern über einen "in Wort und Tat" praktizierten "ganzheitlichen Dienst am Menschen" also im Wege der tätigen Nächstenliebe.
Die im Projekt Integrationslotse H. für die dort beschäftigte Sozialpädagogin anfallenden Aufgaben stünden im unmittelbaren Kontext mit der Wahrnehmung des diakonischen Auftrages des Beklagten. Inhaltlich sei das Projekt davon geprägt, die strukturellen und institutionellen Ursachen der Diskriminierung und Benachteiligung von Migranten zu beseitigen, ihre Partizipationsmöglichkeiten zu stärken und die Gleichstellung und Gleichberechtigung von Migranten zu erreichen. Dieser Ansatz orientiere sich an der Rahmenkonzeption "Migration, Integration und Flucht" des DW der EKD und transportiere damit das diakonische Profil in die fachliche Arbeit. Das Projekt präsentiere sich folglich explizit als ein solches der Beklagten und damit der EKD und des NEK.
Zu den Aufgaben der Sozialpädagogin gehöre es laut Stellenbeschreibung, den Beklagten in öffentlichen Auftritten bei Veranstaltungen, in Gremien, in Verhandlungen insbesondere auch gegenüber Vertretern von Behörden, Institutionen und Verbänden sowie gegenüber kommunalen, nationalen und internationalen Einrichtungen zu repräsentieren. Damit erhalte die Tätigkeit einen unmittelbaren kirchlich -diakonischen Einschlag, der die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche als Merkmal der Identifikation mit dem Leitbild des Beklagten für die Mitarbeiterin unabdingbar mache.
Diese Einordnung der Tätigkeit werde nicht dadurch relativiert, dass das Projekt eingebunden sei in eine Initiative der Europäischen Union und aus deren sowie Bundesmitteln finanziert werde. Den Zuwendungsgebern auf europäischer und nationaler Ebene sei bewusst, dass eine Unterstützung von Projekten, die ein kirchlich-diakonischer Träger durchführe, stets von vornherein unter den sich mit Blick auf das kirchliche Selbstbestimmungsrecht ergebenden Vorbehalten stehe. Dementsprechend machten die Zuwendungsbescheide dem Beklagten die neutrale Auswahl von Mitarbeitern gerade nicht zur rechtlich erzwingbaren Auflage, sondern ließen es mit einem bloßen "Hinweis" im Sinne einer Empfehlung bewenden in Respekt vor dem kirchlichen Selbstbestimmungsrecht. Das gesamte Subventions-Zuwendungsrecht - zumal als Bestandteil des öffentlichen Rechtes -müsse die Verfassungsgarantie aus Artikel 140 GE in Verbindung mit Artikel 137 Abs. 3 WRV, auf die sich der Beklagte ohne Einschränkung berufen könne, anerkennen.
Zur Ergänzung des Tatbestands wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen, die zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht wurden, sowie auf den gesamten Akteninhalt Bezug genommen.
Aus den Gründen:
Die Klage ist zulässig und begründet.
Der Klägerin steht gegen den Beklagten ein Schadensersatzanspruch in Höhe von EUR 3.900,00 gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 AGG i. V. m. §§ 7 Abs. 1, 3 Abs. 1 AGG zu.
1.) Die Ablehnung der Bewerbung der Klägerin auf die Stellenanzeige vom 30. November 2001 bezüglich einer Sozialpädagogin für das Teilprojekt „Integrationslotse H." stellt einen Verstoß gegen das in § 7 Abs. 1 i. V. m. §§ 1, 2, 3 AGG festgelegte Benachteiligungsverbot dar.
a) Die Bewerbung der Klägerin auf die fragliche Stelle ist unstreitig wegen der Religion der Klägerin von dem Beklagten nicht berücksichtigt worden.
Diese Benachteiligung der Klägerin im Einstellungsverfahren ist unzulässig.
Die unterschiedliche Behandlung der Klägerin wegen ihrer Religion erfüllt nicht die Voraussetzungen der Ausnahmevorschrift des § 9 Abs. 1 AGG.
Gemäß §9 Abs.2 AGG ist eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion bei der Beschäftigung durch Religionsgemeinschaften, die ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform oder durch Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Religion zur Aufgabe machen, auch zulässig, wenn eine bestimmte Religion unter Beachtung des Selbstverständnisses der jeweiligen Religionsgemeinschaft oder Vereinigung im Hinblick auf ihr Selbstbestimmungsrecht oder nach Art der Tätigkeit eine gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellt.
aa) Mit der Vorschrift des § 9 AGG macht der Gesetzgeber Gebrauch von den Optionen zur Ausgestaltung der unterschiedlichen Behandlung wegen der Religion in kirchlichen Einrichtungen, wie sie in der Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 niedergelegt sind. Art. 4 Abs.2 RL 2008/78/EG lautet:
„Die Mitgliedstaaten können in Bezug auf berufliche Tätigkeiten innerhalb von Kirchen und anderen öffentlichen oder privaten Organisationen, deren Ethos auf religiösen Grundsätzen oder Weltanschauungen beruht, Bestimmungen in ihren zum Zeitpunkt der Annahme dieser Richtlinie geltenden Rechtsvorschriften beibehalten oder in künftigen Rechtsvorschriften Bestimmungen vorsehen, die zum Zeitpunkt der Annahme dieser Richtlinie bestehende einzelstaatliche Gepflogenheiten widerspiegeln, und wonach eine Ungleichbehandlung wegen der Religion einer Person keine Diskriminierung darstellt, wenn die Religion oder die Weltanschauung dieser Person nach der Art dieser Tätigkeiten oder der Umstände ihrer Ausübung eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung angesichts des Ethos der Organisation darstellt. Eine solche Ungleichbehandlung muss die verfassungsrechtlichen Bestimmungen und Grundsätze der Mitgliedstaaten sowie die allgemeinen Grundsätze des Gemeinschaftsrechts beachten und rechtfertigt keine Diskriminierung aus einem anderen Grund."
Die darin enthaltene Bestandsschutzklausel erklärt es für zulässig, das nationale Staatskirchenrecht bestehen zu lassen. Die bestehenden einzelstaatlichen Gepflogenheiten müssen nicht angepasst werden. Die mitgliedstaatlichen Ausnahmen für die berufliche Tätigkeit in religiösen Organisationen dürfen jedoch nicht über das nach Art. 4 Abs. 2 zulässige Maximum hinausgehen (Rust/Falke AGG Kommentar,§9, RN 25).
Daran ändert auch der Erwägungsgrund Nr. 24 der Richtlinie nichts. Er verweist auf die der Schlussakte zum Vertrag von Amsterdam beigefügten Erklärung Nr.11, in der die Europäische Union zum Status der Kirchen und weltanschaulichen Gemeinschaften ausdrücklich anerkannt hat, dass sie den Status, den Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften in den Mitgliedstaaten nach deren Rechtsvorschriften genießen, achtet und ihn nicht beeinträchtigt.
Die Erklärung Nr.11 ist eine politische Absichtserklärung, die im Text des Unionsvertrages selbst nicht enthalten ist, und besitzt als solche keine rechtliche Verbindlichkeit (Thüsing, Kirchliches Arbeitsrecht, S.222).
Die Befugnisse der Mitgliedsstaaten werden durch Artikel 4 Abs. 2 der Richtlinie gerade konkretisiert. Eine weitergehende, im Richtlinientext selbst nicht enthaltene Ausnahme vom Benachteiligungsverbot kann nicht aus einer Begründungserwägung abgeleitet werden, die lediglich allgemein die Zulassung von Ausnahmen begründet (Erfurter Kommentar 7. Auflage Schlachter § 9 AGG Randnote 3).
Die Richtlinie bindet eine Differenzierung nach der Religion daran, dass diese nach Art der Tätigkeit oder den Umständen ihrer Ausübung eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung angesichts des Ethos der Organisation darstellt. Die Rechtfertigungswirkung hat mithin einen Tätigkeitsbezug, der eine unterschiedslose Forderung nach Religionszugehörigkeit problematisch macht (Erfurter Kommentar, 7.Auflage, Schlachter, §9, RN 1).
Das nationale Recht ist richtlinienkonform auszulegen, um einen Widerspruch zum europäischen Recht zu vermeiden.
bb) Der Beklagte ist Adressat der Vorschrift des § 9 Abs. 2 AGG. Artikel 140 GG i. V. m. Artikel 137 Abs. 3 WRV garantiert den Religionsgesellschaften, also auch der Kirche, die Freiheit, ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes zu ordnen und zu verwalten.
Diese Selbstordnungs- und Selbstverwaltungsgarantie kommt nicht nur den Kirchen und deren rechtlich selbständigen Teilen zu Gute, sondern allen der Kirche in bestimmter Weise zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform, wenn sie nach kirchlichem Selbstverständnis ihrem Zweck und ihrer Aufgabe entsprechend berufen sind, ein Stück des Auftrags der Kirche wahrzunehmen und zu erfüllen (Bundesverfassungsgericht Beschluss vom 04. Juni 1985 - 2 BvR 1703, 1718/38 und 856/84 - E 70, S. 138 f).
Das DW der EKD gehört ohne Zweifel zu solchen Einrichtungen der Evangelischen Kirche.
cc) Das Selbstverständnis des Beklagten als Einrichtung der Evangelischen Kirche ist richtlinienkonform auszulegen.
Nach dem Selbstverständnis der Evangelischen Kirche umfasst die Religionsausübung nicht nur den Bereich des Glaubens und des Gottesdienstes, sondern auch die Freiheit zur Entfaltung und Wirksamkeit in der Welt, wie es ihrer religiösen und diakonischen Aufgabe entspricht.
Die Verfassungsgarantie des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts gewährleistet den Kirchen, darüber zu befinden, welche Dienste es in ihren Einrichtungen geben soll und in welchen Rechtsformen sie wahrzunehmen sind. Die Kirchen sind dabei nicht darauf beschränkt, für den kirchlichen Dienst besondere Gestaltungsformen zu entwickeln, sie können sich auch der jedermann offenstehenden Privatautonomie bedienen, um ein Dienstverhältnis zu begründen und zu regeln. Die im Selbstbestimmungsrecht der Kirchen enthaltene Ordnungsbefugnis gilt nicht nur für die kirchliche Ämterorganisation, sondern allgemein für die Ordnung des kirchlichen Dienstes. Bedienen sich die Kirchen wie jedermann der Privatautonomie zur Begründung von Arbeitsverhältnissen, so findet auf diese das staatliche Arbeitsrecht Anwendung. Die Einbeziehung der kirchlichen Arbeitsverhältnisse in das staatliche Arbeitsrecht hebt jedoch deren Zugehörigkeit zu den „eigenen Angelegenheiten" der Kirche nicht auf. Sie darf deshalb die verfassungsrechtlich geschützte Eigenart des kirchlichen Dienstes nicht in Frage stellen. Die Verfassungsgarantie des Selbstbestimmungsrechts der Kirche bleibt für die Gestaltung dieser Arbeitsverhältnisse wesentlich. Die Gestaltungsfreiheit des kirchlichen Arbeitgebers nach Artikel 37 Abs. 3 Satz 1 WRV für die auf Vertragsebene begründeten Arbeitsverhältnisse steht unter dem Vorbehalt des für alle geltenden Gesetzes. Der Wechselwirkung von Kirchenfreiheit und Schrankenzweck ist durch entsprechende Güterabwägung Rechnung zu tragen. Dabei ist dem Selbstverständnis der Kirchen ein besonderes Gewicht beizumessen, das auch bei der Interpretation des Individualarbeitsrechts zu beachten ist (Bundesverfassungsgericht a.a.O.).
Danach bestimmt sich die Reichweite des für die Kirche bestehenden Privilegs insbesondere auch hinsichtlich der Entscheidung, ob die bei ihr beschäftigten Mitarbeiter der christlichen Kirche angehören müssen oder nicht, allein nach ihrem Selbstverständnis. Dem folgt auch der Beklagte mit der von ihm in diesem Rechtsstreit vertretenen Auffassung.
Die uneingeschränkte Anwendung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auf die Ausnahmeklausel des § 9 AGG begegnet jedoch in der arbeitsrechtlichen Literatur erheblicher Kritik.
Danach muss der Begriff des Selbstverständnisses im Kontext des § 9 Abs. 1 AGG neu und restriktiver interpretiert werden, um richtlinienkonform zu sein. Bei der Auslegung der Auswirkungen des Selbstverständnisses müsse berücksichtigt werden, dass sich die aus § 9 Abs. 1 abgeleitete Privilegierung des kirchlichen Arbeitgebers auf wesentliche berufliche Anforderungen beziehe. Diese in Artikel 4 Abs. 2 der Rahmenrichtlinie, nicht aber in § 9 Abs. 1 enthaltene Begrenzung verdeutliche, dass sich aus dem „Selbstverständnis" kein allgemeiner Anspruch auf unterschiedliche Behandlung ableiten lasse. Ein solcher könne sich nur auf den „wesentlichen" Kernbereich von Berufsfeldern beschränken, die inhaltlich direkt mit der Vermittlung der Inhalte der Religion befasst seien oder die der unmittelbaren Ausübung des Glaubens oder der Anschauung dienten. Eine solche Auslegung werde auch gestützt durch den Erwägungsgrund 23 der Richtlinie, der ausdrücklich nur von „sehr begrenzten Bedingungen" spreche, unter denen eine „unterschiedliche Behandlung gerechtfertigt sein kann".
Vor diesem Hintergrund könne das Selbstverständnis einer Religionsgemeinschaft kein absoluter und abschließender Maßstab mehr für die Bewertung der Zulässigkeit einer unterschiedlichen Behandlung sein (Wedde in Däubler/ Bertzbach, AGG Kommentar § 9 Randnote 35, 41, 42 m. w. N.).
Ausgehend von diesen Überlegungen, denen sich die entscheidende Kammer in vollem Umfang anschließt, steht es der Kirche und damit dem Beklagten entgegen dessen Auffassung nicht frei, berufliche Anforderungen für eine jedwede Tätigkeit in seinem Wirkungskreis zu definieren und damit zur Voraussetzung für eine Einstellung zu machen, ohne dass es noch auf eine spezifische Rechtfertigung für die daraus folgende unterschiedliche Behandlung ankommt. Für die konkrete Tätigkeit darf das Selbstverständnis des Beklagten nur dann eine entscheidende Rolle spielen, wenn diese dazu in einer direkten Beziehung steht.
Unter Beachtung des so verstandenen Selbstverständnisses der Kirche hat die Beurteilung zu erfolgen, ob die Religion von Beschäftigten im Hinblick auf das Selbstverständnis der Kirche oder nach Art der Tätigkeit eine gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellt.
dd) Für die hier in Frage stehende Stelle einer Sozialpädagogin im Rahmen des Teilprojekts „Integrationslotse H." ist die Zugehörigkeit zur christlichen Kirche und damit die christliche Religion keine in Hinblick auf das Selbstbestimmungsrecht des Beklagten gerechtfertigte berufliche Anforderung.
Das Selbstbestimmungsrecht, das in Artikel 137 Abs. 3 WRV seinen direkten Ursprung hat, beinhaltet das Recht der Kirche, alle eigenen Angelegenheiten gemäß den spezifischen kirchlichen Ordnungsgesichtspunkten rechtlich gestalten zu können (Rust/Falk a.a.O. § 9 Randnote 53). Auf die insoweit oben zitierten Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts wird verwiesen.
Diese weitreichenden Befugnisse berechtigen die Kirche jedoch nicht festzulegen, dass alle Tätigkeiten unabhängig von dem konkreten Tätigkeitsbezug nur von Angehörigen der kirchlichen Gemeinschaft besetzt werden können. Eine solche Festlegung stünde in offenkundigem Widerspruch zu der Vorgabe der Rahmenrichtlinie, nach der nur wesentliche berufliche Anforderungen festgelegt werden dürfen (Wedde a.a.O. Randnote 52).
Bei richtlinienkonformer Auslegung ist es zulässig, wenn der kirchliche Arbeitgeber in Ausfüllung des Selbstbestimmungsrechtes, soweit es um die religiöse Dimension des kirchlichen Dienstes geht, die Einstellung von der Kirchenzugehörigkeit abhängig macht (Rust/Falke a.a.O. Randnote 110). Dies betrifft sämtliche Tätigkeiten, die den Verkündungsauftrag zum Gegenstand haben, den sogenannten „verkündungsnahen Bereich". Auch bestimmte exponierte Positionen wie z. B. Geschäftsführerfunktionen von kirchlichen Krankenhäusern oder von weltanschaulichen Schulen können darunterfallen (Wedde a.a.O. Randnote 51). Nicht erfasst werden jedoch Positionen, die keine Berührung mit der Verkündung der Botschaft der christlichen Kirche haben (sogenannter „verkündungsferner Bereich"). Insoweit bestehen keine schützenswerten Interessen der Kirche, die eine Ungleichbehandlung rechtfertigen könnten (Bauer/Göpfert/Krieger AGG Kommentar § 9 Randnote 15).
Der Beklagte versteht sich auf der Grundlage seiner Präambel als Repräsentant der Evangelischen Kirche und ihrer zentralen christlichen Glaubensinhalte. Sein diakonisches Wirken ist Religionsausübung. Er ist daher grundsätzlich berechtigt, die materiellen Inhalte der beruflichen Anforderung selbst zu bestimmen. Er beruft sich insoweit auf die Richtlinien des Rates der EKD. Dort wird in § 3 Abs. 1 grundsätzlich die Zugehörigkeit zu einer evangelischen Kirche zur Voraussetzung für die berufliche Mitarbeit in der EKD und ihrer DW gemacht. Nach Abs. 2 kann davon jedoch abgewichen werden für Aufgaben, die nicht der Verkündung, Seelsorge, Unterweisung oder Leitung zuzuordnen sind, wenn andere geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht zu gewinnen sind. In diesem Fall können auch Personen eingestellt werden, die einer anderen Mitgliedskirche der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland oder der Vereinigung evangelischer Freikirchen angehören sollen. Die Einstellungsmöglichkeit von Personen anderer Religionen wird nicht ausdrücklich untersagt. Unstreitig beschäftigt der Beklagte auch vereinzelt Personen, die weder der Evangelischen noch der Katholischen Kirche bzw. einer freikirchlichen oder griechisch-orthodoxen Konfession angehören.
Damit trägt sowohl die Richtlinie als auch die Praxis des Beklagten der Forderung ein Stück weit Rechnung, dass für Tätigkeiten im verkündungsfernen Bereich die Zugehörigkeit zur christlichen Kirche nicht Einstellungsvoraussetzung sein muss.
In Bezug auf die hier streitige Stelle hat der Beklagte nicht plausibel dargelegt, dass diese dem verkündungsnahen Bereich im oben dargelegten Sinne zuzurechnen ist, insbesondere konkrete Ausführungen dazu, dass und inwieweit die Stelle der Verkündung, Seelsorge, Unterweisung oder Leitung zuzuordnen ist, nicht gemacht. Anhaltspunkte, dass es sich um eine herausragende Position handelt, die notwendig die Identifizierung mit den Verkündungsinhalten der christlichen Kirche erfordert, sind nicht ersichtlich und von dem Beklagten im Übrigen auch nicht vorgetragen.
ee) Auch nach Art der Tätigkeit, die eine Sozialpädagogin im Rahmen des Teilprojektes „Integrationslotse H." zu verrichten hat, ist die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche nicht eine gerechtfertigte berufliche Anforderung.
Einschlägig sind nur solche Anforderungen, die sich für bestimmte Arten von Tätigkeiten unmittelbar aus einem Zusammenspiel von religiösem oder weltanschaulichem Selbstverständnis und konkreter beruflicher Anforderung ergeben. In richtlinienkonformer Auslegung sind auch diese Voraussetzungen eng zu fassen. Insoweit muss der Nachweis erbracht werden, dass es sich um wesentliche Anforderungen handelt, die unter Beachtung der Ziele der Religionsgemeinschaft für die Ausführung der bestimmten Art der Tätigkeit unumgänglich ist (Wedde a.a.O. Randnote 54).
Vorliegend macht der Beklagte unter Bezugnahme auf die Stellenausschreibung geltend, zu den Aufgaben der in Frage stehenden Stelle gehörten öffentliche Auftritte gegenüber verschiedenen Behörden, in verschiedenen Gremien, Institutionen und Verbänden sowie gegenüber kommunalen, nationalen und unternationalen Einrichtungen. Damit erhalte die Tätigkeit einen unmittelbaren kirchlich-diakonischen Einschlag. Weder aus der Stellenbeschreibung noch aus dem Vortrag des Beklagten geht jedoch konkret hervor, wie sich diese öffentlichen Auftritte gestalten und dass im Zuge dieser Auftritte eine Vermittlung, Verkündung oder praktische Umsetzung der christlichen Religion stattfinden soll. Sofern die Stellenbeschreibung von Bezug auf die „Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Teilprojekts Integrationslotse H." nimmt, ergibt sich aus dem Wortlaut vielmehr die Annahme, dass im Zuge der Auftritte Gesprächsinhalt das Teilprojekt und nicht der religiöse Hintergrund des Beklagten ist. Für seine Behauptung, das Anliegen und Ziel des Projektes, die Begleitung der Integration der Migranten in die hiesige Gesellschaft, könne nur von einer Person mit einem Hintergrund, der nicht dem des zu betreuenden Migranten entspreche, geleistet werden, bleibt der Beklagte eine Begründung schuldig. Selbst wenn dies der Fall wäre, ist nicht ersichtlich, warum dazu nur Personen mit einer Kirchenzugehörigkeit in der Lage sein können.
Damit hat der Beklagte die ihm gemäß § 22 AGB obliegende Darlegungs- und Beweislast nicht erfüllt.
Davon abgesehen spricht sowohl die umfassende Fremdfinanzierung des Projektes Integrationslotse als auch die dringende Empfehlung in dem Zuwendungsbescheid, keine den Bewerberkreis einschränkenden Vorgaben zu machen und die Auswahl der Mitarbeiter neutral durchzuführen, entschieden gegen die christliche Prägung der in Frage stehenden Stelle. Wenn tatsächlich die Zuwendungsgeber auf europäischer und nationaler Ebene, wie der Beklagte behauptet, davon ausgehen, dass eine Durchführung der von ihnen finanzierten Projekte seitens eines kirchlich-diakonischen Trägers unter den Vorbehalten des kirchlichen Selbstbestimmungsrechtes steht, kann die Empfehlung nur als dringender unermüdlicher Appell verstanden werden, darauf bei dem in Frage stehenden Projekt zu verzichten.
b) Die Klägerin ist nicht wegen ihrer ethnischen Herkunft benachteiligt worden.
§ 1 AGG unterscheidet ausdrücklich zwischen Benachteiligung wegen ethnischer Herkunft und wegen Religion. „Ethnische Herkunft" zeichnet sich durch gemeinsame Herkunft, Geschichte, Kultur oder Zusammengehörigkeitsgefühl aus. Eine Subsummierung der Religion unter das Merkmal ethnische Herkunft hätte zur Folge, dass eine Trennung der beiden Merkmale nicht mehr möglich wäre. Nur wenn eine Differenzierung wegen der Religion nur vorgeschoben wird, um eine tatsächlich gewollte Benachteiligung wegen der ethnischen Herkunft zu verschleiern, kann es sich um eine mittelbare Benachteiligung in Form einer versteckten Benachteiligung wegen ethnischer Herkunft handeln (vgl. Schlachter a.a.O. § 1 Randnote 4).
Davon ist vorliegend nicht auszugehen. Der Beklagte hat deutlich zum Ausdruck gebracht, dass es ihm tatsächlich auf die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche ankam. Bestätigung findet dies darin, dass nach seinem unwidersprochenen Vortrag die ausgeschriebene Stelle eine gebürtige Inderin erhielt.
Dem ist die Klägerin nicht substantiiert entgegengetreten.
2.) Da der Beklagte die Klägerin nach allem wegen ihrer Religion im Einstellungsverfahren benachteiligt hat, steht der Klägerin ein Entschädigungsanspruch gegen den Beklagten gemäß § 15 Abs. 2 AGG zu.
Bei der Bemessung der Entschädigung ist nach dem unwidersprochenen Vortrag der Klägerin von einem monatlichen Verdienst für die ausgeschriebene Stelle in Höhe von EUR 1.300,00 auszugehen. Die Entschädigung ist unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalles je nach Schwere der Beeinträchtigung, Anlass und Beweggrund des Handelns und einer möglichen rechtsfeindlichen Einstellung festzulegen. Ebenso sind Präventionsgesichtspunkte zu beachten (Bücker in Rust-Falke a.a.O. § 15 Randnote 43).
Ausgehend von diesen Grundsätzen hält die Kammer eine Entschädigung von EUR 3.900,00 aus folgenden Gründen für angemessen:
Die Klägerin hatte ungeachtet der Tatsache, dass sie nicht über ein abgeschlossenes Studium der Sozialwissenschaft/Sozialpädagogik verfügt und damit das Anforderungsprofil der fraglichen Stelle nicht in vollem Umfang erfüllte, gute Aussichten, ohne Benachteiligung die Stelle zu erhalten. Nach dem unwidersprochenen Vortrag der Klägerin hielt die Mitarbeiterin der Beklagten Frau K. die Bewerbung der Klägerin für so interessant, dass sie dieser den Eintritt in die Kirche vorschlug, da dies unbedingte Voraussetzung für die Stelle sei. Ein solches Ansinnen ungeachtet der Vergewisserung, ob die Klägerin sich denn überhaupt mit den Werten und Inhalten der christlichen Kirche identifizierte, ist nur dann nachvollziehbar, wenn ein erhebliches Interesse an der Einstellung der Klägerin bestand.
Die Benachteiligung der Klägerin wegen ihrer Religion wiegt um so schwerer, als sich der Beklagte damit bewusst über die Empfehlung des Zuwendungsgebers für das Projekt Integrationslotse, die Auswahl von Mitarbeitern neutral durchzuführen, hinwegsetzte und damit eine Bereitschaft, sich mit den europäischen Vorgaben im Diskriminierungsschutz auseinanderzusetzen, vermissen lässt.
Die Klägerin hat ihren Entschädigungsanspruch rechtzeitig innerhalb der zweimonatigen Frist des § 15 Abs. 4 AGG nach Zugang der Ablehnung des Beklagten vom 06. Februar 2007 mit Schreiben vom 21. Februar 2007 geltend gemacht.
Nach allem war zu entscheiden, wie erkannt.
Die Entscheidung über die Kosten folgt aus § 46 Abs. 2 ArbGG i. V. m. § 91 ZPO.
Die Festsetzung des Streitwerts beruht auf § 61 Abs. 1 ArbGG i. V. m. § 3 ZPO.